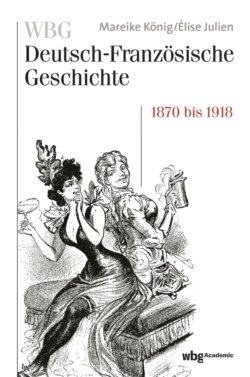Читать книгу WBG Deutsch-Französische Geschichte Bd. VII - Mareike König - Страница 20
3. Kriegerischer Frieden: Versailles 3.1. Ein Streit der Interpretationen
ОглавлениеEine Frage dominiert während des ersten Nachkriegsjahres alles: jene der Regelung des Konflikts durch Verträge. Mit dieser Frage stellt sich auch das Problem der Verantwortung für den Krieg. Und da die Pariser Konferenz und der Versailler Vertrag die politische Agenda bis Juni 1919 bestimmen, wird der Versailler Vertrag diese zum Teil auch deshalb bis zum nächsten Krieg niemals verlassen. In Deutschland beschäftigt er die Geister bisweilen bis zur Obsession. In einem ersten Schritt initiierte die Pariser Konferenz das, was Jacques Bariéty und Raymond Poidevin als „kalten deutsch-französischen Krieg“149 bezeichneten, der in politischer Hinsicht mindestens bis 1925 andauerte. Bei dieser quasi permanenten Spannung zwischen beiden Ländern ging es bald nicht mehr nur um regionale (Elsass, die Grenze, Saarland, Rheinland, Ruhr …) oder bilaterale Fragen. Sie wurde zur europäischen, ja weltweiten Herausforderung, sodass die deutschfranzösische Geschichte zwischen 1918 und 1925 über ihren eigenen Rahmen weit hinausreichte150.
Der Frieden hätte nicht konfliktträchtiger sein können. 1918 bis 1919 waren die „Friedensziele“ noch Kriegsziele, vor allem für die Franzosen, die den Weltkrieg in erster Linie als deutsch-französische Auseinandersetzung auf ihrem eigenen Boden erlebt hatten.
Über die Friedenskonferenz und die Verträge ist viel geschrieben worden, und dies nicht nur in Frankreich und Deutschland. Die Geschichtsschreibung über die Zwischenkriegszeit, anschließend die klassische politische Historiographie haben daraus eine der am meisten diskutierten und untersuchten Fragen zur Geschichte des Ersten Weltkriegs und der Zwischenkriegszeit gemacht, bis hin zu dem Eindruck, dass dies das einzige verbindende Element zwischen den zwei Zeitabschnitten sei. Es wäre zu langweilig, auf diese Literatur zurückzukommen, die oft polemisch ist und in ihren politischen Ansichten von nationalen Interessen oder politischen Meinungen diktiert wurde, auch wenn dies nie systematisch geschah. Aber der Vertrag mit seinen Konsequenzen war nicht nur um seiner selbst willen Objekt der Geschichte oder der Politikwissenschaft. Durch Interpretationen und Kriegsberichte, die er transportierte, stellte er explizite Fragen an die Historiker. Man kann tatsächlich sagen, dass die Frage nach den Kriegsursachen, die lange Zeit die Geschichtsschreibung über den Ersten Weltkrieg dominierte – bis hin zur Polemik gegenüber den Thesen von Fritz Fischer151 in den sechziger Jahren –, das direkte Ergebnis des Vertrages selbst und vor allem seines berühmten Paragraphen 231 war:
„Die alliierten und assoziierten Regierungen erklären und Deutschland erkennt an, dass Deutschland und seine Verbündeten als Urheber aller Verluste und aller Schäden verantwortlich sind, welche die alliierten und assoziierten Regierungen und ihre Angehörigen infolge des ihnen durch den Angriff Deutschlands und seiner Verbündeten aufgezwungenen Krieges erlitten haben.“
Die Thesen Fischers und seiner Schüler, die implizit in dieselbe Richtung wiesen wie dieser Paragraph, revidierten die klassische Interpretation, gemäß derer Versailles durch seine objektive Härte den Ursprung des deutschen Revisionismus in seiner extremsten Form darstellte: des Nationalsozialismus. Eine Idee, die der SPD-Abgeordnete Otto Wels im Exil in die schöne Formulierung fasste: „Erst kam das Diktat, dann der Diktator“152.
Für Fischer lagen die Ursprünge des Nationalsozialismus in einem deutschen Imperialismus, der sich deutlich in der Kriegserklärung 1914 und den formulierten Kriegszielen ausgedrückt hatte. Fritz Fischer stellte tatsächlich die Weichen für eine Erklärung, die mehr im Innern Deutschlands lag und nach und nach, indem sie sich um eine soziale Dimension erweiterte, zum Paradigma wurde: den Sonderweg. In dieser Perspektive werden der Versailler Vertrag wie auch die Ereignisse und ihre Zufälligkeiten in den Hintergrund verbannt. Mit dieser Generation von Historikern verändert sich der Versailler Vertrag vom Grund für den Aufstieg des Nationalsozialismus zu einer simplen rhetorischen Triebfeder für die nationalsozialistische Propaganda.
Aber auch wenn die beiden großen Erklärungsmodelle aufeinander abgestimmt zu sein und sich zu widersprechen scheinen, so schließen sie sich doch nicht gegenseitig aus. Die sozialen und kulturellen Auswirkungen und vor allem die Furcht vor den Auswirkungen des Versailler Vertrages in der Bevölkerung waren lange Zeit vernachlässigte Themen oder wurden nur in klassischen Untersuchungen über die öffentliche Meinung thematisiert, die in erster Linie auf Presseauswertungen beruhten und in einen nationalen Maßstab eingebettet waren153. Eine transnationale Geschichte der konkreten Auswirkungen des Versailler Vertrags wie auch der Darstellungen, die diese Effekte erzielen konnten, muss in weiten Teilen noch geschrieben werden.
In Deutschland sind der Vertrag und seine Implikationen seit 1919 ein Thema der „intensiven gegenseitigen Durchdringung von Historie und Politik“154.In diesem Sinn schreibt z.B. der Historiker Gerhard Ritter, selbst Kriegsteilnehmer und im Krieg verletzt, im Juni 1919, dass der Vertrag seiner Meinung nach ein Versuch sei, „einem Siebzigmillionenvolk planmäßig das Lebensblut auszusaugen“155. Als Konfliktort der Interpretationen sollte er zum „Erinnerungsort“ einer konfliktgeladenen Erinnerung werden156.
Aber die Konsequenzen des Friedens wurden unmittelbar nach seiner Unterzeichnung auch im Umkreis von Sozialwissenschaftlern der anderen kriegführenden Länder debattiert, wie die bekannten Werke des französischen Historikers Jacques Bainville oder des Ökonomen John Maynard Keynes belegen157.
Erst vor kurzem wurde die Akte Versailles unter dem Blickpunkt neuer historischer Herangehensweisen erneut geöffnet und untersucht158. Alle diese Stufen der Geschichtsschreibung erlauben uns nunmehr, uns eine klare Vorstellung von den Ereignissen selbst zu machen, auch wenn die Tragweite des Vertrages, vor allem hinsichtlich der Gesellschaften und ihrer Mentalitäten, weiterhin debattiert wird und debattiert werden muss. Hauptsächlich geht es darum, die exzessiven Visionen zu überwinden, die aus Versailles entweder einen objektiven Grund für den Aufstieg des Nationalsozialismus machen oder einen rein rhetorischen Kunstgriff. Unter diesem Gesichtspunkt hat Gerd Krumeich gezeigt, bis zu welchem Punkt diese Rhetorik in der deutschen Gesellschaft einen Konsens und einen Querschnitt bildete159.