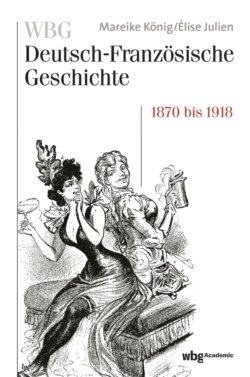Читать книгу WBG Deutsch-Französische Geschichte Bd. VII - Mareike König - Страница 8
Einleitung:
Verletzungen und Traumata
ОглавлениеDas Jahr 1918 bedeutete nicht für alle das Ende des Krieges. Für ungefähr 1.376.000 junge Franzosen und 2.034.000 junge Deutsche1 endete dieser auf tragische Weise im Schlamm des Artois, Flanderns, Lothringens, der Somme oder in den weiten Ebenen Osteuropas. Darüber hinaus sollte der Konflikt – trotz des Endes der Feindseligkeiten – für eine ganze Reihe von „Heimkehrern“, so nannten sich die Veteranen bisweilen, niemals enden: Hatte Kurt Tucholsky nicht 1925 geschrieben, der Soldat des Ersten Weltkriegs sei an das Leben zurückgegeben worden als „ein Ding, das der ziemlich guten Nachahmung eines Menschen glich“2? Parallel dazu hatte der französische Schriftsteller und Soldat Léon Werth von der Hauptfigur seines autobiographischen Kriegsromans gesagt, dass dieser, „vom Krieg befreit, rasch begriffen hatte, dass der Krieg ihn nicht unversehrt an das Leben zurückgegeben hatte“3.
Die Kriegsversehrten, die durch Gas Vergifteten, die „Kriegsneurotiker“ (4.266.000 französische und 4 216 058 deutsche Verletzte zwischen 1914 und 1918) wie auch die vergewaltigten Frauen, die durch die langen Perioden der Besatzung misshandelten Zivilisten, die Waisenkinder, all die Trauernden, die Witwen, die Eltern, die ihre Söhne an der Front oder durch die Hungerblockade verloren hatten, sie alle mussten ihre Leben während des Ersten Weltkrieges an ihrem Körper, ihrem Herz und ihrem Geist befestigt tragen. Weiterhin waren Millionen von Kindern und Heranwachsenden während der Kriegsjahre sozialisiert worden, einige von ihnen in den besetzten Gebieten in direktem Kontakt mit einem als grausam und schlecht beschriebenen Feind4. Die anderen hatten – selbst wenn sie weiter von der Front entfernt waren – eine patriotischere und nationalistischere Erziehung erhalten als je zuvor5.