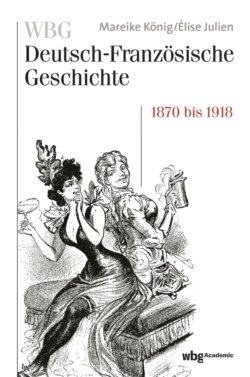Читать книгу WBG Deutsch-Französische Geschichte Bd. VII - Mareike König - Страница 13
1. Den Krieg beenden? 1.1. Eine allgemeine Erwartung: Der Sieg
ОглавлениеBei der Wahl einer Perspektive ist es manchmal wichtig, „nicht alles sehen zu können“, um „einen Gesamtüberblick zu erhalten“33. Einen solchen partiellen Gesamtüberblick wollen wir hier geben. Wir haben in der Tat nicht vor, die x-te Meistererzählung anzubieten, sondern vielmehr einen Rahmen, in den sich sowohl eine reflexive Ebene hinsichtlich der Probleme und Untersuchungsobjekte dieser Epoche als auch die ‚Fälle‘ und Themen einordnen lassen, die wir im zweiten Teil dieses Buches behandeln werden.
Heute erinnert man sich an das Jahr 1918 wegen seines Endes, gleichsam als hätte es im November begonnen. Dieser Monat markierte das Ende des Kaiserreichs und somit den Anfang einer neuen Epoche. Trotzdem ist dieses Jahr nicht nur wegen seines doppelten Endes ein Übergangsjahr, denn im Laufe des Jahres 1918 veränderte der Erste Weltkrieg noch einmal sein Gesicht. Deshalb ist es grundlegend wichtig, sich mit dem letzten Kriegsjahr zu beschäftigen, um die Auswirkungen des Krieges und der unmittelbaren Nachkriegszeit auf die 1920er und 1930er Jahre zu ermessen34. Dies ist umso wichtiger, als die klassischen Geschichtswerke dieser Epoche, sowohl deutsche als auch französische, aufgrund von chronologischen Trennlinien die Kriegszeit selten mit einbeziehen. Die Spezialisten für Weimar oder die französische Zwischenkriegszeit, die sich mit Gesamtdarstellungen befasst haben, sind selten Experten für den Ersten Weltkrieg. In diesem Zusammenhang ist dieses Werk ebenso ein Versuch wie auch eine Synthese, die die Wechselwirkungen zwischen beiden Nachbarländern zusammenfasst.
Aus dieser Perspektive verdienen einige Elemente eine besondere Aufmerksamkeit. Über die politische Regelung des Konfliktes durch die Pariser Verhandlungen und die Verträge von 1919 hinaus geht es darum zu untersuchen, wie die beiden Länder militärisch den Krieg hinter sich gelassen haben und wie das Kriegsschicksal interpretiert wurde, als es sich abzeichnete sowie kurz danach. Es geht aber auch darum, in welchem Zustand die deutsche und französische Bevölkerung im letzten Kriegsjahr und im ersten Friedensjahr lebte, das für die einen vom Sieg, für die anderen von der Niederlage gekennzeichnet war.
Der Versuch, diese Erfahrungen zu rekonstruieren, die von ganz verschiedenen Variablen wie Alter, Geschlecht, Nationalität, regionale Herkunft, soziale Klassen etc. abhängen, ohne die spezifische Reaktionsweise jedes Individuums auf das Ereignis mit einzubeziehen, mag ein gewagtes Unterfangen sein. Es ist jedoch ohne Zweifel eine der Pflichten des Sozial- und Kulturhistorikers, dieses Wagnis einzugehen, selbst wenn er um die Unvollkommenheit des Ergebnisses weiß.
Die Aufgabe ist umso schwieriger, als der Sinn, der dieser Erfahrung gegeben wird, mindestens genauso wichtig ist wie die Erfahrung selbst. Dieser Sinn aber, der für den Historiker durch die überlieferten Quellen leichter zugänglich ist – etwa durch Memoiren, Zeugnisse, Korrespondenzen und kulturelle Hinterlassenschaften –, ist gleichzeitig eine Projektionsfläche und ein Schutzschirm. Die Aussage von Zeitzeugen, um nur ein grundlegendes Beispiel zu nennen35, erlaubt eine Annäherung an die Kriegserfahrungen, lässt aber gleichzeitig einen Vorhang zwischen diese und den Leser fallen, der unter Umständen ein Gefangener des Blicks des Zeitzeugens werden kann. Aber man darf sich nicht mit der Aporie zufriedengeben. Der Kriegsausgang bietet einen großen und weiten Interpretationsspielraum für den Krieg im Spiegel seiner Auswirkungen. Er erfordert es auch, zu den Erwartungen der Akteure zurückzukommen, zu ihren Zukunftsvorstellungen, zu der Art und Weise, wie die Zukunft, die sie sich vorstellten, Vergangenheit wurde36.
Der daraus resultierende Streit der Interpretationen schafft die Möglichkeit, etwas von dem Kaleidoskop an Erfahrungen wiederzufinden. Eine andere Methode kann der Vergleich und die Reflexivität des historischen Blicks darstellen. Die Historisierung von Erwartungen – und ihre Enttäuschung37 – ist ebenfalls wichtig. Daher erscheint es angemessen, zunächst die Erwartungen an den Konflikt zu untersuchen sowie die Weise, wie sich Deutsche und Franzosen den Kriegsausgang vor 1918 vorstellen konnten. Wir behaupten nämlich, dass der Schock über die Diskrepanz zwischen Kriegserwartung und tatsächlichem Kriegsausgang im Zentrum der Erfahrungen des Kriegsendes steht und in beiden Ländern schwer auf der Nachkriegszeit lastet. Der Sinn, der diesen Ereignissen gegeben wurde, und die Art und Weise ihrer Darstellung sind nicht nur Projektionen, sondern echter Teil der Erfahrung selbst, ebenso wie die „wirklich erlebte“ Alltagserfahrung. Beide sind unzertrennlich.
Die neueren Untersuchungen zur Kulturgeschichte des Ersten Weltkriegs haben sich genau auf diese Kriegserwartungen konzentriert, das heißt letztlich auf die ultimativen Ziele, die man sich von der Konfliktregelung erwartete. Das Aufkommen dieser Erwartungen und die enorme Investition spontaner Gefühle in diese Erwartungen bildete das Zentrum der „Kriegskulturen“38. Tatsächlich drückten sie sich in ihrer großen Verschiedenheit durch Praktiken und Darstellungsformen aus, die gleichzeitig Antworten auf neue Erfahrungen sind, so wie sie erlebt wurden, aber auch das Resultat der affektiven und/oder ideologischen Investition der Individuen angesichts dieser privaten Erfahrungen wie auch der allgemeinen Konfliktsituation. Zusammenfassend könnte man einfach sagen, dass der Krieg niemals indifferent lässt und dass man fast immer etwas Großes von ihm erwartet, etwas Ultimatives: ob das der dauerhafte Frieden ist, der Krieg, der alle künftigen Kriege verhindert – das was die Franzosen mit dem Ausdruck „la der des ders“ bezeichnen –, oder die Auslöschung des Gegners und der finale Sieg.
In dieser Hinsicht ist die Stärke der Investition in die Erwartung genauso wichtig wie der Inhalt und die Art der Erwartung. Der Schock der Enttäuschung oder Desillusionierung nach 1918 konnte tatsächlich heftiger kaum sein. Im Fall des besiegten Deutschland ist der Schock zweifellos noch größer, auch wenn der Sieg in Frankreich häufig als bitter und sehr teuer bezahlt empfunden wurde. Le Petit Provençal beschreibt die Freudenszenen am 11. November 1918, als 500.000 Personen auf den beflaggten Straßen von Marseille unterwegs waren:
„Jeder vibriert! Enthusiasmus ist an der Tagesordnung. Dennoch sind einige traurig, denn sie beweinen einen der Ihren, der im 51-monatigen Sturm verschwunden ist. Sie weinen um das teure Wesen, das sie dem Vaterland gegeben haben, damit Frankreich eines Tages glücklich sein könne. (…) Falls Sie einen Trauerschleier, einen Trauerflor sehen, Einwohner von Marseille, werdet leise! Verbeugt euch vor dem Schmerz, der für Frankreich erlebt wurde! Verbeugt euch vor denen, die einen der Helden beweinen, die den Sieg errungen haben, den ihr feiert.“39
Unter den großen Erwartungen rangierte unbestritten der Friedenswille, manchmal auch interpretiert als „Friedensehnsucht“. Diese war weit verbreitet, aber nicht dem Pazifismus gleichzusetzen. Tatsächlich war der während des Krieges erwartete Frieden keiner um jeden Preis.
Jüngste Forschungen zur Ikone des Pazifismus, Henri Barbusse, haben gezeigt, dass auch für ihn der Frieden einem Sieg über Deutschland untergeordnet war, dem „zentralen Schlupfwinkel von Kaiser, Kronprinz, Gutsherren und Haudegen, die ein Volk einkerkern und die anderen einkerkern möchten“40. Wenn dieser Satz sein Engagement 1914 rechtfertigte, musste er seinen Appell für einen siegreichen und aufopferungsvollen Frieden während des gesamten Krieges wiederholen, wie z.B. nach den Meutereien, die die französische Armee erschütterten, in den 191741 veröffentlichten Artikeln mit dem Titel Pourquoi te-bats tu? (Warum kämpfst du?) oder Jusqu’au bout (Bis zum Ende):
„Führt diesen Krieg bis zum Ende, bis zum Ende des Elends, des Leidens, des Unglücks und der Schande, die der Krieg seit Millionen Jahren über die Erde verbreitet hat, opfert euch und gebt euch hin bis zum Ende, damit eure Kinder eines Tages nicht das tun müssen, was ihr getan habt.“42
Zweifellos waren die in den Sieg gesetzten Erwartungen von sehr unterschiedlicher Natur. Während die Mehrheit hofft, dass der Krieg „der letzte der letzten“ sein wird, der „Krieg, der allen Kriegen ein Ende setzen wird“, sind die Mittel, um dies zu erreichen, und die mit dieser Idee verbundenen Vorstellungen sehr verschieden. Barbusse versprach sich davon eine neue Welt, besser und befriedet, die nach dem Krieg unter seiner Feder eine kommunistische werden wird. Andere erhoffen sich, Deutschland zu bestrafen oder zumindest durch Waffengewalt und die Verträge eine endgültige Sicherheit für Frankreich und seine Grenzen zu erreichen. Ihrer Meinung nach wird allein diese Sicherheit der Garant für den künftigen Frieden sein.
Aber die Verschiedenartigkeit dieser Erwartungen, die manchmal eine sehr ausgeprägte eschatologische Dimension43 enthalten, verdecken nicht, dass die häufigste Erwartung der siegreiche Frieden ist. Diese Erwartung erklärt, warum eine Mehrheit von Franzosen wie Deutschen, trotz ihrer extremen Kriegsverdrossenheit und ihres Willens, den Krieg bald enden zu sehen, „nicht ertragen konnten, besiegt zu leben“44. Diese Tatsache sollte man umso mehr im Hinterkopf behalten, als das Jahr 1918 eine erneute Mobilisierung dieser großen Erwartungen erlebt, hauptsächlich auf eine Rückkehr des Bewegungskrieges, der eine baldige Entscheidung des Krieges voraussehen ließe.