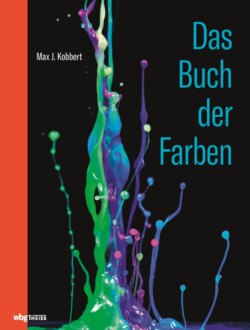Читать книгу Das Buch der Farben - Max J. Kobbert - Страница 6
Оглавление| 1 | Einleitung: Was ist eigentlich „Farbe“? |
Ist Weiß eine Farbe?
Vater streicht die Wände. Die Familie schaut kritisch zu. Er rührt die weiße Masse um und brummt: „Das ist gute Farbe.“
„Weiß ist doch keine Farbe!“, Tochter Birgit verdreht die Augen.
„Diese Pampe ist überhaupt keine Farbe, ob weiß oder nicht!“, wirft Harald dazwischen, der gerade aus dem Physikunterricht kommt. „Farbe ist nichts anderes als elektromagnetische Strahlung.“
„Moment“, äußert sich Mutter. Sie ist Biologielehrerin und weiß: „Farbe ist ein Reiz, der im Auge ausgelöst wird.“
„Ihr habt ja alle keine Ahnung!“, ereifert sich Birgit. „In Kunst hatten wir heute Delauney. Das sind Farben! Absolut kosmisch! Wie ein Rausch!“
Unversehens hat sich die Familie in ein Thema vertieft, über das Künstler und Wissenschaftler seit Jahrhunderten streiten. Gehen wir zunächst einmal von der eigenen Anschauung aus.
Kleiner Erlebnistrip durch die Farbenwelt
Zu Beginn ein kleiner Versuch, den Sie unbedingt durchführen sollten. Dazu folgende Spielregel: Schauen Sie sich in Abbildung 1 die Farbfelder an. Fangen Sie mit Feld 1 an und schauen Sie zwei Minuten lang mitten darauf. Bestimmen Sie genau den Farbton, den Sie sehen, und finden Sie Worte dafür, wie die Farbe auf Sie wirkt. Danach wechseln Sie im Uhrzeigersinn auf das nächste Farbfeld, blicken mitten darauf und lassen die Farbe zwei Minuten lang auf sich wirken. Blicken Sie nicht zwischendurch woanders hin.
Nachdem Sie wieder bei Farbfeld I angelangt sind, machen Sie das Gleiche noch einmal, aber diesmal gegen den Uhrzeigersinn.
In großen Schritten sind Sie nun zweimal durch die Farbenwelt gegangen. Sicherlich ist Ihnen aufgefallen, wie anders die Farben auf dem Rückweg gegenüber dem Hinweg gewirkt haben. In Versuchen mit 3 × 2 m großen Farbflächen, als Dias projiziert, waren folgende Beschreibungen häufig:
1 Reines Rot – lebhaft, aggressiv
2 Gelborange – warm, ruhig
3 Grüngelb – giftig, frisch
4 Blaugrün – ruhig, angenehm, kühl
5 Indigoblau – weit, ruhig, beruhigend, kalt
6 Pink – kitschig, süßlich
Beim Ausgangspunkt angekommen:
1 Zinnoberrot – heiß, lebhaft, nah
Von dort aus nun rückwärts:
6 Erikafarben – ruhig, angenehm
5 Meerblau – leuchtend, transparent, ruhig
4 Giftgrün – sauer, unangenehm, frisch
3 Orangegelb – angenehm, warm, freundlich
2 Rotorange – feurig, stechend
1 Purpurrot – ruhig, mächtig, kühl
Genannt wurden rein visuelle Eigenschaften wie Farbton oder Helligkeit, aber auch Eigenschaften wie warm und sauer, nah und weit, lebhaft und aggressiv, angenehm und unangenehm. Auf all dies kommen wir später zurück. Jetzt soll es nur um die Unterschiede zwischen den beiden Hälften des Experiments gehen.
Vier Bedeutungen von „Farbe“
Nehmen wir zum Beispiel das Farbfeld 3 in Abbildung 1. Wir haben es zweimal gesehen. War es in beiden Fällen die gleiche Farbe oder nicht? Was würden Sie sagen?
Harald sagt: „Natürlich ist es die gleiche Farbe, es war doch das gleiche Feld zu sehen.“ Birgit sagt: „Erst habe ich Grüngelb, dann Orangegelb gesehen, also verschiedene Farben.“
Wer hat recht? Offenbar meinen beide mit „Farbe“ nicht das Gleiche. Harald versteht darunter ein objektives Merkmal, Birgit eine subjektive Wahrnehmung. Auch Harald hatte zuerst Grüngelb und dann Orangegelb gesehen. Er meint, dass die Farbe zwar verschieden aussah, es aber in Wirklichkeit die gleiche war. Doch: Was ist denn Farbe „in Wirklichkeit“?
Sehen wir uns die Situation genauer an: Auf der Buchseite, die wir bei unserem Versuch betrachtet haben, sind bestimmte Farbmittel aufgedruckt. Oft wird das Wort „Farbe“ in diesem stofflichen Sinne gebraucht. In diesem Sinne verwendet es auch der Vater in der anfangs geschilderten Szene, und in diesem Sinne war es die gleiche Farbe.
1 : Rundweg durch die Farbenwelt.
Abb. 2 : Vier Bedeutungen von „Farbe“ am Beispiel eines Bildes.
Ohne Licht bleibt das Farbmittel aber unsichtbar. Es muss beleuchtet werden. Physikalisch handelt es sich also um ein Gemisch von elektromagnetischen Wellen. Das Pigment reflektiert davon einen Teil. Das ist „Farbe“ im physikalischen Sinn, wie es Harald meint. Auch in diesem Sinne war es die gleiche Farbe.
Die elektromagnetischen Wellen werden in den Rezeptoren des Auges zum „Reiz“. Die Signale werden im Gehirn weiterverarbeitet. Auf diese physiologischen Vorgänge bezieht sich die Mutter. Die Reaktion des Auges verändert sich durch vorausgegangene Reize. Es waren demnach unterschiedliche Farbsignale, die das Gehirn erreichten.
Bestimmte Vorgänge im Gehirn entsprechen Inhalten des Bewusstseins. Dazu gehören Erlebnisse wie „Rot“ oder „Blau“, die wir ganz persönlich haben. In diesem Sinne haben wir verschiedene Farben gesehen. Daran ändert sich auch nichts, wenn wir die berechtigte Vermutung haben, dass die jeweils zuvor gesehenen Farben eine Rolle spielten.
Damit sind vier grundsätzlich verschiedene Bedeutungen des Wortes „Farbe“ zu unterscheiden:
1 Farbe als materielle Substanz (Farbmittel)
2 Farbe als physikalische Energie (elektromagnetische Welle)
3 Farbe als physiologischer Reiz (Nervenerregung)
4 Farbe als psychologisches Phänomen (Erlebnis)
Auf die Frage, was Farbe ist, gibt es also keine einfache Antwort, sondern eine vierfache. Gewöhnlich werden diese Bedeutungen vermengt. Die Unterscheidung ist aber notwendig, wenn wir die faszinierende Welt der Farben verstehen wollen. Dazu soll das vorliegende Buch dienen.