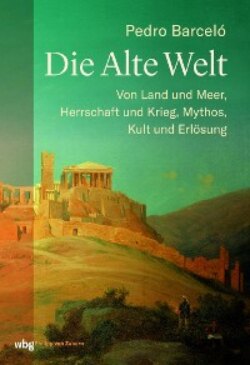Читать книгу Die Alte Welt - Pedro Barceló - Страница 16
7 Antike Wasser- und Landgrenzen Hasdrubal-Vertrag
ОглавлениеWie wenn sie ihre ersten Strahlen dorthin
Entsendet, wo sein Blut vergoß ihr Schöpfer,
Indem die Waage überm Ebro steht
Und Mittagsglut erhitzt des Ganges Welle,
So stand die Sonne und es ging zu Ende
Der Tag, als uns erschien der Engel Gottes.
(Dante, Die Göttliche Komödie, Fegefeuer, Siebenundzwanzigster Gesang, 1–6)
Wassergrenzen erlangten in der Antike eine vielschichtige Bedeutung. Sie konnten je nach Perspektive als von der Natur vorgegebene Trennungs- beziehungsweise Begegnungsräume gedeutet aber auch als geopolitische oder kulturhistorische Trennlinien verstanden werden. Der Halys stellte nicht nur die Grenze zwischen dem Herrschaftsgebiet der Lyder und der Perser dar, sondern schied eine griechisch beeinflusste Zivilisation von einer barbarischen.118 Eine ähnliche Rolle spielten die Donau, der Euphrat oder der Rhein in römischer Zeit. Allerdings galt in der imperialen Vorstellung der augusteischen Epoche der Okeanos als die natürliche Abschlusslinie, was implizit nahelegte, dass Rhein, Donau und Euphrat mitten durch römisches Gebiet strömten. Für die griechisch geprägte Weltsicht galt die Meerenge von Gibraltar als westlicher Endpunkt der zivilisierten Welt, dessen Pendant im Osten der Pontus Euxinus darstellte. Neben der politischen, geographischen oder kulturhistorischen Bedeutung von Gewässern wurden Flussgrenzen in der antiken Vorstellungswelt auch als Sinnbild von Selbstbescheidung und Zähmung aufgefasst. Sie gehörten zu den ältesten Themen der Geschichtsschreibung. Herodot hat als Warner am Beispiel der Überquerung des Hellesponts durch den Perserkönig Xerxes diese Situation in paradigmatischer Weise ausgemalt und damit ein Vorbild für die nachfolgende Literatur geschaffen.119 In Livius fand er einen gelehrigen Nachahmer. Wie der römische Historiker berichtet, hatte Hannibal am Vorabend des Kriegsausbruches und vor dem Übergang über den Hiberus einen Traum, der in unverkennbarer Analogie zur Überschreitung des Hellespont durch Xerxes stand.120 Indem Hannibal, von der hybris geleitet, den Fluss überschritt, war in Livius’ Augen sein Untergang besiegelt.
Dem livianischen Verdikt war der Hasdrubal-Vertrag vorausgegangen. Die Mehrheit der Forschung121 setzt den in besagter Vereinbarung erwähnten Fluss mit dem Ebro gleich. Andere Ansichten, die eine Lage südlich von Sagunt postulierten, konnten sich nicht durchsetzen. Am bekanntesten ist die von Carcopino vertretene These, die den Iber im Júcar zu erkennen glaubte. Diejenigen Autoren, die den Ebro mit dem Iber des Hasdrubal-Vertrages identifizieren, stützen ihre Auffassung lediglich auf die Namensähnlichkeit. Demgegenüber wird darauf verwiesen, dass dieser Flussname in Hispanien mehrfach belegt ist und im Zuge des Bekanntwerdens der Iberischen Halbinsel von Süden nach Norden wanderte.122 Jedenfalls wird seine Lokalisierung aus dem Blickwinkel der späteren Ereignisse vorgenommen.123 Doch sämtliche Indizien, die uns die Bodenfunde bieten, legen unmissverständlich nahe, die Grenze des karthagischen Machtbereiches im Südteil der Iberischen Halbinsel zu suchen.124 Hier lag der Schwerpunkt der barkidischen Aktivitäten, wo Hasdrubal kurz vor Vertragsabschluss (um 227 v. Chr.) in Erinnerung an die Heimat Qarthadasch – „die neue Stadt“ – Karthago (Cartagena) errichtet hatte. In der Nomenklatur der neuen Residenz waren ein Programm und ein Anspruch enthalten. Damit sollte nicht ein Graben zur Mutterstadt gezogen werden, sondern das Gegenteil war der Fall.125 Die Wiederholung des Namens der Mutterstadt unterstrich die wechselseitigen Bande und betonte, dass der Aktionsradius der Karthager sich keinesfalls auf Nordafrika einschränken ließ, wie dies die Römer nur allzu gern gewollt hätten.
Mit der Verlegung des Regierungssitzes nach Carthago Nova schuf Hasdrubal ein Tor zur Außenwelt. Die Stadt verfügte über einen ausgezeichneten Hafen und lag näher an Karthago als Gades. Darüber hinaus passte diese Gründung in eine strategische Gesamtkonzeption, in der die mittelmeerische Hafenstadt gleichsam einen territorialen Abschluss bildete. Beweggrund der Vereinbarung kann nicht die Festlegung einer zum damaligen Zeitpunkt (um 226 v. Chr.) dem realen Zustand der karthagischen Expansion in keiner Weise entsprechenden Demarkationslinie (Ebro) gewesen sein. In der Errichtung des neuen karthagischen Bollwerks sahen die Römer vor allem eine Gefährdung ihrer Besitzungen auf Sardinien und Sizilien und reagierten darauf mit der Verdoppelung der Prätorenstellen, um die Verteidigungsbereitschaft ihrer neuen Provinzen zu stärken. Es ging ihnen primär um die Beschneidung des karthagischen Einflusses. Aus den Aufzeichnungen des Polybios erfahren wir über die Bedingungen der Vereinbarung Folgendes: Sie (die Römer) schlossen durch eine Gesandtschaft mit Hasdrubal einen Vertrag, in dem vom übrigen Iberien kein Wort stand, dagegen bestimmt war, die Karthager sollten den Iber nicht in kriegerischer Absicht überschreiten.126
Auch bei Livius findet der Hasdrubal-Vertrag mit folgenden Worten Erwähnung:
Mit diesem Hasdrubal hatte das römische Volk, weil er ein erstaunliches Geschick darin gezeigt hatte, Völker an sich zu binden und seiner Herrschaft einzugliedern, den Vertrag mit der Bestimmung erneuert, dass der Hiberus die Grenze zwischen beiden Herrschaftsbereichen sein sollte und den mitten in den Herrschaftsbereichen beider Völker wohnenden Saguntiner ihre Unabhängigkeit erhalten bleiben sollte.127
Schließlich äußert sich Appian zur Lage des Iber folgendermaßen: Die Saguntiner, ursprünglich Bewohner aus Zakynthos, siedeln in der Mitte der Wegstrecke, die von den Pyrenäen bis zum Iber führt.128
Aus den verfügbaren Quellen geht hervor, dass der erwähnte Fluss in keinem Zusammenhang mit dem heutigen Ebro steht. Der Nordhispanien durchfließende Strom lag sehr weit von der Operationsbasis Hasdrubals entfernt. In dieses Bild passt das Fehlen jeglicher Hinweise darüber, dass sich die Karthager in dieser Zeit so dezidiert nach Norden hin orientierten.129 Mehr Sinn ergibt ein Fluss, der sich in Reichweite der konkreten Machtmöglichkeiten Hasdrubals befand. Daher bietet sich der Segura geradezu an. Eine derartige Annahme wird durch die Tatsache gestützt, dass die Karthager eine territoriale Saturierung – schließlich beherrschten sie damals die Kernzonen Andalusiens und der iberischen Südostregion – erreicht hatten. Diese Gebiete waren so groß wie Sardinien und Sizilien zusammen und von größerem Umfang als die nordafrikanischen Ländereien Karthagos. Es sei daran erinnert, dass Karthago Jahrhunderte gebraucht hatte, um überseeischen Besitz zu erwerben, und gewaltige Anstrengungen unternehmen musste, um die erreichte Machtstellung zu halten. Dieser für die Ausgestaltung der karthagischen Politik nicht zu unterschätzende Blickwinkel manifestierte sich im Hasdrubal-Vertrag. Aus karthagischer Sicht war die Sanktionierung des südlich des Segura liegenden Gebietes ein diplomatischer Erfolg. Der 1. Römisch-karthagische Krieg lag erst eine halbe Generation zurück. Aber auch den Römern brachte der Vertrag Vorteile: Die mit Rom verbündeten Massalioten sowie mehrere italische Städte erhielten Schutz für ihren Handel mit der hispanischen Ostküste.130
Die Beurteilung dieser Vorgänge findet sich in der Forschung aufs engste mit der Frage des Kriegsausbruchs verknüpft. Neben der Eroberung Sagunts wird auch die Überschreitung des Iber als Motiv für die römische Kriegserklärung angesehen.131 Als wesentlicher Grund für das römische Verhalten wird angeführt, dass Rom die Eroberung Sagunts tatenlos geschehen ließ und erst Hannibals Überschreiten des Iber in Roms Augen den casus belli schuf. Für diese Sicht ist die Gleichsetzung des Flusses im Hasdrubal-Vertrag mit dem Ebro eine notwendige – aber konstruierte – Voraussetzung. Es fällt bei den Beschwerden der Karthager vor dem Kriegsausbruch auf, dass das römische Eingreifen in Sagunt nicht als Bruch des Hasdrubal-Vertrags empfunden wurde. Vielmehr verwiesen die Karthager auf den Lutatius-Vertrag, der die Einflusssphären beider Mächte festschrieb. Warum verurteilten sie nicht die römische Einmischung in einem Gebiet, das durch den Hasdrubal-Vertrag – wäre tatsächlich der Ebro die Grenze gewesen – als karthagischer Machtbereich galt? Die Verletzung der Demarkationslinie hätte doch ein willkommenes Argument geliefert. Dass sie es nicht taten, lässt sich nur mit der Tatsache erklären, dass nicht der Ebro die Einflusssphären abgrenzte, sondern der südlich von Sagunt gelegene Segura. Polybios, der den Ereignissen am nächsten steht, belegt es unmissverständlich: Wenn man die Zerstörung Sagunts als die Ursache des Krieges betrachtet, so muss man zugeben, dass die Karthager im Unrecht waren, als sie ihn begannen, sowohl nach dem unter Lutatius abgeschlossenen Vertrag, der den beiderseitigen Bundesgenossen von beiden Seiten Sicherheit verbürgte, wie nach dem Vertrag des Hasdrubal, der den Karthagern verbot, den Iber in kriegerischer Absicht zu überschreiten.132
Iberische Halbinsel in der Barkidenzeit
Der Wortlaut dieser Äußerung ist aufschlussreich, weil daraus ersichtlich wird, dass Hannibal, bevor er Sagunt angriff, den Fluss der Hasdrubal-Vereinbarung überschritten hatte. An einer anderen Stelle berichtet Polybios über die Reaktion der Karthager auf die nach der Zerstörung Sagunts nach Karthago angereiste römische Delegation, die den Krieg erklären sollte, indem er feststellt: Über die Vereinbarung mit Hasdrubal gingen sie (die Karthager) einfach hinweg, als entweder gar nicht abgeschlossen oder, wenn dies der Fall sei, als unverbindlich für sie selbst, da sie ohne ihre Einwilligung getroffen worden sei.133
Im Klartext heißt dies, dass die Karthager auf den römischen Vorwurf, Hannibal hätte durch seine Expedition nach Sagunt die Hasdrubal-Vereinbarung verletzt, mit dem Argument der Nichtratifizierung dieses Abkommens antworteten, woraus sich ebenfalls ergibt, dass der betreffende Fluss zwischen Cartagena und Sagunt zu verorten ist. Ferner bieten die archäologischen Befunde keinerlei Hinweise für eine karthagische Landnahme nördlich des Segura. Schließlich war die von den Karthagern kontrollierte Region, die von Guadalquivir und Segura eingeschlossen wurde, hinsichtlich ihrer Ausdehnung beträchtlich und zum Zeitpunkt des Abschlusses des Hasdrubal-Abkommens keineswegs definitiv unterworfen gewesen. Ersetzt man den Segura durch den Ebro, so würde das entsprechende Territorium alle Maßstäbe bisheriger karthagischer Überseepolitik sprengen und im Übrigen den Römern eine beispiellose Großzügigkeit unterstellen, die gar nicht zu ihrem sonstigen kleinlichen Verhalten – hier wäre an Sardinien zu erinnern – passt.134
Es kommt noch ein zusätzliches Argument hinzu, das bislang übersehen worden ist. Die Demarkationslinie des karthagischen Herrschaftsbereiches im iberischen Raum, die das Guadalquivir- und Seguratal umkreiste, wird im Zuge der römischen Präsenz in Hispanien eine zusätzliche Bestätigung erfahren. Als die neuen Eroberer sich ab dem Jahr 197 v. Chr. daran machten, die territorialen Eckpunkte ihrer hispanischen Provinzen festzulegen, knüpften sie an bereits bestehende Vorgaben an, die aus der Zeit der karthagischen Verwaltung dieser Gebiete stammten. Es kann daher kein Zufall gewesen sein, dass die Trennlinie zwischen der Hispania Citerior und Ulterior just entlang jener Regionen gezogen wurde, die sich nordöstlich des Guadalquivir und südlich des Segura befanden, unter Einschluss von Neukarthago in das diesseitige Hispanien. Diese Maßnahmen waren alles andere als improvisiert; sie spiegelten jene politischen und territorialen Realitäten wider, die während der Regierung Hasdrubals geschaffen worden waren, der gestützt auf den mit den Römern vereinbarten Vertrag die Voraussetzungen für die künftige Gliederung des iberischen Raumes gelegt hatte. Daran lässt sich aus rückschauender Perspektive beispielhaft die Bedeutung von Grenzziehungen für die Konstituierung von Herrschaftsverhältnissen erkennen.