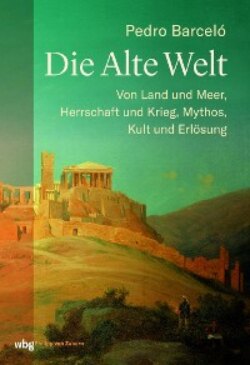Читать книгу Die Alte Welt - Pedro Barceló - Страница 17
Limes
ОглавлениеMindestens eine historische Schlussfolgerung lässt sich aus der Analyse des Hasdrubal-Vertrages ziehen. Betrachten wir ihn als Grenzvereinbarung, so unterlag seine Geltung einschließlich der Integrität der darin festgeschriebenen territorialen Fragen dem Vorbehalt der Vorläufigkeit. Grenzziehungen stehen immer in direktem Verhältnis zu den Kräfteverhältnissen der Vertragspartner. Ihre Dauer und Konsistenz hängt von zahlreichen Faktoren ab. Am wichtigsten dabei ist die Machtfrage, was wiederum impliziert, dass die erzielten Übereinkünfte grundsätzlich veränderbar sind. Dies traf in besonderer Weise auf die limites des Imperium Romanum zu, des größten Staatsgebildes des Altertums.
Hatte sich mit den Expeditionen Alexanders des Großen eine enorme Veränderung des Raumhorizontes im Osten der mittelmeerisch zentrierten Kulturwelt durchzusetzen vermocht, so galt dies auch seit Caesars transalpinen Feldzügen für den Nordwesten des europäischen Kontinents. Mit der Hinwendung nach Gallien und Britannien eröffnete sich der Blick auf die Weite des Atlantischen Ozeans, zu den Randregionen einer beinahe unbekannten nordalpinen Welt. Tatsächlich kann man sich die Wirkung der Raumveränderungen in den ersten zwei nachchristlichen Jahrhunderten kaum gewaltiger vorstellen: Die Land- und Seegrenzen des sich konstituierenden Imperium Romanum sprengten das bisherige Vorstellungsvermögen; sie hatten sich in jede Himmelsrichtung ausgeweitet, bis sie schließlich von Hispanien bis nach Mesopotamien, von Ägypten bis nach Britannien reichten. An besonders neuralgischen Stellen errichtete man limites als Korrektiv zu den von der Natur vorgegebenen Grenzmarkierungen in Form von Flüssen, Wäldern, Bergen oder Wüsten.
Der germanische Limes
Der im kaiserzeitlichen Sprachgebrauch verwendete Begriff limes bezeichnete ursprünglich einen, den topographischen Gegebenheiten des Geländes angepassten, befestigten Weg am Rande des römischen Machtbereiches im gallisch-germanischen Raum. Bis gegen Ende des 1. Jahrhunderts markierten die aus Holz ausgeführten Wehrbauten gewöhnlich den Vormarsch der römischen Legionen jenseits des Rheins und der Donau. Sie dienten primär der Absicherung der strategisch wichtigen Aufmarschstraßen und bildeten den Ausgangspunkt aller römischen Militäraktionen gegen das freie Germanien. An eine feste, starre Grenz- oder Abwehrlinie, wie es die große chinesische Mauer oder die Maginot-Linie waren, dachte man nicht. Nachdem aber die germanischen Provinzen eingerichtet – und das Konzept der Eroberung Germaniens bis zur Elbe nach der Niederlage des Varus im Teutoburger Wald (9) aufgegeben worden war –, wandelten sich die seit Domitian angelegten limites von offensiv gegen den Feind gerichteten Operationsbasen zu defensiven Stellungslinien, die den abgeschwächten Anspruch der römischen Herrschaftsausübung auf sämtliche germanischen Regionen dokumentierten. Die veränderte Funktion des Limes lässt sich aus seinem jeweiligen architektonischen Zustand ablesen. Die früheste Phase datiert aus flavischer Zeit (69–96). Damals schlugen die Römer zunächst eine Schneise in die Wälder und errichteten darauf einen Postenweg, der von hölzernen Wachtürmen flankiert wurde. Unter Hadrian lässt sich eine Neuerung beobachten: Die Aufstellung eines Palisadenzauns im Vorfeld der Straße. Seit der Mitte des 2. Jahrhunderts wurden an einzelnen Abschnitten die in regelmäßigen Abständen ausgeführten Holztürme durch Steinbauten ersetzt, wie man noch heute gut im Norden Englands sowie in Schottland sehen kann; später errichtete man an der raetischen Grenze statt der Palisade eine Mauer, die im Vorfeld von einem Graben geschützt wurde.
Mit zunehmender Zeitdauer wurde der Limes als Abschluss oder Beginn, je nach Perspektive, des römischen Herrschaftsgebiets angesehen, als randständiges Denkmal der imperialen Größe Roms. Zwar schränkte er keineswegs die römischen Expansionsambitionen ein, aber je länger er verteidigt werden musste und je schwieriger sich diese Aufgabe gestaltete, umso deutlicher wurde er als Demarkationslinie empfunden, als Begrenzungswall zwischen unterschiedlichen, stets umkämpften Kulturräumen. Als Bauwerk zwischen antagonistischen zivilisatorischen Sphären verkörperte er nicht nur das steingewordene Symbol der imperialen Machtansprüche Roms, sondern galt zunehmend als politische, juristische und territoriale Trennlinie zwischen zwei Welten: Imperium Romanum und Barbaricum. Er war aber auch ein Instrument der Kontrolle und ein Monument des Wissens und des technologischen Fortschritts einer Weltmacht, die sich ihren Nachbarn gegenüber als unüberwindbar dünkte. Die von Vergil, dem Dichter der augusteischen Epoche, aus dem Bewusstsein der römischen Überlegenheit heraus gegenüber den Völkern, die außerhalb des römischen Machtbereiches siedelten, stolz verkündete Parole eines imperium sine fine hatte sich spätestens seit dem Ansturm der germanischen Völkerscharen, die im Verlauf des 3. Jahrhunderts die Preisgabe der jenseits von Rhein und Donau gelegenen römischen Gebieten erzwangen, definitiv überlebt.