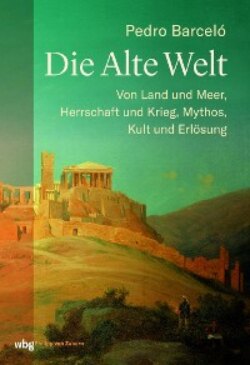Читать книгу Die Alte Welt - Pedro Barceló - Страница 8
1 Land als Lebensraum und Quelle der Macht
ОглавлениеDie Erde ist sehr groß und wir wohnen (…) nur in einem kleinen Teil von ihr um das Meer herum, wie Ameisen und Frösche um einen Teich.
(Plato, Phaidon 109 b)
Der Mensch sei ein Landtreter und kein Fisch lautet eine unwiderlegbare Behauptung zum Wesen unserer Artgenossen1, und dennoch: Über diesen naheliegenden Umstand hinweg darf man nicht verkennen, dass es zu kurz gegriffen wäre, das menschliche Dasein lediglich als erdgebunden zu betrachten; dazu ist die Dominanz der riesigen Wassermassen, die den größten Teil unseres Planeten bedecken, zu erdrückend. Wie einst die mythischen Götter nicht nur vom Himmel herab, sondern auch dem Meer entstiegen sein sollen, so gehören Erde und Wasser zum Wesen der Welterklärung und zur Komplexität der menschlichen Natur. Beide Elemente sind mehr als bloße Materie. Ihrer Wirkmächtigkeit verdanken die Erdenbewohner ihren Lebensraum: Dieser vermag nicht nur naturgegebene Trennungslinien zu überwinden, sondern ermöglicht gleichsam die Entstehung jener Szenarien, die den Rahmen der Geschichte konturieren.
Das weit verbreitete Gefühl, die Welt sei zu klein geworden, ja es würde vielerorts eine erhebliche Disproportion zwischen Raum und Bevölkerung bestehen, diese Vorstellung von Einengung der natürlichen Lebenssphären war den Menschen des Altertums weitgehend fremd. An heutigen Wertmaßstäben gemessen, gab es damals keinen Mangel an Siedlungsraum. Im Gegenteil: Land war im Überfluss vorhanden. Allerdings existierten kaum menschenleere Regionen, wie bereits die frühesten epischen Texte vermerken, die uns mit einem Panoptikum vielfältiger Lebewesen konfrontieren (Sirenen, Amazonen, Lestrigonen, Zyklopen): Magische bis abnorme Gestalten, zuweilen durchaus gewöhnliche Menschen, welche die unzugänglichsten Zonen des Erdballs bevölkerten.
Gewiss stand das Land nicht immer als Synonym für fruchtbare Ackerböden, die Lebensgrundlage der Bewohner einer bestimmten Gegend. Ertragreiche, üppige Felder waren im griechischen Kulturkreis eher selten vorhanden, außerdem lagen sie nicht immer in unmittelbarer Nähe der heimatlich vertrauten Umgebung. Aber Möglichkeiten, die aus unterschiedlichen Gründen als unerträglich empfundene eigene Lebenssituation zugunsten neuer Siedlungsgebiete auszutauschen, gab es durchaus. Eine früh einsetzende Kolonisationsbewegung liefert dafür reichlich Belege. Die Ausweitung des Raumhorizontes ergab sich jedoch nicht allein als Ergebnis der Seefahrt. Terrestrische Expansionsschübe verzeichnen unsere antiken Texte zuhauf. Sie bildeten sogar die Regel für die Entstehung und Vergrößerung einer Ortschaft, eines Gemeinwesens. Fluren, Weideplätze und Ackerland auf Kosten der Nachbarn zu erwerben, war eine ursprüngliche Form der Herrschaftsbildung, der meist eine Zusammenlegung verstreut liegender Siedlungen zu einer größeren Einheit vorausging, woraus hervorgeht, dass Landbesitz stets die Basis der ökonomischen und sozialen Existenz eines organisierten politischen Verbands bildete. Er war Lebensraum und Quelle der Macht zugleich. Das Wasser, obwohl in der mittelmeerischen Kulturwelt stets präsent, blieb zunächst merkwürdigerweise relativ unbeachtet.2 Es wurde als Nahrungsmittelreservoir oder als Kommunikationsweg genutzt, erlangte aber erst im Zuge der Kolonisation3 und der Entfaltung der athenischen Seemacht4 einen eigenen politischen Stellenwert als tragende Säule jener maritim ausgerichteten Gemeinwesen, die als besonders dynamisch herausragten. Gelegentlich wirkte es unheimlich bis drohend: Zuverlässig die Erde, unzuverlässig das Meer soll bereits Pittakos von Mytilene (7. Jahrhundert v. Chr.), der zu den sieben Weisen des Altertums gezählt wurde, ausgerufen haben, um charakteristische Eigenschaften beider Urstoffe vergleichend zu unterstreichen.
Es existierten jedoch genügend Berührungspunkte, wo Land und Meer sich in besonderer Weise begegneten, woraus Lebensräume eigener Prägung hervorgingen: Die Inseln. Kein Wunder, dass in den ersten griechischen Schriftzeugnissen ausgerechnet ein am Ionischen Meer gelegenes Eiland eine herausragende Rolle als Ausgangs- und Endpunkt der turbulenten Irrfahrten des listenreichen Odysseus spielte, die Hauptfigur eines der großartigsten Epen der Weltliteratur. Ithaka ist bis heute als Inbegriff des Sehnsuchtsortes par excellence im kollektiven Gedächtnis der Mittelmeervölker haften geblieben, wie zahlreiche Beispiele aus Dichtung, Bildender Kunst oder Musik eindrucksvoll unterstreichen; vielleicht keines so eindringlich wie das meisterhafte Gedicht „Ithaka“ des Konstantin Kavafis und dessen einfühlsame Vertonung durch den Komponisten Lluis Llac.5 Die Beschäftigung mit dieser Insel ist von besonderem Reiz. Sie entsprang anders als viele Szenarien der homerischen Odyssee nicht der poetischen Imagination ihres Schöpfers, sondern stellt eine unleugbare Realität dar, die sich verorten, begehen und vermessen lässt. Nach den Berechnungen von Eberhard Ruschenbusch auf der Basis des bebaubaren Bodens boten die fast 100 Quadratkilometer Gesamt-fläche etwa tausend Familien Wohnraum für ein erträgliches Wirtschaftsleben, das sich der Pflege des Ackerbaus und der Viehzucht sowie der Ausbeutung der maritimen Ressourcen widmete.6 Die wichtigste Siedlung der Insel ist als fest gefügtes Gemeinwesen (polis) erkennbar. Ein Marktplatz, ein Hafen, eine Volksversammlung sind ebenso nachweisbar wie eine relativ differenzierte Wirtschaftsstruktur mit besser gestellten Familien, Handwerkern, freien Lohnarbeitern, Fischern, Bauern, Hirten und Sklaven. Auf dieser Insel begegnet uns das Ineinandergreifen von Land und Meer als tragendes Element menschlichen Zusammenlebens in besonderer Weise. Während wir dank Homer erfahren, was sich im Innern des Gemeinwesens ereignete, zeigen die überaus dramatischen Seefahrten des Odysseus, des prominentesten Inselbewohners, sehr eindringlich, welche Macht das Meer über das Schicksal der Menschen, die sich in seine Obhut begaben, erlangen konnte. Auf einige dieser Episoden werden wir noch zu sprechen kommen.7
Attika und Euböa
Doch es war vor allem das Land, das die Zielrichtung für die Befriedigung der Bedürfnisse der antiken Menschen vorgab. Wie erbittert umkämpft es zuweilen sein konnte, zeigt die sogenannte Lelantische Fehde, die sich um die Wende vom 8. zum 7. Jahrhundert v. Chr. ereignete. Sie galt, nach dem legendären Trojanischen Krieg, als die erste historisch verbürgte militärische Konfrontation auf griechischem Territorium, die um den Besitz von Grund und Boden ausgetragen wurde. Allerdings scheinen die kriegerischen Verwicklungen der archaischen Epoche mehr Adelsfehden als Konflikte zwischen verfeindeten Staaten gewesen zu sein. Davon zeugt dieser sich über Jahrzehnte hin erstreckende Streitfall, bei dem die vornehme hellenische Welt je nach Neigung, Opportunität oder wegen bestehender Gastfreundschaften Partei für Eretreia oder Chalkis, beides Städte auf der Insel Euböa, ergriff: Dem vornehmen Thessaler Kleomachos, der für Chalkis kämpfte, wurde dort ein Ehrenmal gewidmet. Für den gefallenen Amphidamas aus Chalkis veranstaltete man besondere Trauerfeierlichkeiten, die in einem literarischen Wettbewerb gipfelten, bei dem Hesiod auftrat und einen Preis davon trug.8 Auch für Eretreia sind ehrenvolle Kriegerbestattungen bezeugt, wie Ausgrabungen bestätigen, die mit diesen Nachbarschaftsgefechten in Zusammenhang stehen dürften.9
Aus dem Zusammenspiel zwischen Mensch und Landschaft wird deutlich, warum in Griechenland keine monarchische Zentralgewalt entstand: Individualität, adeliges Standesbewusstsein und Polisbezogenheit waren stärker ausgebildet als das Bedürfnis nach Einheit. Dies hat auch zu tun mit griechischen Spezifika wie Landschaftsgliederung, Wirtschaftssystem oder Meeresorientierung, nicht zuletzt aber mit dem Ausbleiben einer äußeren Bedrohung, die den Weg zum Zusammenschluss einer extrem atomisierten Welt hätte weisen können. Jenseits der aristokratischen Betrachtungsweise des Lelantischen Konfliktes, welche die Perspektive unserer Quellen bestimmt, ging es dabei vor allem um einen harten und überaus zähen Wettbewerb um Acker- und Weideland. Ein Sieg hätte einen gewaltigen Vorteil für diejenige landhungrige Machtgruppe bedeutet, die sich behauptet hätte. Damit wären ihre ökonomischen Ressourcen beträchtlich vermehrt worden, denn die gewonnenen Ländereien hätten ihre dominierende Position zweifellos gestärkt. Als hippobotai (Pferdezüchter) werden die vornehmen Herren aus Chalkis bezeichnet, womit eine Bezeichnung aufgegriffen wird, die an die wohlklingenden Epitheta der Helden der homerischen Epen erinnerte.
Die Lelantische Flur galt als eines der fruchtbarsten Gebiete der Ägäis. Wer sie kontrollierte und bebaute, sicherte sich die Zukunft des eigenen oikos und der polis. So viel wird aus der spärlichen Überlieferung klar: Der Streitfall zog sich extrem lange hin und sein Ergebnis bleibt ungewiss. Vielleicht gab es am Ende keinen klaren Sieger. Was die langandauernden Auseinandersetzungen allerdings vollbrachten, war eine unübersehbare Auszehrung der Potenziale beider rivalisierender Parteien. Denn danach scheinen weder Chalkis noch Eretreia, trotz der Vorteile ihrer geographischen Lage, eine nennenswerte politische Rolle in der Ägäis gespielt zu haben, woraus sich eine geschichtsträchtige Lehre ableiten lässt: Derartige Kriege fügen allen, die sich daran beteiligen, gewöhnlich nur Schaden zu. Am Ende gibt es nur Verlierer. Der Lelantische Krieg als Dauerkonflikt, an dem halb Griechenland teilnahm, wirkt wie ein Vorgriff auf einen ebenso langen, aber blutigeren Krieg, dem ein ähnlicher Ausgang beschieden sein sollte, und der gegen Ende des 5. Jahrhunderts v. Chr. die hellenische Welt an den Rand des Abgrunds treiben wird: Der Peloponnesische Krieg.10