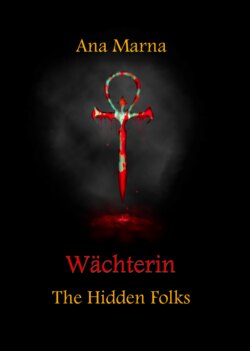Читать книгу Wächterin - Ana Marna - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Juni 2005
ОглавлениеKongo, Afrika
Die Hitze war kaum zu ertragen.
Valea wischte sich mit dem Unterarm den Schweiß von der Stirn. Ihre Hände steckten in Latexhandschuhen und betasteten sanft den Unterleib eines kleinen Mädchens. Große dunkle Kinderaugen sahen sie aus einem schokoladenbraunen Gesicht an. Sie lächelte der Kleinen beruhigend zu und wandte sich dann an den Übersetzer.
„Anang, sag der Mutter, dass ihre Tochter vermutlich eine Blinddarmentzündung hat. Sie muss operiert werden. Und zwar so schnell wie möglich. - Tad!“
Sie winkte einem der Pfleger zu und gab ihm ein Zeichen.
Dann lächelte sie die Frau an.
„Tad, wird sich um die Kleine kümmern. Sie soll sich keine Sorgen machen.“
Während Anang der besorgten Mutter alles erklärte, erhob sich Valea und streifte die Handschuhe ab. Dann griff sie in ihre Kitteltasche und holte einen einzeln verpackten Keks heraus, den sie dem Mädchen reichte. In den dunklen Augen leuchtete es auf, als die kleinen braunen Finger nach dem Keks griffen.
Valea wandte sich dem nächsten Patienten zu. Es war ein alter Mann, der ein dickes Geschwür am Bein trug. Stoisch ertrug er die Untersuchung der Ärztin und lauschte aufmerksam den Worten des Übersetzers. Doch seine Augen verfolgten jede ihrer Bewegungen.
Dr. Valea Noack verlor ihre Gelassenheit nicht. In den letzten Monaten hatte sie erlebt, dass ihre Ruhe sich schnell auf die Patienten übertrug. Nie hatte sie Schwierigkeiten. Es kam selten vor, dass die Kranken und Verletzten von sich aus laut wurden. Langmütig, beinahe apathisch warteten sie darauf, untersucht zu werden. Doch wenn sie an der Reihe waren, achteten sie sehr genau auf das, was geschah. Und sie hörten zu.
Manchmal dachte sie an die Patienten, die sie in Deutschland erlebt hatte. Was für ein Unterschied.
So geduldig und tapfer diese Menschen hier im Kongo waren, so fordernd und wehleidig verhielten sich viele der europäischen Patienten.
Die Bedingungen hier in Afrika waren gruselig. Es fehlte an beinahe allem: Medikamenten, Wasser, Nahrung und kompetenter medizinischer Betreuung. Und trotzdem hatte sie manchmal das Gefühl, mehr zu bewirken als zu Hause in Deutschland.
Wieder wischte sie sich den Schweiß von der Stirn. Es war erst früher Nachmittag und sie hatte noch einige Stunden Arbeit vor sich. Die Schlange der Wartenden war lang.
Unruhe kam auf. Vereinzelte Rufe, ein paar schrille Schreie ließen sie aufhorchen.
Eine Gruppe Menschen drängte sich durch die Warteschlange auf sie zu. In ihrer Mitte trugen sie in einer alten Decke eine schlaffe Gestalt.
Blut tropfte durch das Tuch hindurch und hinterließ eine dünne Spur im Sand.
Alle machten der Gruppe Platz, drängten zur Seite. Vor ihr blieben die Neuankömmlinge stehen und redeten auf sie ein. Valea registrierte nur am Rande, dass es sechs Leute waren, die vor ihr standen. Ihr Blick galt dem Mann, der jetzt vor ihr abgelegt wurde.
Er lebte noch. Seine Augen waren offen, aber glasig vor Schmerz.
Valea holte tief Luft, als sie die Verletzungen sah. Der Hals war aufgerissen, die Luftröhre und die Speiseröhre lagen frei, schienen aber noch intakt zu sein. Von einem der Oberarme war das Fleisch gerissen worden und ein langer Riss zog sich von seiner Brust quer nach unten bis tief in den Bauch.
Valea ignorierte das Geschrei um sie herum. Hier war schnelle Hilfe angesagt. Wenn sie nicht schon zu spät kam. Im Bauch hatte sich eine riesige Blutlache angesammelt und die Gedärme waren offenbar nur grob in die Bauchhöhle zurückgeschoben worden.
Laut, aber mit ruhiger Stimme rief sie nach Hilfe und wandte sich an Anang.
„Was erzählen sie?“
Der Übersetzer sah leichenblass aus.
„Also, ich glaube, das wird Ihnen nicht gefallen. Sie sagen, dass ein Anioto ihn angegriffen habe. Als Leute dazu kamen, ist er geflohen.“
„Ein Anioto? Wer ist das?“, fragte Valea, während sie half den Verletzten auf eine Trage zu heben.
„Äh, also eine Art Fabelwesen“, murmelte Anang, und vermied es, ihr in die Augen zu sehen.
„Ach du je“, meinte Valea. „Und wie soll dieses Wesen aussehen?“
„Nun, sie sehen eigentlich aus wie Menschen, aber sie können sich angeblich in Leoparden verwandeln.“
„Also war es doch ein Tier?“
„Die Leute behaupten, dass es ein Mann war, der zum Tier wurde. Als er gestört wurde, lief er als Leopard weg.‘
,Also ein Leopard‘, dachte Valea und bemühte sich, mit der Trage Schritt zu halten, während sie dem Verletzten eine Blutdruckmanschette umlegte.
Endlich hatten sie das OP-Zelt erreicht, und in den nächsten Stunden versuchten sie, ein weiteres Leben zu retten.
Es war schon später Abend, als Valea das Zelt verließ.
Sie hatten den Kampf verloren. Der Mann war ihnen schlichtweg unter den Händen verblutet. In Europa hätte man ihm vielleicht mit modernerer Technik helfen können, doch hier, mitten im Kongo, war er chancenlos gewesen.
Seufzend steuerte sie auf ihr eigenes kleines Zelt zu, das sich nahebei befand. Heute würde sie ausnahmsweise einmal früh schlafen gehen. Morgen stand eine Fahrt ins Hinterland an, wo es einige abgelegene Dörfer gab, die viel zu weit von ihrer Basis lagen, als dass die Kranken hierherkommen konnten. Die Fahrt würde anstrengend werden, das wusste sie aus Erfahrung. Jede Stunde Schlaf war daher wertvoll.
Vier Tage später schreckte Dr. Valea Noack aus dem Schlaf hoch. Blinzelnd versuchte sie, sich zu orientieren.
Sie lag in ihrem Zelt und es war noch dämmrig. Also musste es sehr früh morgens sein. Sie erinnerte sich.
Gestern Abend waren sie in diesem kleinen Dorf angekommen und hatten dem Dorfältesten erklärt, wer sie waren und was sie wollten. Hier, mitten im Busch, hatte noch niemand von „Ärzte ohne Grenzen“ gehört. Doch nach etlichen Erklärungen hatte der alte Mann begriffen und eifrig genickt. Ja, sie hatten einige Kranke hier, und er wollte allen sagen, dass sie hier Hilfe finden konnten.
Valea lauschte auf die Geräusche, die von draußen in ihr Zelt drangen. Offenbar wurden immer mehr Leute wach und laute Rufe gelangten verstärkt an ihr Ohr.
Irgendetwas war passiert.
Hastig griff sie nach ihren Schuhen und schüttelte sie aus, bevor sie hineinschlüpfte. Dann kroch sie nach draußen und folgte den Stimmen.
Auf dem Dorfplatz hatte sich anscheinend das ganze Dorf versammelt. Jung und Alt. Als Valea näherkam, machten ihr die Leute respektvoll Platz, so dass sie ungehindert bis zum Ausgangspunkt der Unruhe kam.
Auf dem Boden kniete eine alte Frau, die schrille Rufe von sich gab und sich vor und zurück wiegte. Vor ihr lag eine verrenkte Gestalt am Boden. Hinter sich hörte sie Anangs Stimme.
„Dr. Noack, was ist hier los? - Oh Herr im Himmel. Heilige Jungfrau Maria!“
Das galt der Gestalt vor ihnen auf dem Boden.
Valea starrte fassungslos auf die Frau, oder besser das, was von ihr übrig geblieben war. Der aufgerissene Hals bestand nur noch aus Knochen und Sehnensträngen, genauso wie weite Teile der Arme und Beine. Und der Oberkörper ...
Unwillkürlich dachte sie an den Schwerverletzten vor einigen Tagen. Er hatte die gleichen Verletzungen am Torso aufgewiesen, nur dass die Frau, die vor ihr lag, regelrecht ausgeweidet worden war.
Anang entfernte sich hastig. Nur am Rand registrierte Valea seine Würgegeräusche, als er sich in einen der Büsche übergab.
Sie hockte sich neben die wehklagende Frau und legte sachte eine Hand auf den dürren Rücken. Die Trauernde schien es erst nicht zu bemerken, doch nach und nach wurde ihr Wiegen langsamer.
Valea wandte die Augen nicht von der Toten. Konzentriert ließ sie ihren Blick über die Wunden gleiten und versuchte zu erkennen, was dieser armen Frau geschehen war.
„Anioto, Anioto“, flüsterte die Frau neben ihr und krallte ihre Hand in Valeas Bein.
„Dr. Noack!“
Anang tauchte wieder auf. Er wirkte leicht grün im Gesicht, was bei seiner dunklen Hautfarbe bemerkenswert aussah. Doch jeder Humor war hier fehl am Platz. Hinter ihm drängten sich zwei weitere Mitglieder ihres Teams: Bob Sutter und Linda Sterling.
„Oh mein Gott“, flüsterte Linda und schlug die Hand vor den Mund. Sie war Krankenschwester von Beruf und hatte sicherlich schon viele grauenhafte Dinge gesehen. Aber dieser Anblick konnte selbst dem Abgebrühtesten unter ihnen zusetzen, da war sich Valea sicher. Auch Bob holte tief Luft und trat unwillkürlich wieder einen Schritt nach hinten.
Valea erhob sich langsam.
„Anang, kannst du fragen, was hier passiert ist?“
Anang wandte sich sofort an die nächsten Dorfbewohner, die sogleich auf ihn einredeten.
Schließlich erklärte er: „Sie haben die Frau nicht weit von hier gefunden. Sie ging, um ihre Morgentoilette zu verrichten, und kam nicht wieder. Sie haben sie hierhergetragen, damit ihre Mutter sich von ihr verabschieden kann.“
„Das muss ein großes Raubtier gewesen sein“, murmelte Bob.
„Anioto, Anioto“, flüsterte die Trauernde wieder und sah zu Valea empor.
Anang verzog das Gesicht.
„Hören Sie nicht auf die Frau. Hier im Busch glauben sie noch an Geister und Dämonen.“
„Die Wunden gleichen denen des Mannes vor vier Tagen“, sagte Valea nachdenklich. „Es muss die gleiche Vorgehensweise gewesen sein. Was für ein Raubtier tut so etwas?“
Anang zuckte die Schultern.
„Vermutlich ein Löwe, oder vielleicht ein Leopard.“
„Hm.“ Valea war nicht überzeugt. Sie meinte gelesen zu haben, dass zumindest Leoparden ihre Opfer eher von hinten angriffen. Und sie ließen ihre Beute nicht einfach so herumliegen, sondern versteckten sie auf Bäumen. Aber sicher konnte sie sich natürlich nicht sein. Bisher hatte sie sich noch nie mit so etwas beschäftigt. Ihre Aufgabe war bislang das Heilen gewesen, nicht die Forensik.
Doch je länger sie das Opfer betrachtete, desto seltsamer kam ihr alles vor. Wer oder was auch immer diese Frau umgebracht hatte, war systematisch vorgegangen. Das Gesicht war völlig unversehrt, ebenso die Hände und Füße. Genau wie bei dem Mann von vor zwei Tagen. Dass eine Raubkatze so vorging, kam ihr eher unwahrscheinlich vor. Aber die Fraßspuren waren offensichtlich.
Langsam entfernte sie sich von der Leiche, um sie der trauernden Mutter zu überlassen. Hier konnte sie nicht mehr helfen.
Drei Wochen lang zogen sie von Dorf zu Dorf und halfen, wo es notwendig und möglich war. Nicht immer wurden sie mit offenen Armen empfangen, doch geduldiges Erklären und Abwarten brachten meistens jedes Misstrauen zum Erliegen.
Als sie ins Basiscamp zurückkehrten, waren jegliche Medikamente und Nahrungsvorräte aufgebraucht. Ebenso all ihre Kräfte.
Dr. Valea Noack war für gewöhnlich kein Mensch, der Urlaubstage in Anspruch nahm, doch auch ihr war klar, dass sie zumindest ein paar Tage benötigte, um wieder zu Kräften zu kommen. Dafür war aber Abstand zum Camp nötig. Aus Erfahrung wusste sie, dass sie sonst doch wieder einspringen würde, wenn es nötig war.
Und eigentlich war es das immer.