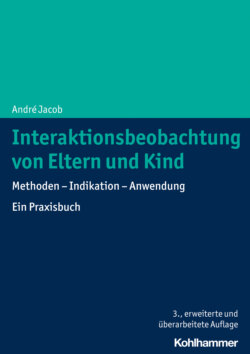Читать книгу Interaktionsbeobachtung von Eltern und Kind - André Jacob - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.4 Schlussfolgerungen für die Beurteilung von Instrumenten zur Beobachtung der Eltern-Kind-Interaktion
ОглавлениеEs bleibt zunächst festzuhalten, dass interaktionsdiagnostische Instrumente
• erkennen lassen sollten, welchem theoretischen Konzept von »Beziehung« bzw. »Interaktion« sie folgen und welche abgeleiteten Kategorien, Dimensionen oder Bereiche insbesondere in Bezug zu deren funktionaler Bedeutung sich aus diesem Konzept ergeben;
• unterscheiden sollten zwischen beobachtetem Verhalten und Schlussprozessen auf Interaktionsmuster sowie Repräsentationen, Einstellungen und Motive;
• die Verknüpfungsregeln zur (Interaktions-)Musterbildung und zum Folgern auf interne Konzepte explizieren sollten;
• die Herstellung von Passung nach Erfahrungen nicht gelingender Abstimmung oder aber deren Aufrechterhaltung erfassen sollten, um damit dem dynamischen Moment von Beziehungen gerecht zu werden;
• möglichst in allen vier, mindestens jedoch in den drei Perspektiven »Kind«, »Elternteil«, »Eltern-Kind-Beziehung«, Bewertungen ermöglichen und schließlich
• hinsichtlich der formalen Differenzierung in den Indikatoren und Kategorien stimmig sein sollten.
Zum Abschluss dieses Kapitels soll auf ein bisher noch nicht diskutiertes Problem aufmerksam gemacht werden.
Interpersonale Dimension von Störungen
Bei einer systematischen Durchsicht von Störungsdefinitionen im Kindes- und Jugendalter fällt auf, dass sich erstaunlich wenige Kriterien auf die interpersonale Dimension der Störung beziehen. In Kap. 7.3.3. wird dies anhand von drei ausgewählten Beispielen belegt. Mit Ausnahme der Störungen des autistischen Spektrums, für die als einzige dysfunktionales Kommunikationsverhalten als Kardinalsymptom definiert wird, weist keine andere Störung eine systematische Betrachtung interpersonaler Aspekte auf. Diese Feststellung ist umso erstaunlicher, da doch der interpersonalen Frage bei vielen Störungsbildern hinsichtlich ihrer pathogenen Bedeutung und in Bezug auf die therapeutische Intervention eine zentrale Rolle eingeräumt wird. Weshalb dann darauf verzichtet wird, die sich aus der interpersonalen Relevanz ergebenden Implikationen erstens zur Beschreibung von diagnostischen Kriterien und zweitens zu deren Operationalisierung für den diagnostischen Prozess zu verwenden, lässt sich logisch nicht erklären. Stattdessen wird auf wissenschaftlich viel weichere Indikatoren wie das subjektive Erleben der Diagnostikerin/des Diagnostikers oder der Therapeutin/des Therapeuten (z. B. bei der Analyse von Übertragungs- und Gegenübertragungsprozessen) verwiesen.
Es bleibt zu hoffen, dass künftige Störungs- und Interventionsklassifikationen die interpersonale und damit auch interaktionelle Dimension in das Untersuchungsgeschehen systematisch und theoretisch begründet einbeziehen, was bei den so überarbeiteten Verfahren dann eine wesentlich verbesserte ökologische Validität, eine höhere Reliabilität sowie nicht zuletzt eine fachlich fundiertere und personalisiertere Indikationsempfehlung zur Folge hätte.
4 Die Plausibilität wurde jedoch bisher so gut wie nie beforscht. Eine interessante Ausnahme stellt die Untersuchung von Jörg et al., 1994 zur Blickvermeidung des Säuglings und dessen entwicklungspsychologische Relevanz dar.
5 Der Begriff der »Kategorien«, wird verwendet, um die inhaltliche Abgrenzung eines Aspektes oder Themas zu betonen, wohl wissend, dass dies bei vielen Aspekten oder Themen auch »dimensional« dargestellt werden kann. Später werden diese Begriffe durch den der »Facette« ersetzt.