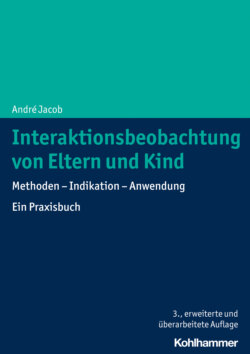Читать книгу Interaktionsbeobachtung von Eltern und Kind - André Jacob - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEinleitung
Im Juni 1999 erlebte ich am Kinderzentrum in München mein erstes und – wie sich leider bald zeigen sollte – auch eines der letzten noch vom Ehepaar Hanouš und Mechthild Papoušek1 gemeinsam veranstalteten Grundlagenseminare zu Regulationsproblemen der frühen Kindheit. Es eröffnete mir eine Welt in das Verstehen kindlicher Entwicklungsprozesse und ihrer Verwobenheit in Eltern-Kind-Interaktionen, wie dies bis dahin für mich kaum vorstellbar gewesen war. Einen besonderen Reiz übten die Untersuchungen zur »intuitiven Elternschaft« aus, bei der sich das Forscherpaar Papoušek nicht nur einer ausgefeilten Untersuchungsmethodik, sondern auch der damals neuesten technischen Möglichkeiten zur videografischen Aufzeichnung bediente. »Je jünger das Kind, um so unmittelbarer drückt es sich in seinem gesamten Verhalten aus, umso deutlicher erschließt das beobachtbare Verhalten den Zugang zur körperlichen, psychischen und sozialen Entwicklung und ihren Störungen« schrieben die Papoušeks bereits im Jahr 1981 (Papoušek & Papoušek, 1981, S. 20). Sie wiesen »außerdem darauf hin, dass der Einsatz von Film- und Videotechnik eine Ausdehnung des Gegenstandsbereichs bedeute. Sie ermöglicht auch eine Art mikroskopischer Betrachtung, eine Ausweitung der physiologischen Grenzen der Sinnesorgane bis in den Bereich des Unsichtbaren und Unhörbaren sowie eine hohe zeitliche Auflösung, die auch flüchtige, unwillkürliche Verhaltensweisen und feinste Interaktionsstrukturen verläßlich erfaßbar macht« (ebd.). Daraus ergäben sich entscheidende methodische Vorteile. Eine gute Aufzeichnung »ermöglicht dieselbe Szene einmal einfühlend, u. U. in wechselnden Rollen, mitzuerleben, einmal aus objektiver Distanz2 einzelne Elemente des Verhaltens auszuwerten, oder von mehreren Beobachtern unabhängig auswerten zu lassen. Was sich auf verschiedenen Ebenen oder bei mehreren Partnern parallel abspielt, kann nach und nach oder im zeitlichen Zusammenspiel bis ins Detail beschrieben werden. Und es ist möglich, zur selben Szene mit neuen Erkenntnissen und Fragestellungen zurückzukehren« (Papoušek & Papoušek, 1981, S. 21. zit. nach Thiel, 2011, S. 808).
Mir wurde allmählich klar, wie tiefgreifend diese Sicht- und Arbeitsweise die Untersuchung der frühkindlichen Entwicklung und ihrer Sozialisationsinstanzen beeinflussen dürfte und welche Konsequenzen dies für die Diagnostik und Beratung von Familien mit Säuglingen und Kleinkindern haben würde. Was ich im Jahr 1999 noch nicht ahnte, war, welch große Herausforderung an die eigene Fähigkeit zur Objektivierung, zur Systematisierung und zur theoretischen Reflexion ein solches Arbeiten mit sich bringt und wie sich immer wieder neue Fragen beim Lösen eines Problems in diesem Feld auftun. Um der eigenen inneren – nicht selten kaum auflösbar scheinenden – Verwirrung zu entgehen, entstand dieses Buch: Es zielt auf mehr Systematik und Vollständigkeit als bisherige Literatur; es ist jedoch vor allem dazu gedacht, diagnostisch Praktizierenden3 bei der Auswahl von Methoden und Instrumenten behilflich zu sein, indem von Kolleginnen und Kollegen als auch von mir selbst stammende Erfahrungen und Überlegungen als Praxisempfehlungen formuliert werden.
Das Praxisbuch beschränkt sich auf die Vorstellung und Analyse von verhaltensbeobachtenden interaktionsdiagnostischen Verfahren und schließt Verfahren und Methoden – nicht zuletzt auch wegen der kritischen Ausprägungen in den Gütekriterien (vgl. Gloger-Tippelt & Reichle, 2007, S. 404) – aus, die darüber hinausgehen, also beispielweise Fragebögen, Interviews oder szenisch-projektive Verfahren, die ebenfalls der Gruppe der interaktionsdiagnostischen Methoden zuzuordnen sind.
Zum Umgang mit dem Buch
Je nach Interesse der Lesenden kann das Buch auf unterschiedliche Weise rezipiert werden:
• Wer sich für theoretische und methodische Hintergründe interessiert, sollte den ersten Teil in die Lektüre miteinbeziehen.
• Wer sich zunächst nur einen Überblick über gängige Verfahren verschaffen möchte, sollte sich vor allem mit dem zweiten Teil beschäftigen.
• Wer Empfehlungen zur generellen Anwendung oder zu spezifischen Themen und Fragestellungen erhalten möchte, kann den Schwerpunkt auf den dritten Teil legen.
• Im Anhang finden sich einige Instrumente, die aufgrund ihrer Publikation oder durch freundliche Genehmigung der Autorinnen und Autoren für eine sofortige Nutzung zur Verfügung stehen.
Das Zustandekommen dieses Buches wäre nicht ohne die Hilfe einiger Menschen denkbar, denen ich an dieser Stelle ganz besonders danken möchte: Ursula Geißler, Anne Huber und Brit Bonin für ihre wertschätzend-kritische und anreichernde Durchsicht des Manuskriptes, George Downing für seine Ermutigung und seine hilfreichen Kommentierungen, Heike Morche und Brit Bonin für ihre jeweiligen Beiträge in diesem Buch und für ihre Hilfe beim Sichten der vielen Materialien sowie Peter Bertz und Sophia Kugler, die mich ebenfalls beim Recherchieren umfassend unterstützt haben.
Nicht zuletzt gilt auch dem Kohlhammer Verlag mein Dank für die wohlwollende und zugleich aufmerksam-kundige Bearbeitung des Manuskriptes sowie für die Möglichkeit, nun auch die dritte, aktualisierte Auflage dieses Buches fertigstellen zu können.
1 Hanouš Papoušek verstarb leider schon ein Jahr darauf (1922–2000).
2 Anstelle des Begriffs der »Objektivität« sollte eher der Begriff der »Beurteilerunabhängigkeit« stehen, um eine Verwechslung mit dem erkenntnistheoretischen Terminus der »objektiven Wahrheit« zu vermeiden.
3 Es werden, wenn möglich, gendergerechte Begriffe oder die Doppelschreibweise verwendet. Geschlechtsspezifische Formulierungen in Quellen oder Fachbegriffe werden in ihrer Form belassen.