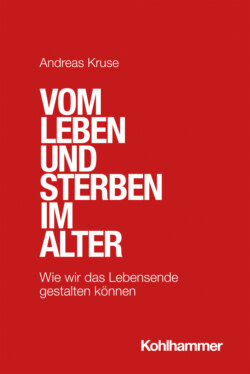Читать книгу Vom Leben und Sterben im Alter - Andreas Kruse - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Lebensgeschichte in erzählten Geschichten
ОглавлениеEine weitere bedeutsame Ergänzung der Aussagen Robert Butlers zum »Lebensrückblick« bildet in meinen Augen das »story-Konzept«, das der Schweizer Theologe und Philosoph Dietrich Ritschl (1929–2018) in die Theologie, in die Medizinische Ethik und in die Psychotherapie eingeführt hat (Ritschl, 2004; Ritschl & Jones, 1976). Dietrich Ritschl begreift das Individuum von den einzelnen Geschichten (stories) her, die dieses erzählt. In der Gesamtheit aller Geschichten drückt sich schließlich die Geschichte des Individuums, drückt sich die Gesamtsicht seines Lebens aus (Metastory). Anders formuliert: Das Individuum erzählt seine Geschichte, indem es Geschichten erzählt. Diese Geschichten geben Auskunft über verschiedene Aspekte seines Lebens und über die Bedeutung, die es diesen Aspekten zuweist. In den erzählten Geschichten gibt sich das Individuum anderen Menschen gegenüber zu erkennen – und dies auf höchst anschauliche Art und Weise. »Anstatt meine Frau oder meinen Freund zu definieren oder das Wesen der Ehe darzulegen, erzähle ich die story, die wir gemeinsam haben und die zum Teil das ausmacht, was wir sind.« (Ritschl & Jones, 1976, S. 15) »Durch das Erzählen meiner Gesamtstory und der einzelnen stories gebe ich anderen Teil an meinem Leben, durch das Nicht-Erzählen bewahre ich meine Privatheit oder achte die Privatheit anderer.« (Ebd.) – In dem Erzählen von Geschichten gestaltet die Erzählerin bzw. der Erzähler Wirklichkeit. Geschichten beschreiben also nicht nur Wirklichkeit; sie stellen auch Wirklichkeit her (Schwartz, 2009). Die Vielfalt der miteinander verknüpften Geschichten macht dabei das Gesamt der Wirklichkeit aus.
Dabei sind die einzelnen Geschichten schon für sich genommen bedeutungshaltig, verweisen schon für sich genommen auf Aspekte des Lebens, die das Individuum als bedeutsam erachtet. Im Prozess des Erzählens entfalten die einzelnen Geschichten aber auch in der Hinsicht Wirkung, dass sie Aspekte der Identität konstituieren, in ihrer Gesamtheit die Identität, wobei die Identität grundsätzlich Veränderungen unterliegt, die sich wiederum in den erzählten Einzelgeschichten (stories) wie auch in der Gesamtgeschichte (Metastory) niederschlagen.
Die erzählten Geschichten sind als Rekonstruktion dessen zu begreifen, was gewesen ist. Sie beschreiben somit eine stilisierte Vergangenheit und treffen mit dem zusammen, was das Individuum erwartet, was das Individuum in Zukunftsstories berichtet (Ebd.). Aus Vergangenheits- und Zukunftsstories bildet sich schließlich die Gesamtstory oder die Gesamtvision des Lebens. Allerdings darf nicht übersehen werden: Diese Gesamtstory, diese Gesamtvision kann nicht wirklich erzählt werden; sie kann im Kern nur aus den Vergangenheits- und Zukunftsstories erschlossen werden.
Wir fügen einzelne Geschichten zusammen, wir nehmen in dieser Zusammenfügung bestimmte Akzentuierungen und Präzisierungen vor. Die Zusammenfügung einzelner stories kann und soll uns dazu dienen, etwas auf den Punkt zu bringen, eine zentrale Botschaft über uns zu vermitteln. Die Zusammenfügung und Akzentuierung bedeuten aber immer auch Aufgabe, Verlust von Details. Dies ist eine ganz natürliche Folge und auch nicht weiter zu beklagen. Problematisch wird dieser Prozess dann, wenn die Vielfalt der Einzelstories (und damit der Aspekte der Identität) verlorengeht, wenn das Individuum diese Vielzahl so stark reduziert, dass sich das Leben in den erinnerten und berichteten stories nur noch sehr unvollständig ausdrückt, in seiner Vielfalt nicht mehr zum Ausdruck kommt. In diesem Fall besteht die Gefahr der seelischen Verkümmerung und schließlich der psychischen Störung.
Eine bedeutende Aufgabe der psychotherapeutischen Behandlung ist darin zu sehen, die Offenheit des Menschen für die vielfältigen Einzelstories zu fördern und auf diesem Wege zu einer deutlich lebendigeren, reichhaltigeren Gesamtschau des eigenen Lebens zu gelangen. Da Geschichten ja nicht nur im Sinne von (stilisierten) Beschreibungen der Vergangenheit zu deuten sind, sondern auch im Sinne von Erwartungen und Hoffnungen (Ritschl, 2004), besitzt die psychotherapeutische Intervention auch das Potenzial, über die Förderung von Offenheit für die Vielfalt persönlicher Geschichten auch die lebendige, differenzierte Antizipation der persönlichen Zukunft zu fördern – mit allen positiven Folgen für die Nutzung der Entwicklungsmöglichkeiten, die die Zukunft bietet, wie auch für die Auseinandersetzung mit Grenzen, die in der Zukunft (allmählich) sichtbar werden. Vor allem aber kann die Wiedergewinnung einer lebendigen, reichhaltigen Identität dazu beitragen, dass das Individuum zu einer Neubewertung seines Lebens gelangt und damit die Grundlage für den reiferen Umgang mit der eigenen Endlichkeit schafft.