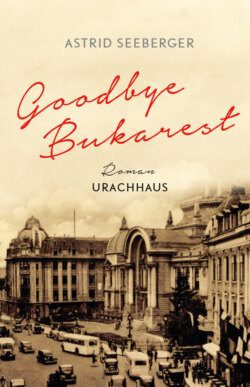Читать книгу Goodbye, Bukarest - Astrid Seeberger - Страница 19
Dmitri Fjodorows
alias Hannes Grünhoffs Geschichte Teil 1
ОглавлениеAlles begann 1928 mit dem Sechsten Weltkongress der Kommunistischen Internationale, der, wie Grünhoff sagte, die reinste Katastrophe war. Denn dort kam man zu dem Entschluss, die Sozialdemokraten als Handlanger des Kapitals zu betrachten, die somit als Feinde bekämpft werden mussten. Hätte man mit ihnen zusammengearbeitet, hätte man Hitler vielleicht stoppen können. Nun aber schaufelte man sich sein eigenes Grab, die deutschen Kommunisten jedenfalls. Und auch Grünhoffs Mutter.
Das aber hatte sie damals nicht verstanden. Während der Weltkongress stattfand, war er das Wunderbarste, was in ihrem Leben je geschehen war. Denn auf ihm gab es einen russischen Delegierten: einen jungen Lehrer, der, obwohl er Kommunist war, einem Prinzen aus Tausendundeiner Nacht glich. Er brannte für die Befreiung des Volkes vom kapitalistischen Joch und bald auch für Grünhoffs Mutter, die als junge Journalistin über den Kongress berichtete. Auch seine Mutter begann zu brennen. Es endete damit, dass sie als freie Korrespondentin zu ihrem Liebsten nach Moskau zog.
Es spielte keine Rolle, dass sie arm waren und beengt wohnten. Und dass ihr Paradies oft nach Schtschi, der russischen Kohlsuppe, roch. Sie waren glücklich und überzeugt, an der Schaffung einer besseren Welt mitzuwirken. Später sollte seine Mutter sagen: Das einzige Schöne, was sie zu schaffen vermocht hatten, sei er, Dmitri Hannes Michaijlowitsch Fjodorow, gewesen, ihr einziges Kind, das 1932, am ersten Tag des letzten glücklichen Jahres, geboren wurde.
Im Jahr danach änderte sich alles. Hitler wurde Reichskanzler. Und schon bald bestand keine Möglichkeit mehr, als links eingestellte deutsche Korrespondentin tätig zu sein. Die deutschen Zeitungen wurden gleichgeschaltet und nazifremde Komponenten – wie die Artikel der Mutter – eliminiert. Und auch in Moskau geschahen Dinge. Man sagte nicht mehr alles, was man dachte. Die es dennoch taten, wurden von der Geheimpolizei abgeholt und nie wiedergesehen. Manchmal wurde man auch abgeholt, obwohl man nichts Unerlaubtes gesagt hatte. Alle wussten, dass es zwei Bezeichnungen gab für jemanden, der flüsterte: Scheptschuschi für den, der flüstert, um nicht gehört zu werden, und Scheptun für den, der hinter deinem Rücken den Behörden ins Ohr flüstert. Und ein neuer Geruch breitete sich aus, Angstgeruch, nach dem Geruch des Todes der schlimmste von allen.
Genauso hatte seine Kindheit gerochen, sagte Grünhoff: nach Angst und Kohlsuppe. Und nach Seife und Bohnerwachs. Manchmal gingen er und seine Mutter an die Moskwa, um all den Gerüchen zu entkommen. Sie saßen am Wasser, und die Mutter erzählte von den Flüssen und Seen in Berlin: der Spree und der Havel und vom Wannsee, wo sie in einem großen weißen Haus aufgewachsen war. Wenn sie erzählte, konnte man auf die Idee kommen, dass sie sich nach einer anderen Zeit sehnte, einer Zeit, die es nicht mehr gab, nicht einmal in Berlin. Eine Zeit mit dem Duft nach Freiheit. Er meinte ihn zuweilen zu spüren. Wenn eins der kleinen Holzschiffe, die er gebaut hatte, auf der Moskwa davonfuhr. Es spielte keine Rolle, dass der Vater ihm den Weg des Holzschiffs im Atlas zeigte: dass es über die Oka und Wolga im Kaspischen Meer landete, was nicht wirklich ein Meer war, sondern ein von Land umschlossener See.
Wenn die Mutter und er allein waren, sprachen sie Deutsch. Und sie nannte ihn ihren Hannes, so wie ihr Großvater geheißen hatte. Waren der Vater und andere Menschen dabei, sprachen sie Russisch. Er hatte eine Mutter- und eine Vatersprache. Eine Sprache, in der er sich fortträumen konnte, und eine für die Wirklichkeit.
Doch er musste seiner Mutter versprechen, nie mit jemand anderem Deutsch zu sprechen. Er durfte auch nicht erzählen, dass seine Mutter aus Deutschland kam. Sie war eine passionierte Sowjetbürgerin, und damit basta. Es war ein Glück, dass sie einen Vornamen – Anna – hatte, der auch in der Sowjetunion gebräuchlich war. Und dass sie akzentfrei Russisch sprach. Obendrein stand sie mit ihrer Familie in Berlin nicht mehr im Briefwechsel. Vielleicht hatte sie gehört, dass das Volkskommissariat für Innere Angelegenheiten eine »Deutsche Operation« durchführte: Sowjetbürger deutscher Herkunft und deutsche Emigranten galten systematisch als Terroristen und als Spione und wurden verhaftet. Doch Mutter nicht. Hatte der Vater Beziehungen? Oder war die Quote der zu Verhaftenden erfüllt?
Sein Vater war oft wie abwesend. Er schaffte es kaum, von der Schule heimzukommen und seine Kohlsuppe zu löffeln, da war es schon wieder an der Zeit, sich der Parteiarbeit zuzuwenden. Es ist die Pflicht des Menschen, sagte er zu seinem Sohn, alles nur Mögliche für sein Land zu tun. Und dann strich er Dmitri mit seiner weichen Hand sanft übers Haar, ein wenig zerstreut, aber dennoch.
Und der Einsatz des Vaters lohnte sich. Im Jahr vor dem Zweiten Weltkrieg wurde er zum Direktor einer der besten Moskauer Schulen ernannt. Sie bekamen eine Dienstwohnung mit einem großen Stalin-Gemälde im Wohnzimmer. Stalin stand hoch aufgerichtet vor der roten Sowjetfahne mit Hammer und Sichel und blickte schräg nach rechts, mit leicht zusammengekniffenen Augen, als sei er misstrauisch. Man konnte meinen, es sei das Beste, auf der linken Seite zu stehen. Freitags wurde Stalin abgestaubt, wie alles andere in der Wohnung. Manchmal sah es aus, als ob die Mutter mit dem Staubwedel nach ihm schlug, während sie einen alten Schlager trällerte, zu dem sie in Berlin getanzt hatte.
Oder sie summte Jazzsongs, die das Jazzorchester Alexander Warlamows im Zentralen Haus der Roten Armee spielte oder Moskaus erste Frauenjazzband im Zentralen Klub der Holzveredlungsindustrie. Dorthin gingen die Eltern, wenn sie eine Pause vom Klassenkampf brauchten. Oder sie gingen ins Theater, während ein kaukasisches Mädchen auf Dmitri aufpasste. Sie habe am Asowschen Meer gewohnt, erzählte sie mit einem Blick, als sehnte sie sich dorthin, obgleich auch das kein richtiges Meer war, sondern nur ein großer See.
Er war neun Jahre alt, als Hitler am 22. Juni 1941 den Nichtangriffspakt mit der Sowjetunion brach und die deutschen Heereskräfte ins Land eindrangen. Der Vater zögerte keinen Augenblick, um sich als Soldat zu melden und im Großen Vaterländischen Krieg zu kämpfen, wie Stalin das Schlachten nannte. Die Mutter sagte, sie sei stolz auf ihn. Trotzdem aber weinte sie. Wie einmal, als Dmitri in die Küche kam und sie wie eine Besessene die Kartoffeln schrubbte, um ihre Tränen zu verbergen. Vielleicht dachte sie nicht nur an den Vater, sondern auch an ihre Eltern und ihren Bruder in Berlin. Er getraute sich nicht zu fragen, der Angstgeruch war zu stark.
In einer der ersten Kriegswochen bekamen sie einen Brief von der Front. Er erinnerte sich nicht, was der Vater geschrieben hatte, nur an das beigefügte Foto. Darauf stand er hoch aufgerichtet vor seinem Panzer, den Blick geradeaus gerichtet, so als fürchte er nichts. Dennoch glich er vor allem einem Prinzen aus Tausendundeiner Nacht, der sich als Soldat verkleidet hatte. Das Foto kam auf dem Beistelltisch zu stehen, im Goldrahmen, direkt gegenüber dem Stalin-Bild. Manchmal nahm die Mutter das Foto in die Hand und betrachtete es. Da konnte es vorkommen, dass ihre Augen blank wurden, so als bräche sie gleich in Tränen aus. Insbesondere, wenn die Zeitungen von einer erneuten Niederlage der Roten Armee berichteten.
Der Krieg war erst einen Monat alt, als die deutsche Luftwaffe mit ihren Bombenangriffen auf Moskau begann. Die Moskauer rannten zu den Schutzkellern, wenn das Geheul der Warnsignale über der Stadt erklang. Er und die Mutter liefen zur Station Majakowskaja, einer von Moskaus neuen Metro-Stationen, die dreißig Meter unter der Erde lag. Es war, als betrete man eine andere Welt. All die glänzenden Säulen, die schimmernden Marmorböden, die goldenen Lampen! Als käme man in die Säulenhalle eines kaiserlichen Palastes. Die eines gastfreundlichen Kaisers, der seinen Gästen Schlafpritschen mit weichen Decken und weichen Kissen bot. Und Dmitri lag ausgestreckt da und blickte zu den Deckengemälden hoch, während ihm die Mutter Märchen aus einer anderen Zeit erzählte. Märchen auf Russisch, in denen die Guten stets siegten. So wie es auch jetzt geschehen würde.
Auch seine Mutter leistete ihren Beitrag zum Großen Vaterländischen Krieg. Sie half mit beim Bau von Panzergräben und schleppte Sandsäcke, die man vor den Schaufenstern der Läden stapelte. Und sie zeigte ihm, wenn sie durch die Stadt gingen, wie listig die Moskauer waren, genau wie Odysseus, der den Trojanern ein Schnippchen geschlagen hatte, indem er das griechische Heer in einem gigantischen Holzpferd versteckte. Die Moskauer strichen die goldenen Kuppeln der Kirchen graugrün und verbargen Teile der Moskwa unter mächtigen Holzabdeckungen, um die deutsche Luftwaffe zu täuschen. Während Dmitri Holzflugzeuge baute, eine ganze Armada, die Hitlers Wehrmacht vernichten sollten.
Die Deutschen aber rückten mit rasender Geschwindigkeit weiter voran. Bis sie Smolensk erreichten, das nur vierhundert Kilometer von Moskau entfernt lag. Erst nach wochenlangem Kampf gelang es Hitlers Streitkräften, die Stadt zu erobern, ein Kampf, bei dem zahllose Soldaten starben, nicht aber Dmitris Vater. Er überlebte und wurde für seinen Mut sogar mit einer Medaille geehrt. Er zeigte sie Dmitri, als er auf einen kurzen Fronturlaub heimkam. Es war nur merkwürdig, dass er kein bisschen stolz darauf zu sein schien.
Am nächsten Tag aber – dem 7. November 1941, dem Jahrestag der Oktoberrevolution – hatte er die Medaille angelegt, als er mit seinem Panzer in der großen Militärparade mitfuhr, auf deren Durchführung Stalin bestanden hatte, obwohl der Krieg nicht weit vor Moskau tobte. Die Welt sollte sehen, wie ungeheuer stark die Sowjetunion war. Sie sollte verstehen, dass das, was Stalin vom Dach des Lenin-Mausoleums rief, die Wahrheit war: dass die Reserven der Sowjetunion unendlich waren, während die Hitlerdeutschlands bereits dem Ende zu gingen.
Ein eiskalter Wind kam auf. Schneeflocken wirbelten durch die Luft. Moskau war von Schnee bedeckt, auch die marschierenden Soldaten und die vorbeirollenden Panzer. Dmitri und seine Mutter standen unter den Zuschauern. War das da nicht der Vater, der mit seinem Panzer vorbeifuhr? Sie sahen die Köpfe der Panzerschützen, die aus der offenen Luke ragten. Doch sie konnten sich irren. Die Militärparade, die auf dem Roten Platz vorüberzog, war weit entfernt. Und die Köpfe der Schützen waren so klein. Und Stalin auf dem Dach des Mausoleums nicht größer als ein Punkt. Auch die Katjuscha oder Stalinorgel, wie die Deutschen sie nannten, war kleiner, als Dmitri gedacht hatte. Wie konnte ein Raketenwerfer, der in einer halben Minute mehr als hundert Geschosse abfeuerte, nicht viel anders aussehen als eine einfache Kanone!
Einen Tag später kehrte der Vater an die Front zurück. Bevor er ging, umarmten er und die Mutter sich lange. Dann drückte er Dmitri fest an sich und forderte ihn auf, zu einem rechtschaffenen Mann zu werden. Der Vater sagte nicht mehr »zu einem guten Bolschewiken«.
Der Winter wurde immer erbarmungsloser, die Temperaturen sanken auf minus dreißig Grad. Das Wetter, las man in den Zeitungen, war aufseiten der Roten Armee. Denn die russischen Soldaten auf ihren Skiern flogen über die schneebedeckten Weiten, in warmer schneeweißer Winterkluft, unsichtbar und unüberwindlich. Während Hitlers Soldaten, denen die Winterausrüstung fehlte, im Schnee feststeckten und bibberten. Das war der Preis der Dummheit, sagte einer von Dmitris Klassenkameraden, dessen Vater General war. Wie konnten die Deutschen so sicher sein, dass sie es schaffen würden, Moskau noch vor dem Winter einzunehmen? Jetzt erfroren sie, ihre Nase und ihr Penis würden zu Eiszapfen, die bei der geringsten Bewegung abfielen. Dmitri dachte an seinen deutschen Onkel. Hatte auch er seine Nase und seinen Penis verloren?
Hitlers Wehrmacht aber ließ sich durch die Kälte nicht stoppen, sie rückte immer näher an Moskau heran. Und der Angstgeruch in der Stadt wurde stärker und stärker. Fast beneidete man diejenigen, die einen allmächtigen Gott besaßen, zu dem sie beten konnten. Als Bolschewik hatte man nur Stalin und seine Generäle, an die man glauben konnte. Und das fiel nicht so leicht, als der Befehl erteilt wurde, Moskau zu evakuieren. Nicht einmal Lenin durfte in seinem Mausoleum bleiben, obwohl er seit vielen Jahren tot war.
Dmitri und seine Mutter landeten in Galitsch, einer Kleinstadt am Galitschsee, fünfhundert Kilometer nordöstlich von Moskau. Der See war eine Eisfläche, umgeben von dunklen Wäldern. In klaren Nächten waren die Sterne groß, mit Sternbildern, die die Menschen einst auf ihrem Weg geleitet hatten. Jetzt war nicht mal mehr ein Ausweg geblieben, sagte die Mutter einmal, was immer sie damit auch meinte. Tagsüber arbeitete sie in einer Holzfabrik, während er die Schule besuchte. Am Abend saßen sie in dem kalten Mietzimmer auf ihrer Bettkante und löffelten die lauwarme Kohlsuppe. Und sprachen ausschließlich Russisch miteinander. Vielleicht waren die Wände zu dünn. Oder das Deutsche tat zu weh.
Im Januar 1942 erhielten sie einen Brief. Wenn sie ihn wenigstens in Moskau bekommen hätten, und nicht in dieser gottvergessenen Stadt. Dmitris Vater war im Kampf um Moskau gefallen. Es half nichts, dass er als Held gestorben war. Auch nicht, dass man die Deutschen zurückgedrängt hatte. Die Mutter wurde von der Trauer mitgerissen, weg von Dmitri, weg von allem. Es half nicht einmal, dass er Mutti zu ihr sagte. Sie schaute ihn an, als wisse sie nicht mehr, wer er war, oder wer sie war.
Es begann nach dem Tod des Vaters, dass er immer wieder einen schrecklichen Traum hatte. Er fuhr mit einem Floß auf dem See. Das Wasser war still und blank. Plötzlich sah er seine Mutter mit ausgestreckten Armen am Seegrund liegen, und kleine rote Fische schwammen durch ihr Haar. Als er voller Angst aufwachte, musste er rasch aufstehen, um sich zu überzeugen, dass sie in ihrem Bett lag und atmete.
Anfang März durften sie nach Moskau zurückkehren. Die Wohnung war eiskalt, es gab kein Wasser, die Wasserleitungen des Hauses waren in der Kälte geborsten. Stalin auf seinem Gemälde starrte noch immer misstrauisch nach rechts. Während die Mutter dünn und blass vor ihm stand und auf Deutsch sagte: »Was sollen wir jetzt tun?«
Wäre wenigstens die Stadt dieselbe gewesen. Doch die Straßen waren leer, viele ihrer Einwohner waren noch nicht zurückgekehrt. Und die wenigen, die zu sehen waren, hatten Gesichter wie die Mutter: Wenn man weiß, dass es keinen Ausweg mehr gibt. Lediglich die Verkäufer an den Straßenecken schienen an die Zukunft zu glauben und kassierten für jeden Zug aus einer Zigarette zwei Rubel.
Doch auch in Moskau gab es rettende Engel. Eine von Vaters Kolleginnen, eine Frau um die vierzig, die nie geheiratet hatte, Jefrossina Komarowa, war zu seiner Nachfolgerin bestimmt worden. Sie durfte die Direktorswohnung übernehmen, Dmitri und seine Mutter aber konnten bleiben. Sie wäre es gewohnt, beengt zu leben, sagte die Komarowa, hätte jahrelang mit ihrem Bruder und dessen Familie zusammengelebt.
Sie kam hereingestürmt und übernahm sofort das Kommando, eine kraftvolle Frau, trotz ihrer schmalen Gestalt, mit schwarzem kurz geschnittenem Haar, dunklen brennenden Augen und einem großen rot geschminkten Mund. Sie zog mit all ihren Büchern in Vaters Arbeitszimmer ein, während Vaters Bücher ins Wohnzimmer kamen. Sodass Stalin nun misstrauisch auf die gesammelten Werke von Hegel, Marx und Lenin starrte.
Und sie stellte ihr Radio neben das Porträt von Vater. Abend für Abend saßen sie dort beisammen, die Komarowa, Dmitri und seine Mutter, und lauschten den Frontberichten. Die Komarowa rauchte hektisch, als könnte der Rauch die Deutschen vertreiben. Während die Mutter mit einem Gesicht an ihrer Zigarette zog, als beneidete sie den Rauch, der sich auflöste und verschwand.
Manchmal blieben sie auch nach den Nachrichten am Radio sitzen. Wie an dem Abend, als einer von Moskaus bekanntesten Schauspielern ein Gedicht rezitierte, das, wie es hieß, die Offiziere der Roten Armee ihren Männern vortrugen, bevor diese in den Kampf zogen:
Dann töte einen Deutschen – töte ihn!
Töte ihn, sobald du kannst!
Jedes Mal, wenn du ihn siehst,
Töte ihn, töte ihn unbedingt!
Während der Rezitator noch sprach, mit einer Stimme, die vor Kampfeslust vibrierte, stand die Mutter auf und schloss sich in der Toilette ein. Vielleicht revoltierte ihr Magen, wie so oft nach Vaters Tod. Oder ihr war aufgegangen – woran auch Dmitri gedacht hatte –, dass sie ja Deutsche war, obwohl inzwischen Bolschewikin. Und dass er Halbdeutscher war, was er um nichts in der Welt sein wollte. Er sah die Komarowa an. Sie lauschte konzentriert, als wolle sie kein einziges Wort verpassen. Er konnte den Gedanken nicht loswerden, dass alles einfacher wäre, wenn sie seine Mutter wäre.
Es gab Gerüchte, dass die Komarowa ein Verhältnis mit einem ganz oben in der Partei hätte. Wieso bekam sie sonst einen ganzen Sack Kartoffeln direkt an die Tür geliefert? Oder eine Kanne Milch, die man in Moskau nur schwer beschaffen konnte. Oder ein ganzes Kilo Zucker zum Süßen des Tees. Er pfiff auf die Gerüchte. Für ihn war die Komarowa der beste Mensch, den es gab. Allein schon deshalb, weil sie alles mit ihnen teilte.
Sie gewann ihn für sich. Wurde seine Frossjenka. Während er immer öfter wütend auf seine Mutter wurde. Sie blieb weiter niedergeschlagen, obwohl es der Komarowa gelungen war, ihr Arbeit in einer Druckerei zu beschaffen. Vielleicht verstand seine Mutter, was er fühlte. Denn manchmal warf sie ihm einen Blick zu, als wäre sie ans Ende der Welt geraten, während er sich mitten in der Welt befand. Vielleicht gab sie deshalb alle Versuche auf, mit ihm Deutsch zu sprechen.
Ihm war es egal. Wo er doch Frossjenka hatte und Sascha, der sein bester Freund geworden war, ein schmaler, aufgeweckter Junge mit hellbrauner Igelfrisur und hitzigem Temperament. Sie hatten vieles gemeinsam: tote Väter, schweigende Mütter und Modellflugzeuge.
Manchmal gingen sie mit ihren Flugmodellen zu den Leninbergen. Wenn es Aufwind gab, flogen die Flugzeuge weit, über die Häuser weg, über den Fluss, vielleicht sogar bis nach Sibirien. Und Dmitri und Sascha rannten den Berg hinunter, mit ausgebreiteten Armen, als könnten sie jeden Augenblick selbst abheben.
Es ist merkwürdig, sagte Grünhoff, wie das Erinnern funktioniert. Vieles vergisst man. Doch was man noch weiß, ist fest im Gedächtnis geblieben, in allen Einzelheiten. Wie, als er eines Morgens ins Bad gekommen war und die Sonne durch das kleine Fenster schien. Sie beschien die Strümpfe der Mutter und die der Komarowa, die auf einer Leine über der Wanne hingen, lange, dünne beigefarbene Baumwollstrümpfe, die aussahen, als leuchteten sie von selbst. Und in ihm breitete sich etwas aus, ein intensives Glücksgefühl: Er hatte zwei Mütter und einen Freund, mit dem er sein Leben lang zusammenbleiben würde. Und für die Rote Armee lief es gut, Hitlers Wehrmacht aber war auf dem Rückzug. Er kam nicht einmal auf den Gedanken, dass auch das Glück sich zurückziehen konnte.
Es war an einem sonnigen Apriltag 1944. Sascha und er lagen auf den Leninbergen im Gras. Sein Freund hatte ihm ein Bild der amerikanischen Golden Gate Bridge gezeigt. Und sie hatten beschlossen, Brückenbauer zu werden. Sie würden die größte und schönste Brücke bauen, die es gab. Und dann mit ihrem eigenen Flugzeug darüberfliegen. Als er nach Hause kam, wartete die Komarowa auf ihn. Als er ihr Gesicht sah, verflog seine Hochstimmung sofort.
Sie wollte, dass sie sich zusammen aufs Sofa im Zimmer mit dem Stalin-Bild setzten. Als sie eine Zigarette aus dem Etui zog, sah er, dass ihr die Hände zitterten. Dann rauchte sie, als könnte jeder Zug ihr Leben retten. Er musste auf seine Hände schauen, um nicht in Panik zu geraten. Sie waren kleiner als ihre, die Hände eines Zwölfjährigen, mit Schmutz unter einem Daumennagel.
Er versuchte, den Schmutz zu entfernen. Das war besser, als dem zuzuhören, was sie sagte: dass seine Mutter in die Lubjanka gebracht worden war, das Hauptquartier des KGB am Dserschinski-Platz. Er wusste, wer dort hinkam: Konterrevolutionäre, die ins Netz der Geheimpolizei geraten waren und die hinterher bestenfalls in Sibirien landeten, manche aber verschwanden auf der Stelle vom Erdboden. Er konnte nur schwer atmen, der Hals wurde ihm plötzlich eng. Vielleicht ging es der Komarowa genauso. Es klang, als würden ihre Stimmbänder zusammengepresst, als sie sagte, er solle es wie ein Bolschewik nehmen. Er wusste, dass ein Bolschewik nicht weinte. Das Weinen aber kam doch, als die Komarowa ihn in die Arme nahm.
Hätte es Frossjenka nicht gegeben, wäre er völlig allein gewesen. Von der Familie des Vaters, die in Leningrad lebte, hatten sie nicht das geringste Lebenszeichen erhalten, selbst dann nicht, als die Stadt nach neunhundert Tagen Belagerung durch die Hitler-Wehrmacht befreit worden war. Vermutlich waren sie wie Hunderttausende anderer verhungert. Und die Familie der Mutter konnte er vergessen, sie gehörte der Feindesseite an. Frossjenka aber war da. Sie war seine zweite Mutter. Solange es sie gab, brauchte er sich vor nichts zu fürchten.
Vielleicht versuchte sie, ihre eigene Haut zu retten. Als sie ihn am nächsten Tag holten, griff sie nicht ein. Als er versuchte, sich an ihr festzuklammern, riss sie sich los und verschwand in ihr Zimmer. Und sie kam nicht heraus, obgleich sie seine verzweifelten Rufe gehört haben musste. Er schrie immer wieder ihren Namen, während man ihn wegschleppte. Erst viel später war ihm der Gedanke gekommen, dass sie vielleicht selber verzweifelt war. Wie soll man sich von jemandem trennen können, dessen Frossjenka man zwei Jahre lang gewesen war?
An die Zeit, die folgte, erinnerte er sich nur wenig, lediglich Fragmente waren geblieben: dass der Mann, der ihn verhörte, einen blitzenden Goldzahn hatte. Und dass die Zelle, in der er saß, eng und dunkel war. Und dass Schreie zu hören waren, die durch alle Wände drangen. Vielleicht stimmte es ja, was sie sagten: dass er eingestanden hatte, seiner Mutter bei ihrer antisowjetischen Agitation geholfen zu haben. Er erinnerte sich nicht. Auch nicht an die Fahrt nach Sibirien, zur Arbeitskolonie für Kinder. Nur daran, dass er geglaubt hatte ersticken zu müssen, als er, zusammengepfercht mit anderen Kindern, im Güterwaggon saß.
Grünhoff verstummte. Er strich mit den Fingern über die Tischfläche, während sich sein Blick in der Ferne zu verlieren schien. So habe er nie zuvor gedacht, sagte er, aber jetzt, wo ich vor ihm sitze, mit dem Wunsch, etwas über Bruno zu hören …
Da war ihm der Gedanke gekommen, dass Bruno, als er selbst dort im Güterwaggon saß, unterwegs nach Sibirien, noch immer als Pilot in Hitlers Wehrmacht diente. Während er dort eingesperrt saß, flog Bruno im großen, freien Luftraum umher. Hätte eine Rakete der Stalinorgeln nicht sein Flugzeug getroffen, wären sie sich nie begegnet.
Die Sonne war hinter den Kirschbaum gesunken. Der erstrahlte in vollem Glanz. Grünhoff aber sah es nicht. Man konnte glauben, er sitze noch immer in jenem Waggon. Er wirkte plötzlich ungemein müde. Ich fragte, ob er eine Pause einlegen wolle. Das wäre gut, sagte er. Könnte ich nicht morgen wiederkommen?