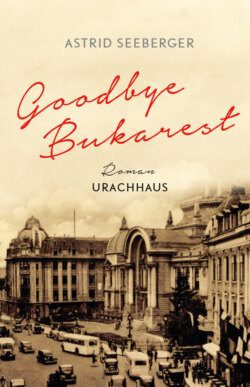Читать книгу Goodbye, Bukarest - Astrid Seeberger - Страница 8
Auf der Insel, 10. November 2014
ОглавлениеIch wachte auf dem Sofa auf, weil ich fror. Die Uhr zeigte nach Mitternacht. Ich holte Lechs Pullover und legte ihn mir um die Schultern. Dann setzte ich mich an den Schreibtisch und rief im Krankenhaus an. Es dauerte eine Weile, bis jemand antwortete, eine Krankenschwester, die barsch erklärte, Lechs Zustand sei stabil. Als Ärztin weiß man, was das bedeutet: Keine Besserung. Genauso kurzatmig. Genauso fiebrig.
Ich schaute das Bild an, das neben dem Telefon stand: ein Foto von Chopin, das einzige, das es von ihm gibt, im selben Jahr aufgenommen, als er starb, erst neununddreißig Jahre alt. Er sitzt aufrecht an einem Fenster, die eine Hand auf die andere gelegt. Das Gesicht, umrahmt von dunklem welligem Haar, ist schön, mit hoher Stirn, gerader Nase und männlich energischem Kinn. Er hätte kraftvoll aussehen können, wäre da nicht der Mund gewesen – ein feingezeichneter, sinnlicher Mund – und die Augen, vor allem die Augen, die einem Abgrund an Trauer glichen. Vielleicht wusste er, was ihn erwartete.
Das Bild stand da, weil mir ein anderes fehlte, das, das Mutter in ihrem Fotoalbum hatte und Bruno zeigte, ihren ältesten Bruder. Wenn Mutter nicht gesagt hätte, es sei Bruno, hätte man geglaubt, es wäre Chopin. Sie ähnelten einander wie Zwillingsbrüder. Der einzige Unterschied zwischen ihnen war, dass Chopin Dichterkleidung trug und Bruno die Uniform von Hitlers Luftwaffe.
Mutter hatte Brunos Bild verbrannt. Sie hatte alles verbrannt, alle Bilder, alle Papiere, alle Briefe, jedes Detail, das von ihrem früheren Leben zeugte. Sie sei rasend geworden, sagte sie, als sie daran dachte, was aus ihrem Leben geworden war. Ein Leben, das ihr ein Flüchtlingsgesicht gegeben hatte. Das Schlimmste war, dass sie dieses Gesicht noch immer hatte, als sie starb. Bevor sie selbst verbrannt wurde.
Ein einziges Bild war dem Feuer der Raserei entkommen: ein kleines vergilbtes Foto mit gezacktem weißem Rand. Es lag in Mutters Portemonnaie, das mir eine Schwester des Stuttgarter Krankenhauses nach ihrem Tod gegeben hatte. Auf dem Foto steht ein schmales dunkelhaariges Mädchen zwischen zwei jungen Männern mit dunklem welligem Haar. Alle drei lächeln mit ihrem feingezeichneten, sinnlichen Mund. Ihre Augen jedoch sind zu klein, als dass man einen Ausdruck in ihnen erkennen könnte. Das war Mutter mit ihren Brüdern, Bruno und Ewald, ein Jahr bevor der Krieg ausbrach.
Sie sagte, sie würde sie über alles lieben: Bruno, dem es gelang, dass alles, was er berührte, zu zittern aufhörte, auch die Menschen, auch Mutter, und dann Ewald, bei dem die Frauen vor Lust auf ihn erbebten, auch der eine oder andere Mann. Als Mutter erfuhr, dass Ewald den Krieg überlebt hatte, verschwand ihr Flüchtlingsgesicht, doch nur für kurze Zeit. Bruno hingegen war tot. Das hatte Mutter in meiner Kindheit immer wieder gesagt: dass Stalingrad Brunos Grab geworden war.
Als ich klein war und in meinem Bett lag, dachte ich oft an Bruno. Mutter hatte die Nachttischlampe gelöscht, und die Schatten kamen. Doch bekam ich keine Angst, wenn ich an Bruno dachte. Obgleich es Gedanken waren, die ein Kind erschrecken müssten. Ich versetzte mich nach Stalingrad, zu Bruno, der, vom Himmel geschossen, im kalten russischen Schnee lag. Ich sah, wie Stalingrads Ratten kamen und ihn wärmten, sich weich an seinen gekrümmten Körper drückten, bis er nicht mehr zitterte, nur still dalag, vollkommen still und tot. Während die Augen der Ratten im Dunkeln wie kleine rote Lämpchen leuchteten.
Mutter hat gelogen. Bruno war nicht tot. Er war aus einem anderen Grund nicht aus dem Krieg heimgekehrt. Er hatte mit seiner Familie gebrochen. Wollte sie nie mehr wiedersehen. Nicht nach dem, was Großvater getan hatte. Warum hat Mutter gelogen? War die Wahrheit allzu schändlich? Oder war sie zu schmerzhaft?
Vielleicht hätte sie es erzählt, wenn ich bei ihr geblieben wäre. Ich war kaum erwachsen, als ich auf und davon bin. Weg von Mutter, die sagte, ich sei ihr Ein und Alles. Weg von Vater, der immer mehr zusammenschrumpfte, auf jede Weise. Weg von meinem Freund, dem Dozenten für slawische Sprachen, der wollte, dass ich sein Leben mit ihm teilte. Vor allem aber weg aus Deutschland. Ich wollte keine Deutsche sein. Ich wollte zu keinem Land gehören, das so Schreckliches verbrochen hatte. Als ich nach Stockholm kam, erst siebzehn Jahre alt, war ich voller Euphorie. Und frei.
Mutter hat es mir nie erzählt, nur dem Alois, obgleich die beiden sich seit vielen Jahren nicht gesehen hatten. Sie suchte nach ihm, als wäre er der Einzige, den sie noch hatte, um sich ihm anzuvertrauen. Ihm erzählte sie das Unfassbare, was geschehen war. Und dass sie all die Jahre nach Bruno gesucht hatte. Am Ende hatte sie herausgefunden, wo er sich befand: in Bukarest, als Pilot der rumänischen Fluggesellschaft TAROM. Sie hatte mehrere Briefe an seine Adresse gesandt, doch nie eine Antwort erhalten. Wäre sie noch bei Kräften, sagte sie zu Alois, würde sie hinfahren. Kurz nach ihrer Begegnung war sie gestorben, als der einsamste Mensch auf Erden.
Warum hatte sie Alois nicht Brunos Adresse gegeben? Und auch meine nicht, so als spielte ich in Mutters Leben keine Rolle mehr. Erst als eins meiner Bücher in Deutschland herausgekommen war, hatte mich Alois über meinen deutschen Verlag ausfindig gemacht. Er schrieb, er wolle mich treffen. Die Wahrheit über meine Familie gehöre mir. Sie sei Teil meines Erbes.
Ich vermied es, den Brief von TAROM anzusehen, obwohl er auf dem Schreibtisch lag. Vielleicht war es ja ein gutes Zeichen, dass sich die Antwort hinausgezögert hatte. Die Reaktion der rumänischen Botschaft war rasch erfolgt: Sie wollten mir gern helfen, benötigten jedoch die genauen Geburtsdaten von Bruno. Auch deutsche und polnische Archive wollten mehr wissen als nur Brunos Namen und eine vage Angabe zu seinem Alter. Doch in Mutters hinterlassenen Papieren stand nichts über Bruno. Und Alfred, Mutters jüngster Bruder, der Einzige ihrer Geschwister, der noch lebte, war schwer herzkrank und erinnerte sich an nichts.
Ich nahm den Brief zur Hand. Er wog nur wenig, obwohl er über alles entschied. Schon wollte ich ihn wieder weglegen. Aber würde es denn einfacher sein, ihn später zu öffnen? Ich riss das Kuvert auf und las. Las den Brief ein ums andere Mal. Die Buchstaben gerieten immer mehr ins Wanken. Doch stand es da, klar und deutlich: »We regret being unable to help you …«