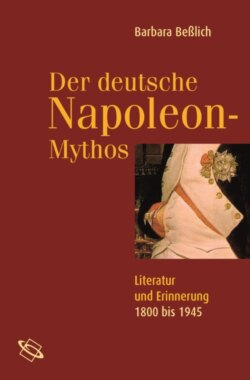Читать книгу Der deutsche Napoleon-Mythos - Barbara Beßlich - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Vom Revolutionsbändiger zum Nationalfeind Frontverschiebungen in der Publizistik (1799–1815) Coleridge, Gleim, Schlabrendorf, Seume, Beethoven, Arndt, Müller, Schelling, Fichte, Kleist, Schink, Görres
ОглавлениеBegeisterte man sich in Deutschland vor 1802 für Napoleon Bonaparte, so galt der Enthusiasmus der Außenpolitik und den militärischen Erfolgen des Feldherrn der Italien (1796/97)- und Ägyptenfeldzüge (1798/99), der den Menschen die Werte der Französischen Revolution wie Prometheus einst das zivilisatorische Feuer gebracht hatte. Übte man in Deutschland an Bonaparte zwischen 1799 und 1802 Kritik, so bezog man sich vor allem auf französische innenpolitische Belange. Nach dem Sturz des Direktoriums am 18. Brumaire 1799 stand Bonapartes Verhältnis zur Französischen Revolution zur Disposition. Erfolgreich aus Ägypten zurückgekehrt, ließ Bonaparte unter dem Vorwand eines Komplotts den Rat der 500 im Schloß von St. Cloud zusammenrufen. Die Versammlung wurde unter Mithilfe von Murat und Bonapartes Bruder Lucien gesprengt, und die wenigen zurückbleibenden Abgeordneten wählten Bonaparte unter Druck zum Ersten Konsul für zehn Jahre. Das war ein Staatsstreich.50
Dieser Staatsstreich ließ sich positiv deuten als Rettung aus dem Chaos und Bändigung der Revolution, aber auch als ein antirepublikanisches Signal interpretieren. Ob nach dem Staatsstreich von 1799 die Republik fortgesetzt wurde, Napoleon eine Rückkehr zum ancien régime betrieb oder das Konsulat die Grundlage für die erste moderne Diktatur in Europa bildete, ist auch noch heute in der historiographischen Forschung umstritten: Während Jean Tulard den Staatsstreich als einen Umbruch zur Diktatur wertet, betont Martyn Lyons, daß zwischen dem Ende der Direktoriumsherrschaft und dem Beginn des Konsulats kein einschneidender Wandel stattgefunden habe.51 Malcom Crook spricht differenzierend in Übereinstimmung mit Georges Lefebvre von einem „despotism by degrees“.52 Zeitgenossen Napoleons beobachteten die staatsrechtlichen Veränderungen genau und kritisch: Joseph Görres, der zu dieser Zeit in Paris weilte, prophezeite 1799 den Deutschen mit Blick auf antike Vorbilder: „Nehmt euch in Bälde den Suetonius zur Hand, denn der neue Augustus ist fertig.“53 Auch Coleridge erwog denselben historischen Vergleich in seiner Comparison of the Present State of France with that of Rome under Julius and Augustus Caesar.54 Im Jahr 1800 verdinglichte Görres den Ersten Konsul zum „Grab der Freiheitshoffnung“.55 Dabei ging es noch nicht um eine nationale Freiheit der Deutschen gegenüber einem französischen Gegner, sondern um eine innenpolitische Freiheit in der Tradition der Französischen Revolution.
Als Bonaparte sich 1802 in St. Cloud zum Konsul auf Lebenszeit erhob, intensivierte sich die Skepsis gegenüber der republikanischen Integrität Bonapartes. In diesem Sinn wandte sich Johann Wilhelm Ludwig Gleim 1802 An Napoleon, den Erhabenen von St. Cloud. Gleim mahnte zur staatsrechtlichen Besonnenheit und warnte vor Machtversessenheit und Hybris in antikisierender Form: „Setze die Krone nicht Dir, setze dem Werke sie auf!“56 Während Gleim noch einen Ton maßvoller Kritik anschlug, verschärfte sich die politische Enttäuschung in Johann Friedrich Reichardts Vertrauten Briefen aus Paris 1802/03. Der sich für den Girondismus begeisternde Reichardt war dem Konsul Bonaparte durch den preußischen Gesandten in Paris in einer Audienz vorgestellt worden. Reichardt vermittelte seinen deutschen Lesern seine Eindrücke in einem Charakterporträt Napoleons, das Bonaparte als macchiavellistischen Machtmenschen zeigte: „Herrschen ist seine einzige Leidenschaft und Beschäftigung.“57
Reichardt zeichnete auch dafür verantwortlich, daß Gustav von Schlabrendorfs antinapoleonisches Pamphlet Napoleon Bonaparte und das französische Volk unter seinem Consulate in Deutschland erschien. Der als Sonderling geltende Schlabrendorf hatte das Manuskript 1803 Reichardt in Paris übergeben. Reichardt hat es dann mit eigenen Zusätzen in Deutschland 1804 drucken lassen, weshalb er auch als Verfasser vermutet wurde. Die Wut auf den Diktator vor der Selbstkrönung aus republikanisch-demokratischer Perspektive ist hier vielleicht am schärfsten formuliert. Schlabrendorf lieferte eine regelrechte Biographie Bonapartes bis 1802 und schilderte detailliert und kundig die politischen Ereignisse. Gegen die im Vorwort formulierte Absicht, kein „Verächter oder Lobpreiser der gegenwärtigen Verfassung und Regierung zu seyn“, entpuppt sich die Schrift als gezielte Demontage.58 Schlabrendorf behauptete, Bonaparte „verachtet die französische Nation in eben so hohem Grade, als sie ihn haßt“.59 Napoleon werden „sein schwacher Körperbau“ und „seine störrische Gemütsart“ ebenso vorgeworfen wie seine im Luxus schwelgende Selbstinszenierung.60 Seine militärischen Erfolge werden mit „kriegerische[m] Starrsinn, der kein Opfer scheut“, erklärt.61 Die größte rhetorische Energie investiert Schlabrendorf in die Entlarvung von Bonapartes Innenpolitik als Despotie.
Geriet Napoleon vor 1804 in Deutschland ins Visier der Kritik, dann also als Revolutionsbeender und innenpolitischer Despot, nicht als Nationalfeind. In diesem Sinn kritisierte auch Seume im Spaziergang nach Syrakus (1802) Napoleon.62 Daß aber der innenpolitisch kritisierte Konsul in seinem Machtbewußtsein auch eine außenpolitische Gefahr für das bisherige Kräfteverhältnis in Europa bedeuten konnte, wurde mehr und mehr deutlich. Den möglichen Zusammenhang von Despotie im Inneren und äußerem Hegemonialstreben nahm 1803 Ernst Moritz Arndts Schrift Germanien und Europa in den Blick. Arndt wies daraufhin, daß die Proklamationen des Konsuls „nicht mehr von Bürgerlichkeit und Freiheit, als den ersten Gütern des Volks sprechen, sondern von Ruhm, von der Ehre, von der Fruchtbarkeit des französischen Namens; elenden Idolen, wodurch Eroberer die Völker unglücklich gemacht haben.“63 Auch Gleim forderte angesichts der Kriegslust des Konsuls: „Kröne Dein Werk mit dem ewigen Frieden, erhabener Krieger!“64 Das französische Heer interpretierte Arndt nicht mehr als Bringer der revolutionären Freiheit, sondern als Gefahr für die politische Eigenständigkeit: „Buonaparte belastet durch dieses ungeheure Heer nicht allein sein eignes Land; auch wir übrigen Europäer werden über ihn seufzen müssen.“65
Mit der Selbstkrönung Bonapartes zum Kaiser Napoleon 1804 schien sich Görres Prophezeiung vom „neuen Augustus“ zu erfüllen. Diejenigen, die in Napoleon einen Machtmenschen ohne Skrupel sahen, fanden sich bestätigt. Am 9. März 1804 wurde Georges Cadoudal verhaftet, weil er ein Attentat auf Napoleon vorbereitet hatte. Napoleon brachte den im badischen Exil lebenden Herzog von Enghien wider besseren Wissens in Verbindung mit einer royalistischen Verschwörung und ließ ihn aus Ettenheim nach Vincennes entführen, wo Enghien von einem Militärgericht am 20. März 1804 zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde. Das war ein Justizmord, von dem Fouché orakelte, er sei mehr als ein Verbrechen, er sei ein Fehler gewesen. Der später häufig gegen Napoleon erhobene Vorwurf des Amoralismus bezog vor allem aus dieser Episode seine historische Legitimation.66 Die zum Großereignis aufgebauschte royalistische Verschwörung gab Napoleon Argumente in die Hand, den Senat zu veranlassen, ihm am 18. Mai 1804 das erbliche Kaisertum in einem Plebiszit anzutragen. Am 2. Dezember 1804 krönte sich Napoleon selbst in Notre-Dame, Papst Pius VII. durfte nur noch nachträglich liturgisch assistieren.67
Die Enttäuschung vieler republikanisch gesinnter Intellektueller war um so größer, weil sie Napoleon lange als Anti-Royalisten hatten betrachten können. Schließlich hatte Napoleon am 5. Oktober 1795 noch den royalistischen Aufstand vor der Kirche St-Roch in Paris niedergeschlagen. Die Wut über den Verrat des Kaisers Napoleon an den Idealen der Revolution verdichtete sich in rasch verbreiteten Legenden wie der, daß Ludwig van Beethoven, nachdem er von der Kaiserkrönung Napoleons erfahren habe, zornig das Titelblatt der Partitur seiner Eroica zerrissen, die ursprüngliche Widmung an Napoleon getilgt und seiner dritten Symphonie nun vielmehr das allgemeinere Motto composta per festeggiare il sovvenire di un grand uomo vorangestellt habe; also dem Andenken eines Helden, der mit seiner Selbstkrönung seines Heldentums verlustig gegangen sei.68 Im Juni 1804 erschien in Deutschland ein anonymes Sendschreiben an Bonaparte. Von einem seiner ehemaligen eifrigsten Anhänger in Deutschland.69 Wie ein enttäuschter Liebhaber seufzte der Verfasser: „Nein, Bonaparte! Dich zu lieben, ist ferner nicht mehr möglich. Du machst es zu arg.“70 Das Pasquill apostrophiert Bonaparte als einen „ganz gemeine[n] Heuchler, ein[en] platte[n] Narr, Summa summarum, ein[en] Bösewicht“.71 Der Verfasser deklarierte sich als „Repräsentanten der öffentlichen Meinung“ in Deutschland und warf Bonaparte vor allem das Konkordat mit dem Papst als Heuchelei vor. Auch die multimediale monarchische Selbstinszenierung und den Nepotismus tadelte das Sendschreiben und gab die Schuld dem ehemaligen „Artillerie-Lieutnant, de[m] Parvenü, de[m] Nichtadeliche[n], de[m] Chef der sogenannten Republik“.72
Mit der Gründung des Rheinbundes gewann die Gegenwärtigkeit napoleonischen Machtstrebens für die Deutschen eine neue Dimension. Napoleon gelang es, deutsche Fürsten als Vasallen zu verpflichten, indem er ihnen Territorialgewinne zusprach. Im Reichsdeputationshauptschluß 1803 wurden die geistlichen Gebiete dementsprechend aufgeteilt; bei der Mediatisierung verloren 350 Reichsritterschaften die Reichsunmittelbarkeit. Bayern und Württemberg wurden Königreiche, Baden, Hessen-Darmstadt und Berg Großherzogtümer. Am 12. Juli 1806 schlossen sich 16 süd- und westdeutsche Fürsten im Rheinbund unter Napoleons Protektorat zusammen, der so seinen Einfluß auf Mitteleuropa sichern wollte.73 Die Rheinbundfürsten erklärten sich für souverän und unabhängig vom Reich, woraufhin Franz II. am 6. August 1806 die Kaiserwürde niederlegte. Die Forschung betont, daß dieses Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation zugleich den Beginn einer umfassenden staatlichen Modernisierung bedeutete.74 Widerstand der Bevölkerung gab es kaum, lediglich der Buchhändler Palm aus Nürnberg verfaßte die Schrift Deutschland in seiner tiefsten Erniedrigung und wurde dafür von den Franzosen erschossen.
Preußen geriet in Abhängigkeit von Napoleon und brach nach der Schlacht von Jena und Auerstädt 1806 zusammen. Am 27. Oktober 1806 zog Napoleon in Berlin ein. Die preußisch-französischen Kriege bildeten den Auftakt für die national inspirierte Publizistik gegen Napoleon. Die Schriftsteller mobilisierten nicht mehr im Namen der Revolution gegen Napoleon, sondern im Namen einer Nation, die es im Kampf gegen Napoleon überhaupt erst zu erschaffen galt. Aus der Nation als „Denkkategorie wurde ein Handlungsziel“.75 Diese nationale Publizistik gegen Napoleon konnte mit revolutionären Idealen einhergehen, mußte es aber nicht. In diffuses Sendungsbewußtsein mischten sich oft „nationalstaatliche Verengung und kosmopolitische Menschheitsmission.“76
1806 erschien der erste Teil von Ernst Moritz Arndts Geist der Zeit, der Napoleon als einen Parvenu beschrieb. Das Kapitel Der Emporgekommene greift die Naturkraft-Metaphorik Hölderlins auf, schränkt sie aber ein auf den militärischen Bereich.77 Mit dem „Sausen der schwangeren Gewitterwolken“ vergleicht Arndt Napoleons Auftritt auf der weltgeschichtlichen Bühne, er wirft ihm Despotismus vor und reduziert seinen politischen Erfolg auf militärisches Geschick: „Bonaparte fing als ein kleiner Soldat an, der Feldherr hat den Kaiser gemacht.“78 Der Unmut ist spürbar, aber die Argumentation durchaus noch nachvollziehbar. Späterhin in den Befreiungskriegen wird sich Arndts Argumentation immer mehr in Haßtiraden auflösen, die Napoleon als Inkarnation des Bösen beschreiben. Aber 1806 verwahrt sich Arndt noch vor solchen verzerrenden Vereinfachungen: „Ich sage nicht, daß er der verruchte Bösewicht ist, wozu ihn manche im Haß machen. […] Man darf den Fürchterlichen so leicht nicht richten, als es die meisten tun in Haß und Liebe.“79
Arndt wandte 1806 nicht vorrangig moralische Kategorien auf Napoleon an, sondern kennzeichnete ihn erst einmal als außerhalb der gesellschaftlichen Normalität stehend, ohne dies mit Verdikten zu verbinden: „Er trägt das Gepräge eines außerordentlichen Menschen, eines erhabenen Ungeheuers, das noch ungeheurer erscheint, weil es über und unter Menschen herrscht und wirkt, welchen es nicht angehört.“80 Moralisch verurteilend wandte sich Arndt hingegen an die deutschen Fürsten des Rheinbundes, die er als „Sklaven“ und „Franzosenknechte“ beschimpfte.81 Ihnen fehle das Verantwortungsgefühl für die Nation, die ihre Herrschaft überhaupt erst ermögliche.82 Erst aus dieser nationalen Perspektive heraus wurde Napoleon für Arndt zum Feind. Als nationale Gefahr war Napoleon für Arndt zu bekämpfen:
Furchtbarer ist kein Mann den Fürsten und Völkern. Er ist dem Weltmeer gleich, das ewig hungrig Bäche und Ströme in sich verschlingt und keinen Tropfen zurückgibt. Wie ihn das Glück fortstößt, folgt er frisch, und die weiten Entwürfe des Ehrgeizes wachsen. Der Kaisertitel, die Krönung in Italien, die Reise des Heiligen Vaters von Rom, die vorbereitenden Vergleichungen und Anspielungen auf Karl den Großen und die beliebte Ausführung des Satzes, daß Bonaparte schon einen großen Teil seiner Monarchie beherrscht, und die Hinweisung auf den Teil, wo noch andere gebieten, seine Herrschaft und Anzettelungen mit den unglücklichen süddeutschen Fürsten – o ihr irret, Geblendete oder Blender, die ihr uns in diesem Mann bloß den heroischen zeiget, den gerechten und milden gern zeigen möchtet, wenn ihr könntet. Die Zeit wird es enthüllen. Unaufhaltsam stürzt er sich fort mit Blitzesschnelle wie Dschingis und Attila, mit dem Eigensinn eines Fabricius und Marius, mit der Freundlichkeit eines Scipio und Cäsar, wenn der Unholdere sie ganz gebrauchen könnte.83
Arndt stilisiert Napoleon zu einem mythischen Proteus, der geschickt die historischen Rollen nach Bedarf wechselt und dabei als unaufhaltsame Naturkraft verbildlicht wird. Die zahlreichen Analogien, die Arndt anbietet, versuchen, das nur schwer Definierbare von verschiedenen Ebenen her anzugehen. Antike Reminiszenzen stehen neben außereuropäischen Gewaltherrschern. Der Vergleich mit dem Weltmeer, das unzählige Wasserströme in sich vereinigt, illustriert den Eroberungsehrgeiz Napoleons und greift Hölderlins Naturmetaphorik auf. Die Hinweise auf Dschingis Khan und Attila betonen neben der „Blitzesschnelle“ die Grausamkeit Napoleons und schildern ihn als eine Gefahr für den europäischen Frieden. Gaius Fabricius Luscinus galt zwar als Vorbild altrömischer Tugenden, bewies aber bei Verhandlungen mit Pyrrhus auch seine Unnachgiebigkeit. Der Vergleich mit Marius, der blutige Rache an seinen Gegnern nahm, als er mit Cinna Rom zurückeroberte, eröffnet den analogisierenden Blick auf mögliche Vergeltungsaktionen Napoleons. So wie Scipio die Karthager aus Spanien verdrängte, mag Arndt in Napoleon eine vergleichbare Gefahr für Deutschland gesehen haben. Mit Cäsar schließlich wird die Republikfeindschaft zum Thema gemacht. All dies adressiert Arndt warnend an die Deutschen, welche die Gefahr nicht erkennen, sondern beschönigen oder gar forcieren, was in der Paronomasie „Geblendete oder Blender“ zum Ausdruck kommt.
Während Arndt 1806 schon publizistisch für den nationalen Kampf gegen Napoleon rüstete, gab es freilich viele Zeitgenossen, die in Napoleons Sieg eine Chance für Deutschland sahen, mit verkrusteten absolutistischen Positionen zu brechen. Napoleon erschien hier als der Todfeind des Feudalismus und des ancien régime. So erläuterte der Historiker Johannes von Müller seine Gründe für seine Parteinahme für Napoleon: „Da das Alte, Unhaltbare, Verrostete einmal untergehen sollte, so ist das größte Glück, daß der Sieg ihm [i. e. Napoleon] […] gegeben ward“84. Und Schelling schrieb nach der Schlacht von Jena und Auerstädt: „Die Revolution hat erst jetzt in Deutschland angefangen; ich meine nämlich, daß erst jetzt Raum wird für eine neue Welt.“85 Aber nicht nur politische Hoffnungen schafften Bekenntnisse für Napoleon. Achim von Arnim schwankte 1807 immer noch zwischen Empörung gegenüber dem Eroberer und restloser Bewunderung für Napoleons Charisma: „Vom grimmen Haß gegen Napoleon raffte mich sein Anblick fast zu einer Gottesfurcht gegen ihn hin.“86 Napoleons Büste stand bei Ludwig Tieck und den Brüdern Schlegel.87 Bis zum Jahre 1808 sorgte darüber hinaus die Zensur dafür, daß nationale Aufstachelungen in der Presse noch selten waren.88 In Preußen artikulierte sich der Unmut schneller und aggressiver als in den Rheinbundstaaten.89 1807/08 hielt Johann Gottlieb Fichte in Berlin seine Reden an die deutsche Nation. In der letzten, der 14. Rede, warnte Fichte, daß eine Kampfverweigerung gegen Napoleon einer Vernichtung der deutschen Nation und ihrer Sprache gleichkäme. Im scharfen „Entweder-oder“-Modus, der keinen Kompromiß zuläßt, erklärte Fichte den Kampf gegen Napoleon zum Krieg um die nationale Existenz:
Gehet ihr ferner so hin in eurer Dumpfheit und Achtlosigkeit, so erwarten euch zunächst alle Uebel der Knechtschaft, Entbehrungen, Demütigungen, der Hohn und Übermut des Überwinders; ihr werdet herumgestoßen werden in allen Winkeln, weil ihr allenthalben nicht recht und im Wege seid so lange, bis ihr durch Aufopferung eurer Nationalität und Sprache euch irgendein untergeordnetes Plätzchen erkauft und bis auf diese Weise allmählich euer Volk auslöscht.90
Der prophetische Gestus suggeriert eine Gewißheit über die Zukunft Deutschlands, die wiederum zum Kampf gegen den „Überwinder“ auffordern soll. Unterschwellig wird eine alttestamentarische Analogie evoziert, die Deutschland als das auserwählte Volk in ägyptischer Gefangenschaft deuten läßt. 1808 erschien Jean Pauls Friedens-Predigt an Deutschland, in der unter Zensur-Bedingungen gleichzeitig das Protektorat Napoleons und die innere deutsche Zerstrittenheit und Weltfremdheit vorsichtig und in verschlungenen ironischen Wendungen kritisiert wurde.91 Parallel zu Goethes und Wielands begeistert beschriebenen Napoleon-Begegnungen in Erfurt verfaßte Kleist seine Hermannsschlacht, die dem Kampf gegen Napoleon eine historische Legitimität zuschrieb unter Rückgriff auf den Kampf Hermanns des Cherusker gegen die Römer. 1808 begann der spanische Freiheitskampf gegen Napoleon, poetisch begleitet mit Duque de Rivas Gedichten Napoléon, destronado und España triunfante.92 Die spanische Publizistik gegen Napoleon formte vielfach Muster vor, die deutsche Schriftsteller später übernahmen.93 1809 erhob sich Österreich gegen Napoleon, lyrisch unterstützt durch Heinrich Joseph von Collin und Friedrich Schlegel.
1809 erschien auch der zweite Teil von Arndts Geist der Zeit: Er bot keine sachliche Zeitanalyse mehr, sondern forderte in Imperativketten zur militärischen Handlung auf. Der Geist der Zeit adressierte sich nicht so sehr an die bereits überzeugten Napoleon-Feinde, sondern vielmehr an die Unentschlossenen. Im permanenten Anredewechsel apostrophiert Arndt entweder in Schimpfkanonaden Napoleon selbst oder diejenigen Deutschen, die napoleonbegeistert oder zumindest napoleonfolgsam waren. Auch die deutschen Fürsten blieben von solchen Schmähreden nicht verschont. Arndts Nationalismus kleidet sich daher oft in eine anti-höfische und antiabsolutistische Sprache, welche die Tradition des Sturm und Drang aufgreift. Dies verleiht seinen Appellen den rebellisch-revolutionären Charakter.94 Nationalchauvinismus verbindet sich bei Arndt mit der Attacke gegen das Feudalsystem. Dieser doppelten Zielrichtung korrespondiert die doppelte Feindschaft: Neben Napoleon als Nationalfeind stehen die angefeindeten Rheinbundfürsten als die Verhinderer der nationalen Selbstbestimmung.
Arndt attackiert vor allem Napoleons geschickte Selbstmythisierung: „Du hast dich zusammenstellen lassen mit Namen, wovor die Scham dich bleichen sollte, mit hohen Helden, und kein hohes Heldentum ist in dir.“95 Dementsprechend versuchte Arndt, diese historisch-mythologischen Vergleiche mit großen Feldherren zu entkräften. Hannibal, Cäsar und Karl XII. hätten im Unterschied zu Napoleon nicht aus Egoismus, sondern um einer großen Sache willen gehandelt und erobert. Der von Napoleon selbst geschaffenen abendländischen Traditionskette stellte Arndt eine pejorativ intendierte, asiatische Vergleichsreihe gegenüber: Napoleon sei ein „aufgedunsener Orientale“, „der neue Mongole und Sarazene von Korsika“; Arndt verwies ihn somit aus der abendländischen Tradition.96 Widersprüchlich verlief Arndts Argumentation, wenn er einerseits versuchte, Napoleons Größe zu Mittelmäßigkeit zu bagatellisieren und andererseits bereits von der Inkarnation des Bösen ausging. Napoleon erschien vernachlässigenswert als „Nachgeburt einer Zeit, die zu klein scheint, Helden gebären zu können“ und parallel als „vollkommen böse. Nie ist der böse Dämon so ausgesprochen worden als in diesem Zeitalter.“97 Diese widersprüchliche Gleichzeitigkeit dokumentiert den zweiten Teil des Geist der Zeit als Zeugnis des Übergangs von einer reflektierten Auseinandersetzung mit einem politischen Gegner zur argumentationsentschlackten Pamphletistik der Jahre 1812/13.
Napoleon als Personifikation des Bösen tauchte wieder 1809 in Heinrich von Kleists Katechismus der Deutschen auf. Der Titelzusatz abgefaßt nach dem Spanischen ist durchaus wörtlich zu nehmen, lehnte Kleist seinen Text doch deutlich an ein Dokument aus der spanischen Erhebung gegen Napoleon an. Kleists Nationalismus adaptierte ein katholisch-spanisches Muster, formte es aber preußisch-protestantisch um. Der Glaubenskern von Kleists Katechismus war weniger die nationale Selbstbestimmung als vielmehr eine detaillierte, haßvolle Feindbeschreibung und könnte daher fast treffender als Katechismus der Napoleon-Feinde bezeichnet werden. In der lehrenden Unterweisung wurde Napoleon als „böser Geist“ bezeichnet und als „Erzfeind“ kategorisiert.98 Im Kapitel Von der Bewunderung Napoleons dämonisiert Kleist Napoleon zu einem „verabscheuungswürdigen Menschen“; er hält ihn für einen „der Hölle entstiegenen Vatermördergeist“, „für den Anfang alles Bösen und das Ende alles Guten; für einen Sünder, den anzuklagen, die Sprache der Menschen nicht hinreicht, und den Engeln einst, am jüngsten Tage der Odem ausgeht“.99
Im Sommer 1813 hielt Fichte drei Vorlesungen Ueber den Begriff des wahrhaften Krieges. Darin fordert er die Deutschen zu einem allgemeinen ‚Volkskrieg‘ auf, den er von einem staatlich gelenkten Kabinettskrieg unterscheidet. Die letzte Vorlesung schließt mit einer Charakteristik Napoleons. Anders als Arndt noch 1809 versucht Fichte nicht, Napoleons Größe zu schmälern, im Gegenteil: Man gehe fehl, „indem man die Charakterkraft […] unseres Feindes herabwürdigt, dadurch uns einschläfert. Jämmerliche Wichte und Feiglinge setzen in diese Vertröstungen den Patriotismus“.100 Noch ärger als Napoleon zu verharmlosen, erscheint es Fichte, wenn man fatalistisch Napoleons Herrschaft als Geißel Gottes interpretiert: „Ist dieser Mensch eine Rute in der Hand Gottes, wie viele meinen und wie ich in gewissem Sinne zugebe, so ist er’s nicht dazu, daß wir ihr den entblößten Rücken hinhalten, um vor Gott ein Opfer zu bringen, wenn es recht blutet, sondern daß wir dieselbe zerbrechen.“101 Fichte überhöht Napoleon, denn große politische Widerstandskräfte lassen sich nur gegen einen großen Feind mobilisieren.
Jenseits solcher strategischen Überlegungen spielt in Fichtes Darstellung aber auch deutlich Faszination gegenüber der Außerordentlichkeit Napoleons mit herein. Napoleon erscheint bei Fichte nicht als Franzose, sondern als Korse. Dieser korsischen Herkunft verdanke er seine „Wildheit“, die Fichte als eine vorzivilisatorische Urkraft darstellt. Mit der korsischen „Wildheit“ korrespondieren aber auch die mangelnden moralischen Begriffe der Zivilisation: „Von einer höheren sittlichen Bestimmung des Menschen hatte er durchaus keine Ahnung.“102 Ähnlich wie Hölderlins Gedicht Buonaparte (1797/98) und Arndts erster Teil vom Geist der Zeit (1806) schilderte Fichtes Vorlesung noch 1813 Napoleon als elementare Naturkraft. In der Zeit der nationalen Frontverschiebungen des Befreiungskriegs bildet Fichtes Darstellung einen Anachronismus. Als Außenseiter habe Napoleon einen besonders klaren Blick auf die französischen Verhältnisse und verfüge darüber hinaus über einen „unerschütterlichen Willen“. Fichte folgert: „Mit diesen Bestandteilen der Menschengröße, der ruhigen Klarheit, dem festen Willen ausgerüstet, wäre er der Wohltäter und Befreier der Menschheit geworden, wenn auch nur eine leise Ahnung der sittlichen Bestimmung des Menschengeschlechts in seinen Geist gefallen wäre.“103 Das ist eine erstaunliche Aussage aus dem nationalistischen Trubel der Befreiungskriege heraus. Fichtes Napoleon ist eine Naturgewalt ohne moralische Zähmung. Schömann hat dies als „ein Zuwenig in Napoleons Charakter“ in Fichtes Zeichnung interpretiert.104 Mir scheint es etwas anders: Napoleon wird bei Fichte wie ein Relikt einer vorzivilisatorischen Epoche der Menschheit geschildert. Er ist der schlechthin Unzeitgemäße, und das macht sowohl seinen Reiz als auch seinen Erfolg aus, ein Deutungsmuster, das später im 19. Jahrhundert Nietzsche wieder aufnehmen wird.
Fichtes abwägende Position ist um so erstaunlicher, wenn man auf die übrige deutsche antinapoleonische Literatur aus dem Jahre 1813 blickt. Darin findet sich kaum noch eine kritische Würdigung des politischen Gegners, sondern es geht um nationale Mobilisierung durch Haß, der sich in drastischer Bildlichkeit, Argumentationsarmut und Schimpfwortreichtum äußert. Adam Müller, Friedrich von Gentz und Joseph Görres rüsten publizistisch besonders scharf gegen Napoleon auf.105 Johann Friedrich Schinks Dem Korsen gewidmete Schand- und Schimpfode reiht in den ersten zwei Strophen dreizehn Antonomasien aneinander, die Napoleon kriminalisieren, pathologisieren, dämonisieren und entmenschlichen. Über eine sich hyperbolisch in Ausrufen überschlagende Apostrophe gelangen die acht Verse nicht hinaus:
Abschaum der Menschheit, der mit Schwert und Feuer
Die Welt durchzog, verbreitend Ach und Weh!
Brandmark der Zeiten, Wütrich, Ungeheuer,
Wie keines war, keins ist, keins sein wird je!
Blutsauger, Völkergeißel, Weltzertreter,
Pest, Räuberhauptmann, Henker und Bandit,
Du menschgewordner Satan, Missetäter,
Wie selbst der Abgrund keinen sah und sieht!106
Arndt, mittlerweile im Dienste des preußischen Reformers vom Stein in Sankt Petersburg, verfaßte in der Tradition Kleists 1812 einen Kurzen Katechismus für den teutschen Soldaten. Eine überarbeitete Fassung erschien 1813 in Königsberg als Katechismus für den deutschen Kriegs- und Wehrmann, worin gelehrt wird, wie ein christlicher Wehrmann seyn und mit Gott in den Streit gehen soll. Nicht mehr im Frage-Antwort-Modus wie bei Kleist, sondern in einer die Bibel selbst imitierenden Sprache beschrieb Arndt im Kapitel Von dem großen Tyrannen Napoleon als „Satans älteste[m] Sohn“.107 Die Dringlichkeit der Kampfbereitschaft gegen Napoleon wird rhetorisch auf die Spitze getrieben, indem schließlich Gott nicht nur den Kampf unterstützt, sondern selbst spricht und zum Tyrannenmord auffordert: „Und doch kenne ich ihn nicht, spricht Gott, und habe ihn verworfen […]. Auf, ihr Völker! Diesen erschlaget, denn er ist verfluchet von mir, diesen vertilget, denn er ist ein Vertilger der Freiheit und des Rechts.“108
Als Napoleon im April 1814 nach Elba verbannt wurde, wählte Joseph Görres ein anderes literarisches Muster, um den Nationalfeind anzuklagen: Eine Ethopoeie ließ Napoleon vermeintlich selbst sprechen. Im Rheinischen Merkur erschien über mehrere Hefte im Mai 1814 ohne Verfasserangabe die Artikelserie Napoleons Proklamation an die Völker Europas vor seinem Abzug auf die Insel Elba. Die Leser hielten den Text für authentisch, aber es handelte sich um eine fingierte Ansprache, von Görres verfaßt. In dieser Ethopoeie läßt Görres Napoleon als skrupellosen, eitlen Machtmenschen erscheinen. Napoleon kündigt ein großes politisches Glaubensbekenntnis an: „Ich, Napoleon Bonaparte, einst Kaiser der Franzosen, jetzt in das Privatleben zurückgekehrt, will der Welt ein Zeugnis ablegen über meine Gesinnungen und wie ich gehandelt habe.“109 In herrischem und selbstgerechtem Ton erklärt dieser fiktive Napoleon sein machiavellistisches Programm: „Alles ist erlaubt, was die Macht zu befestigen im Stande ist.“110 Die „törichten Ideen von Freiheit“ und Frieden waren für ihn nur Strategie, er dagegen erscheint als Pragmatiker, dem Utopien ein Greuel sind: „Der wird in sein sicheres Verderben gehen, der das, was geschehen soll, und nicht, was geschieht, zum Maßstab seines Handelns macht.“111 Görres nutzt das napoleonische Sprachrohr für eine massive deutsche Selbstkritik. Görres’ Napoleon beschreibt Deutschland und seine Begeisterung für den Usurpator. Dabei rechnet er scharf mit der pronapoleonischen Literatur ab:
Ein Volk ohne Vaterland, eine Verfassung ohne Einheit, Fürsten ohne Charakter und Gesinnung, ein Adel ohne Stolz und Kraft – das alles mußte leichte Beute mir versprechen. […] Zwiespalt durfte ich nicht stiften unter ihnen, denn die Einigkeit war aus ihrer Mitte längst gewichen. […] Leichtgläubiger ist kein Volk gewesen, und töricht toller kein anderes auf Erden. Aberglauben haben sie mit mir getrieben und, als ich sie unter meinem Fuß zertrat, mit verhaßter Gutmütigkeit mich als ihren Abgott noch verehrt. Als ich sie mit Peitschen schlug und ihr Land zum Tummelplatz des ewigen Kriegs gemacht, haben ihre Dichter als den Friedensstifter mich besungen. Ihr müßig gelehrtes Volk hat alle seine hohlen Gespinste in mich hineingetragen und bald als das ewige Schicksal, den Weltbeglücker, die sichtbar gewordne Idee mich aus Herzensgrund verehrt. Lehrbücher haben sie auf mich gebaut und neue Weltsysteme.112
In dieser Passage steht nicht mehr die Kritik Napoleons im Mittelpunkt, sondern die Abrechnung mit den deutschen Napoleon-Verehrern. Der arrogante, aber kluge Napoleon aus der Ethopoeie von Görres attackiert vor allem den deutschen Adel. Die deutschen Fürsten hätten eine Napoleon-Idolatrie betrieben und Napoleon zu ihrem „Abgott“ gemacht. Nach dem Adel gilt die Wut den Intellektuellen. Hinter den Dichtern, die Napoleon als „Friedensstifter“ gefeiert haben, kann man vielleicht einen Hinweis auf Hölderlin vermuten. „Das ewige Schicksal“ als Deutungsmuster für Napoleon verweist auf die Schicksalsdramen, die Napoleon als fascinosum et tremendum gestalteten.113 Der implizite Ausfall gegen Hegels Sentenz über „den Kaiser – diese Weltseele […] auf einem Pferde sitzend“ ist deutlich, wenn von den „Lehrbüchern“ und „Weltsystemen“ die Rede ist, bei denen sich das „gelehrte Volk“ von Napoleon habe inspirieren lassen.114 Görres läßt Napoleon als Projektionsfläche für fehlgegangene nationale Wunschträume und weitere „hohle Gespinste“ erscheinen. Wie bei Arndt gilt Görres Haß gleichermaßen Napoleon als auch seinen deutschen Anhängern. Besonders hervorgehoben und scheinbar beglaubigt wird die zitierte Passage durch eine Anmerkung. Darin teilt ein fingierter Herausgeber mit, daß es sich hierbei um eine gekürzte Fassung handelt, „da wir es nicht über uns gewinnen konnten, alle Invektiven […] nachzuschreiben“.115 Rechnen Deutsche nach 1813 literarisch mit Napoleon ab, so werden in solchen Bilanzen meistens auch die deutschen pronapoleonischen Positionen mit kritisiert.