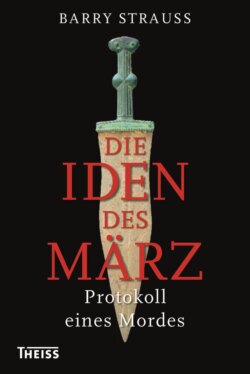Читать книгу Die Iden des März - Barry Strauss - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4 Caesars letzter Triumph
ОглавлениеAnfang Oktober 45 v. Chr., nach einem langen Aufenthalt in seiner Villa bei Labici, kehrte Caesar endlich nach Rom zurück und feierte seinen fünften Triumph. Dieser markierte seinen Sieg in Hispanien, und das Motto war Silber – schließlich war Hispanien berühmt für seine Bodenschätze. Die Tatsache, dass dieser Krieg ein Bürgerkrieg war, in dem Römer gegen Römer kämpften und nicht gegen einen ausländischen Feind, war noch schwieriger zu verheimlichen als 46 v. Chr. Insofern war dieser Triumphzug im Grunde genommen anstößig, wenn er nicht sogar gegen das Gesetz verstieß. Nichtsdestoweniger war Caesar entschlossen, den Anlass gebührend zu feiern, doch es ging nicht ganz reibungslos vonstatten.
Als der Diktator in seinem Triumphwagen an den Bänken vorbeifuhr, auf denen die Volkstribunen saßen, erhoben sich neun der zehn Tribunen zum Gruß; einer blieb sitzen. Die zehn Volkstribunen wurden jedes Jahr neu gewählt, und im Prinzip repräsentierten sie das gewöhnliche Volk, auch wenn sie selbst mitunter aus den Reihen der Optimaten kamen. Der Tribun, der sitzen blieb, war Lucius Pontius Aquila, der im Bürgerkrieg Pompeius unterstützt hatte. Möglicherweise war er ein Freund Ciceros; vielleicht handelte es sich bei ihm auch um eben jenen Pontius, der sein Anwesen in der Nähe von Neapel verloren hatte1 (dasjenige, das mittlerweile Servilia gehörte) – wenn dem so ist, hegte er auch einen ganz persönlichen Groll gegen Caesar.
Caesar war außer sich. „Bitte mich doch darum, dir die Republik zurückzugeben, Tribun Aquila!“2, rief er. Und das war noch nicht alles. In den nächsten Tagen beendete Caesar jede seiner öffentlichen Ansprachen, bei denen er irgendjemandem etwas zusicherte, mit den Worten: „Vorausgesetzt, dass Pontius Aquila mich lässt.“3 Das war sicherlich kein Witz nach jedermanns Geschmack, schließlich galten die Volkstribunen als Vorkämpfer der einfachen Römer.
Seinen Hispanien-Triumph krönte Caesar mit einem öffentlichen Bankett für die römische Bevölkerung. Und schon vier Tage später gab er ein weiteres beispielloses Fest, da, wie er sagte, an der ersten öffentlichen Speisung nicht alle Römer hätten teilnehmen können. Mag sein, dass der Politiker Caesar die Öffentlichkeit beschwichtigen wollte, die noch immer über den Volkstribun verärgert war. Erst hatte er in Hispanien Römer getötet, jetzt ließ er Römer auf seine Kosten essen und trinken. Caesar öffnete sogar sein neues Anwesen der Öffentlichkeit, um diese Bankette abzuhalten.
Dieses Anwesen – nicht zu verwechseln mit Caesars Villa in Labici, etwa dreißig Kilometer südlich von Rom – nannte man horti Caesaris, „Caesars Gärten“. Die Gärten lagen etwa eine Meile südöstlich der Tiberinsel in den Hügeln oberhalb des Westufers des Flusses, zwar in der Nähe von Rom, aber doch außerhalb des Stadtgebiets. Es war eines jener Freizeitdomizile, die sich die Granden Roms auf den Hügeln in der Stadt und um die Stadt herum bauen ließen – Anwesen, in denen man im Sommer eine sanfte Brise spürte, abseits der Sümpfe, wo die Malariamücken schlüpften. Zu den horti Caesaris gehörten große Hallen und Kolonnaden sowie ein Park, allesamt ausgestattet mit erlesenen Skulpturen und Gemälden. Vielleicht gab es auch einen Schrein für Dionysos, damals ein beliebter Gott in Ägypten. Mit Sicherheit gab es eine atemberaubende Aussicht über den Tiber auf die große Stadt und einen privaten Zugang zum Fluss.
Doch Caesars Gärten waren weit mehr als bloß ein Herrenhaus mit großem Grundstück. Caesar wollte die Kolonnade als Kulisse für sein politisches Theater nutzen. Und im Rahmen der Bankette nach dem letzten Triumph funktionierte das nur allzu gut – sogar so gut, dass es sozusagen nach hinten losging: Caesar stand auf einer freien Fläche zwischen den Säulen und ließ sich von der Menschenmenge begrüßen. Doch unglücklicherweise stand neben ihm auf dieser Freifläche gerade ein Mann namens Herophilos oder Amatius, und er wurde fast genauso stürmisch empfangen. Herophilos behauptete, ein Enkel des großen Marius zu sein, des Lieblings der Armen.4 Gaius Marius (ca. 157–86 v. Chr.), Sullas Erzrivale, war ein großer General gewesen und hatte der Partei der Popularen angehört. Er war mit Caesars Tante Julia verheiratet, der Schwester von Caesars Vater. Marius-Imitatoren oder angebliche Nachkommen von Marius tauchten immer mal wieder in Rom auf.
Von den Gärten Caesars ist heute nichts mehr übrig, und wir können auch nur ungefähr erahnen, wo sie einmal gelegen haben. Zwei Statuen hat man in Rom gefunden, die dort eventuell einmal standen, beide römische Kopien griechischer Originale. Und die illustrieren zwei klassische Motive: die Macht der Götter und die Wankelmütigkeit des Schicksals. Beide sind aus Pentelischem Marmor, einem Marmor von höchster Qualität, der von einem Berg massiv vor den Toren Athens stammt. Eine der Statuen zeigt den Gott Apollo, in seinem Heiligtum in Delphi auf einem Fel sen sitzend5 – in Delphi befand sich, so glaubten die Griechen, der Mittelpunkt der Welt. Das erhaltene Fragment zeigt den Gott, wie er seinen imposanten Körper dem Betrachter zuwendet. In der rechten Hand könnte er ursprünglich ein Zepter gehalten haben. Die zweite Statue zeigt einen Sohn der Niobe, der sich in dramatischer Pose auf dem Boden aufstützt; sein Körper ist in Richtung des Betrachters gedreht, der Kopf jedoch seitlich nach oben gewandt, das Gesicht zeigt Angst und große Emotion.6 Laut Mythos hatte Niobe vierzehn gesunde Kinder, und sie prahlte damit und beleidigte die Götter. Zur Vergeltung schickten die Götter Apollo und dessen Schwester Artemis, die binnen weniger Minuten alle Kinder Niobes töteten; sie selbst und ihr Mann starben schon bald darauf an Trauer und Zorn.
Sollten die Statuen Caesar gemahnen, dass er auch nur ein Mensch war, ganz gleich, was die Schmeichler ihm erzählten? Oder waren sie nicht mehr als zwei schöne Trophäen?