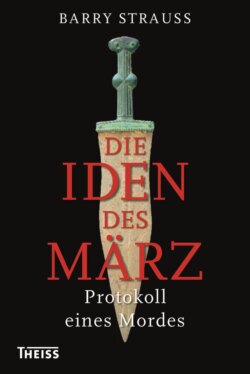Читать книгу Die Iden des März - Barry Strauss - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vom Diktator zum Gott
ОглавлениеSechs Monate lang, von Anfang Oktober 45 v. Chr. bis Mitte März 44 v. Chr., befand sich Caesar in Rom – es war sein längster Aufenthalt in der Stadt seit fünfzehn Jahren, aber es sollte weniger eine permanente Rückkehr sein denn eine Atempause. Er hatte bereits beschlossen, mit Beginn des Frühjahrs in den Osten aufzubrechen, um Krieg gegen die Parther zu führen, genau wie er ein Jahr zuvor nach Westen gegangen war, um Krieg in Hispanien zu führen. Was er in Rom wollte? Nach dem Rechten sehen, wie Cicero schrieb: „Man sagt, er [Caesar] werde nicht eher gegen die Parther ziehen, bis seine Angelegenheiten in Rom geregelt seien.“7 Was genau „geregelt“ heißen soll, ist nicht ganz klar; auf jeden Fall konnte Ende 45 v. Chr. Caesar niemand mehr für einen Freund der Republik halten.
Es widersprach bereits jeder Norm, dass er alleiniger Konsul war; üblicherweise regierten zwei Konsuln. Doch dann, im September, trat er zurück. Er blieb Diktator für zehn Jahre, und tatsächlich bestätigte ihm der Senat seinen Posten. Dennoch beharrte Caesar darauf, dass zwei seiner treuesten Generäle – Gaius Trebonius und Gaius Fabius – für den Rest des Jahres zu Suffektkonsuln (d.h. zusätzlichen Konsuln) ernannt wurden. Er machte sich nicht die Mühe, darüber abstimmen zu lassen. Später wurde Fabius von der Menge ausgebuht, als er das Theater betrat, da er nicht über die Legitimität eines gewählten Beamten verfügte – ein deutliches Zeichen dafür, dass es das Volk Caesar durchaus übelnahm, dass er sein Wahlrecht beschnitt. Der letzte Strohhalm kündigte sich am 31. Dezember 45 v. Chr. an: Fabius starb ganz plötzlich, und Caesar ernannte seinen alten Waffenbruder Gaius Caninius Rebilus für den Rest des Jahres, also für weniger als 24 Stunden, zum Suffektkonsul. Caesar musste sich beeilen, die Früchte seines Bürgerkriegs zu ernten8, wie der Historiker Tacitus viele Jahre später schrieb. Zur damaligen Zeit scherzte Cicero, Caninius sei so wachsam – als er Konsul gewesen sei, habe er nicht einen Moment lang die Augen geschlossen; aber das war eher verbitterter Humor aus der Feder eines Konservativen. Cicero schrieb auch, es sei ihm schwer gefallen, die Tränen zurückzuhalten.9 Und in jenen Tagen geschahen unzählige solche Dinge, so Cicero.
Und doch war all das erst das Vorspiel. Zum eigentlichen Clou kam es Ende Januar oder Anfang Februar 44 v. Chr., als der Senat Caesar zum DICTATOR IN PERPETUO ernannte – zum Diktator auf Lebenszeit10. Dieser neue Titel war von großer Wichtigkeit, hinsichtlich dessen, was er beinhaltete, und auch hinsichtlich dessen, was er nicht beinhaltete.
Das Problem war weniger die Macht, denn Caesar verfügte ohnehin bereits über umfassende politische Befugnisse. Niemand erhielt ein hohes Amt, ohne dass er sein Plazet gab, auch wenn er (rein technisch) kein Vetorecht besaß. Er kontrollierte die Armee und die Schatzkammer. Er konnte Konsul sein, wenn er wollte. Das Problem war auch nicht die formale Monarchie: Caesar betonte bei jeder Gelegenheit, dass er kein König war. Und man darf durchaus glauben, dass er den Titel des rex gar nicht wollte. Die ser Titel war den Leuten so verhasst, dass er mehr Mühe gemacht, als er ihm an Vorteilen eingebracht hätte. Aber ein „Diktator auf Lebenszeit“ war praktisch nichts anderes als ein König, und das wussten die Zeitgenossen auch. Kurz nach den Iden des März schrieb Cicero: „Wir hätten diesen Mann eigentlich ‚König‘ nennen sollen, denn in Wahrheit hatten wir einen König.“11 Asinius Pollio, Unterstützer Caesars und später ein bedeutender Historiker, schrieb 43 v. Chr., er habe große Stücke auf Caesar gehalten, aber unter ihm habe Rom eine uneingeschränkte Herrschaft erfahren, bei der alle Macht in der Hand eines einzigen Mannes gelegen habe.12
Das Problem dabei war die Zukunft. Nachdem Caesar Diktator auf Lebenszeit war, gab es kein Zurück mehr. Nicht einmal Sulla hatte einen solchen Titel gehabt. Im Gegenteil, Sulla war irgendwann von seinem Amt zurückgetreten und in den Ruhestand gegangen. Caesar hielt nicht hinter dem Berg damit, was er davon hielt – von ihm ist die geistreiche Bemerkung überliefert: „Sulla kannte das Alphabet nicht, als er die Diktatur niederlegte“13, soll heißen: Sulla kannte die grundlegenden Regeln der Politik nicht. Überliefert ist das Zitat durch einen Feind Caesars, insofern könnte es also erfunden sein, aber es klingt durchaus wie etwas, das Caesar gesagt haben könnte. Ein weiteres Anzeichen dafür, dass Caesars Diktatur von Dauer sein sollte, war der Eid, den der Senat ihm zu schwören beschloss. Alle Senatoren gelobten, für Caesars Sicherheit zu sorgen und ihn als sakrosankt anzusehen, und das bedeutete: Jedem, der ihm schadete, drohte die Todesstrafe.14
Könige haben Erben. Die Öffentlichkeit bekam nicht mit, dass Caesar seinen Großneffen Octavian bereits als Erben auserkoren hatte, wohl aber, dass Caesar ihn für den Großteil des folgenden Jahres zum formellen Stellvertreter des Diktators ernannte, zum magister equitum.15 Dieses Amt begann am 18. März 44 v. Chr., als Caesar und Marcus Aemilius Lepidus, einer von Caesars Generälen und momentan der magister equitum, planmäßig Rom verlassen sollten, um sich für den Rest des Jahres auf ihren jeweiligen Feldzug zu begeben. Der Posten war eine erstaunliche Ehre für einen Achtzehnjährigen, zumal angesichts der Skepsis, die die Römer der Jugend normalerweise entgegenbrachten. Nimmt man noch die Bestimmungen aus Caesars Testament hinzu, wird vollends klar, dass sich der Diktator auf Lebenszeit um einen Nachfolger kümmerte. Man hätte ebenso gut alle Glocken in Rom läuten können, um den Tod der Republik zu verkünden.
Es kam zu einer regelrechten Flut neuer Ehrungen für Caesar, die zeigten, wie begierig einige Römer bereit waren, vor den neuen Machtstrukturen zu buckeln. Das schloss auch den Senat mit ein: Sobald am 20. April 45 v. Chr. die Nachricht von seinem Sieg bei Munda in Rom eingetroffen war, riefen die Senatoren fünfzig Feiertage zu Ehren Caesars aus – noch einmal zehn mehr, als sie dem Volk bereits im Vorjahr nach seinem Sieg in Nordafrika gewährt hatten. Sie machten den 21. April zum jährlichen Gedenktag, veranstalteten Pferderennen im Circus Maximus, sie nannten Caesar pater patriae16 („Vater des Vaterlandes“), verliehen ihm den Titel liberator („Befreier“) und genehmigten den Bau eines Tempels für Libertas. Ferner gestatteten sie ihm, den Titel imperator („Feldherr“), den Generäle früher nur vorübergehend verwendet hatten, permanent zu führen – eigentlich verliehen die Truppen diesen Titel ihrem Anführer nach einem besonders bedeutenden Sieg. Der Senat erlaubte es Caesar außerdem, bei allen offiziellen Anlässen Purpur und Gold zu tragen, wie es zuvor für Triumphzüge vorbehalten gewesen war, und auf dem Kopf den Lorbeerkranz – das Symbol des Göttervaters Jupiter. Die Leute witzelten, gerade über diese Ehrung habe sich Caesar besonders gefreut, da er unter dem Lorbeer seine Geheimratsecken verstecken konnte17 – dass er langsam kahl wurde, passte dem eitlen Mann nämlich überhaupt nicht.
Unter Cato und seinen Gleichgesinnten wäre der Senat niemals so tief gesunken. Aber sie waren fort, der Bürgerkrieg hatte sie aufgerieben. Cicero war der letzte aufrechte Republikaner unter den Senatoren, aber auch er befand sich schon mit einem Bein im Ruhestand. Außerdem hatte er nicht vor, sich mit Caesar anzulegen. Ansonsten, so scheint es, war die Zeit der großen Persönlichkeiten im Senat vorbei.
Und so eskalierte der Wettbewerb der Schmeichler schon bald, nämlich mit dem Aufstellen neuer Statuen. Man nehme nur Quirinus: Er war einer von zahlreichen eher obskuren Göttern, die die Römer verehrten. Ursprünglich war Quirinus vielleicht eine lokale Gottheit gewesen, doch zur Zeit Caesars sah man ihn als Verkörperung von Romulus an, dem legendären Gründer Roms, der nach seinem Tod vergöttlicht worden war. So beschloss man, im Quirinus-Tempel auf dem Quirinal eine Statue von Caesar aufzustellen, mit der Inschrift: „Dem ungeschlagenen Gott“. In symbolischer Hinsicht wurde Caesar so fast zu einem zweiten Gründer Roms. Zu diesem Anlass schrieb Cicero einem Freund die pointierten Worte, es sei besser, dass sich Caesar mit dem Gott Quirinus einen Tempel teile als mit Salus, der Göttin des Wohlergehens.18 Warum? Wenn Caesar wie Quirinus war, dann durfte man noch hoffen, ihn wieder loszuwerden; immerhin war überliefert, dass die Senatoren den echten Quirinus – Romulus – töteten, damit aus ihm kein Tyrann würde.19
Auch auf dem Kapitol stellte man eine Statue von Caesar auf, neben den Statuen der sieben Könige von Rom und einer achten Statue, die den Mann darstellte, der 509 v. Chr. (so die traditionelle Jahresangabe) den letzten König vertrieben und die römische Republik gegründet hatte. Dieser achte Mann war Lucius Junius Brutus, den Brutus und Decimus als ihren Vorfahren ansahen. Eine weitere Caesar-Statue präsentierte man im Rahmen der Prozession, die die Spiele zu Ehren des Sieges bei Munda im Juli 45 v. Chr. eröffnete; man trug sie direkt hinter einer Statue der Göttin Victoria. Dieser Caesar bestand aus Elfenbein – eine ganz besondere Ehre, die in der Regel Götterstandbildern vorbehalten war.
Der Aufstellungsort, der Einsatz bei der Prozession und das Material der Statuen, zumindest derjenigen aus Elfenbein – all das rückte Caesar bereits in die Nähe der Göttlichkeit. Die Inschrift auf der Statue im Tempel des Quirinus machte keinen Hehl daraus. Man darf sich fragen, ob Caesar sie entfernen ließ, genau wie er im Vorjahr eine Inschrift hatte entfernen lassen, die ihn einen „Halbgott“ genannt hatte.20 Einwände kamen durchaus auch von anderer Seite. Laut Cicero applaudierte niemand, als bei der Prozession im Sommer Caesars Statue vorbeige tragen wurde – der „abscheulichen“ Prozession, wie er sie nannte21.
Dem Senat war das ganz egal: Anfang 44 v. Chr. unternahm er die letzten Schritte, um Caesar zu einem offiziellen römischen Staatsgott zu machen. Dazu gehörten ein eigener Tempel, ein ei gener Priester, eine heilige Lagerstätte für sein Standbild und der Name divus Iulius, „der vergöttlichte Julius“. Nichts davon wurde umgesetzt, solange Caesar noch lebte.
Wir wissen nicht, welche dieser Auszeichnungen auf Caesars Initiative zurückgehen oder ob er überhaupt irgendetwas da von initiierte. Möglicherweise versuchte der Senat durch eine Vergöttlichung Caesars die Unterstützung der zahlreichen Bewohner Roms, die aus dem griechischen Osten kamen und die eine solche Geste eher zu schätzen wussten, für sich zu gewinnen.