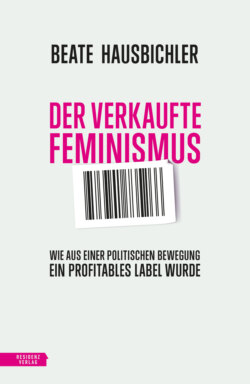Читать книгу Der verkaufte Feminismus - Beate Hausbichler - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ermächtigung – aber zum Konsum!
ОглавлениеDie zweite Frauenbewegung veränderte das Fremd- und Selbstbild von Frauen maßgeblich, weshalb Konzerne schnell verstanden, dass sie diese politische Bewegung nicht ignorieren konnten. Und sie wussten die Frauenbewegung erstaunlich rasch für sich zu nutzen. Die Werbung ab den 1960er-Jahren griff die Forderungen nach Emanzipation und Selbstbestimmung auf – wenn diese Forderungen auch nicht genauso klangen wie jene der Frauenbewegung, die auch am Kapitalismus scharfe Kritik übte. Deshalb formten Unternehmen die Forderung der Frauenbewegung nach Ermächtigung – vor allem im politischen Sinne – um: Sie wurde zu einer Ermächtigung zum Konsum und psychologische Kategorien wie »Selbstbewusstsein« wurden auch noch drübergestreut. Ein wunderbares Beispiel dafür beschreibt Andi Zeisler (Zeisler 2017, 24) mit dem TV-Spot für das Parfum »Charlie« der Marke Revlon aus dem Jahr 1973. Obwohl Feministinnen damals noch alles andere als beliebt waren, schaute man sich doch für das »Charlie-Girl« mainstreamverträgliche Facetten von ihnen ab: Die junge Frau, die den Duft in einem TV-Spot bewirbt, nimmt wie die Frauenrechtlerinnen der zweiten Welle die Straßen der Großstadt ein, allerdings nicht zu Fuß mit vielen Mitstreiterinnen an ihrer Seite wie die politischen Frauen. Das »Charlie-Girl« schwingt sich stattdessen aus einem fetten Rolls-Royce, wirft ihren Hut lachend einem Parkwächter zu und marschiert selbstsicher in eine Bar.
Das mag aus heutiger Perspektive wenig mit der Frauenbewegung zu tun haben, dennoch war sie der Motor dafür, dass man Frauen in einem Gestus der Selbstbestimmung und Selbstständigkeit darstellen konnte. Der Konsumkapitalismus setzte jedoch schon in den Jahren der ersten Erfolge der Frauenbewegung Emanzipation mit Besitz gleich. Und ganz falsch ist das ja auch nicht: Wirtschaftliche Unabhängigkeit war und ist ein Weg zur Gleichberechtigung – allerdings meinten die vorwiegend linken Feministinnen der zweiten Welle nicht Millionen für ein paar weiße Oberschichtfrauen, sondern Umverteilung auf alle.
Der Rolls-Royce gehörte jedenfalls dem »Charlie-Girl«, sie bewegte sich in der Öffentlichkeit, ohne bei einem Mann untergehakt zu sein, wie das noch auf Werbesujets wenige Jahre zuvor häufig zu sehen gewesen war. Die offensichtlich selbstbewusste Frau im Hosenanzug lässt sich auf dem Weg zu ihrem Tisch, wo sie letztlich doch ein Mann erwartet, von einem anderen noch in ein spaßiges kleines Tänzchen verwickeln. Sie hat offenbar Geld, Spaß und wirkt befreit von den verstaubten moralischen Vorstellungen der 1950er-Jahre.
Das war schon was für die 1970er-Jahre! Und die Vorlage dafür lieferten Feministinnen. Bilder wie die aus diesem TV-Spot sind Bilder der Ermächtigung, allerdings einer Ermächtigung zum Konsum und zu dem Preis, dass diese feministischen Versatzstücke hier als »sexy Selbstbewusstsein« inszeniert werden und Frauen vor allem als potente Konsumentinnen angesprochen werden. Selbstbestimmung und Autonomie sind bis heute zentrale Themen der Werbung für die Zielgruppe »Frau«. Der Unterschied zu den 1970ern ist, dass sich das Spielfeld, auf dem diese Selbstbestimmung angesprochen wird, erweitert hat. Die Angebote an Frauen und Männer, wer sie sein könnten und sollten, haben sich weiter ausdifferenziert.