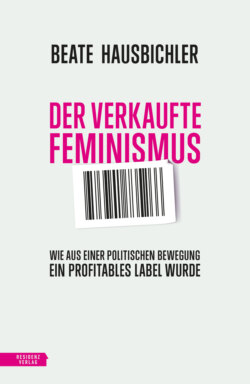Читать книгу Der verkaufte Feminismus - Beate Hausbichler - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung
ОглавлениеDieses Buch entstand in einem Fitnesscenter. Oder besser gesagt, mein Entschluss, dieses Buch tatsächlich zu schreiben, wurde dort gefasst. Das Fitnesscenter gehörte zu einer dieser Billigketten, in denen eine Mitgliedschaft monatlich 19,90 Euro kostet. Auf einem dieser Laufbänder sah ich mir auf meinem Smartphone ein Interview mit der Soziologin Eva Illouz an. In ihrer gewohnt gelassenen Art sagte sie in dem Gespräch: »Der Feminismus wurde vom Kapitalismus gekapert.« Ich kannte diese Position bereits von ihr, war aber dennoch überrascht, dass sie das so sagte, als sei es längst passiert, der Zug abgefahren, nichts zu machen. Ich reduzierte das Tempo des Laufbandes und schaute auf den großen Bildschirm über mir, auf dem seit Monaten der »Women Only«-Bereich des Fitnesscenters mit »Hier geht’s zur Frauenbewegung« beworben wurde. Sie hatte recht. Noch nie war diese Vereinnahmung des Feminismus und der Frauenbewegung offensichtlicher.
Und noch eine ähnlich seltsame Szene erlebte ich um dieselbe Zeit: eine Podiumsdiskussion mit mächtigen, reichen Frauen beim »Women20«-Gipfel in Berlin 2017, dem offiziellen Treffen frauenpolitischer Vertreterinnen und Führungskräfte der großen Industrie- und Schwellenländer. Darunter die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, die niederländische Königin Máxima, die damalige US-Präsidententochter Ivanka Trump und die IWF-Chefin Christine Lagarde. Schließlich stellte die Moderatorin Angela Merkel eine Frage, die man inzwischen oft und gerne stellt: »Würden Sie sich als Feministin bezeichnen?« Merkel eierte erst herum, um dann eher, aber nicht ganz eindeutig verneinend zu dem Schluss zu kommen, sich nicht mit fremden Federn schmücken zu wollen. Nach einigem Raunen auf dem Podium und im Publikum wurde weiter in die Runde gefragt. Wer bezeichnet sich als Feministin? Christine Lagarde riss begeistert ihre Hand hoch, fast genauso schnell waren die Hände von Ivanka Trump und Königin Máxima oben.
Das muss man sich einmal vorstellen: Die Tochter, Verteidigerin und Mitarbeiterin von »Grab ’em by the pussy«-Donald-Trump, die Chefin des Internationalen Währungsfonds und ein Mitglied des europäischen Hochadels nehmen für sich stolz in Anspruch, Feministinnen zu sein. Ohne mit der Wimper zu zucken. Ivanka Trump und Königin Máxima besitzen allein aufgrund ihrer Herkunft ein Vermögen und veritablen Einfluss. Die Dritte ist seit Ende 2019 Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Insbesondere Frauen aus den Ländern des Südens haben wohl noch nicht viel davon gemerkt, dass dort eine Feministin sitzt. Keine der Diskutantinnen ist je mit Ansagen zu feministischer Politik aufgefallen, und die Strukturen, denen Ivanka Trump, Königin Máxima und Christine Lagarde ihre unverschämt überprivilegierten Lebensumstände verdanken – mit denen hatte Feminismus einmal ein großes Problem. Und jetzt? Gibt es zwei zum Preis von einem? Die Privilegien aufgrund eines ungerechten Systems und den Feminismus?
Die einzige vernünftige Reaktion war die von Angela Merkel. Sie hat wenigstens versucht, dieses Wort, diesen derart aufgeladenen Begriff »Feministin«, in einen inhaltlichen Zusammenhang zu stellen. Vielleicht war ihr in dem Moment sogar bewusst, dass sie sich nie sonderlich für Frauenrechte eingesetzt hat. Hätten die anderen drei auch ein paar Sekunden darüber nachgedacht, worin nun genau ihr Einsatz für die Frauen dieser Welt lag, hätten sie zögern müssen. Doch Ivanka Trump, Christine Lagarde und Königin Máxima haben eines verstanden: Feminismus ist heute ein Label. Feministin zu sein, das gehört dazu. Da denkt man nicht lange nach, da sagt man einfach: Aber sicher doch. Hätte diese Szene zehn oder fünfzehn Jahre früher stattgefunden, hätte es auf der Bühne mehr als nur ein zögerliches und ausweichendes Statement gegeben. Man hätte wahrscheinlich etwas in der Art gesagt, dass man natürlich gegen Diskriminierung sei, aber man solche Klassifizierungen nicht möge, dass Gleichberechtigung schließlich für alle gelten müsse, nicht nur für Frauen. Also nein, Feministin sei man eher nicht. Nun, das hat sich inzwischen geändert.
Was ist also in mit dieser so lange verpönten politischen Bewegung passiert? Wann wurde Feminismus zu Everybody’s Darling? Schauspieler*innen, Künstler*innen, Politiker*innen, Journalist*innen, noch nie haben so viele einflussreiche und prominente Menschen den Feminismus abgefeiert, haben seine Leistungen öffentlich gewürdigt und Sexismus mit erhobener Stimme kritisiert. Und das gilt auch für große Teile der Gesellschaft abseits der kulturellen, politischen und medialen Bühnen.
Ich weiß noch, wie mühsam es vor zwölf oder dreizehn Jahren war, im Bildarchiv etwas zu finden, womit man Texte über Feminismus im engeren Sinn bebildern konnte. Es waren immer dieselben 10 bis 20 Fotos von karg besuchten Veranstaltungen und Frauentagsdemos, die sich anboten. Das war’s. Dann, Ende der Nullerjahre, wurde die in der Ukraine gegründete Frauengruppe »Femen« bekannt und wir wurden mit Fotos von Feministinnen mit nacktem Oberkörper (so zu demonstrieren ist ihr Markenzeichen) regelrecht überschüttet. Dann kamen die »SlutWalks« aus Kanada. Diese formierten sich, nachdem ein Polizist während eines Vortrags über sexualisierte Gewalt an einer Universität gesagt hatte: »Mir wurde gesagt, ich solle das nicht sagen, aber Frauen sollten es vermeiden, sich wie Schlampen anzuziehen, wenn sie nicht Opfer werden wollen.« »SlutWalks« wurden bald auf der ganzen Welt abgehalten, mit pointierten Botschaften gegen die Täter-Opfer-Umkehr wie »It’s a dress not a yes«, die es auch aufgedruckt auf T-Shirts gab. Bald darauf ging der Hype um Lena Dunham und ihre US-Serie »Girls« los, die – fast zehn Jahre nach »Sex and the City« – eine Generation junger Frauen zeigte, die keine perfekten Körper hatten und mit anderem befasst waren, als eine Beziehung hinzubekommen. Sie waren zwar vor allem mit sich selbst beschäftigt, aber immerhin. 2013 kam dann im deutschsprachigen Raum die Twitter-Kampagne #aufschrei gegen Sexismus, an der sich Zehntausende beteiligten. Das waren auch die Jahre, in denen sich immer mehr Stars als Feministinnen deklarierten, Sängerinnen wie Miley Cyrus, Beyoncé oder die Schauspielerin Emma Watson, die sogar UN-Sonderbotschafterin für Frauenrechte wurde und in dieser Funktion 2014 eine viel beachtete Rede über Gleichberechtigung hielt. Im selben Jahr titelte eine Ausgabe der Modezeitschrift »Elle« »The Feminism Issue«, mit Emma Watson auf dem Cover und dem Header »The Fresh Face of Feminism«. Und dann gab es natürlich im Herbst 2017 #MeToo, das freilich auf einem ganz anderen Blatt steht als das »Elle«-Cover. #MeToo wurde zur bisher größten feministischen Kampagne. In dieser verdichteten Form wurde Feminismus ab Ende der Nullerjahre und während der 2010er-Jahre in völlig neuem Ausmaß sichtbar.
Heute können wir sagen: Es läuft gut für den Feminismus. Er taucht inzwischen auf Notizbüchern und T-Shirts als Schriftzug in goldenen Lettern und in Songtexten von Superstars auf. Medien entdecken das Potenzial feministischer Debatten, traumhafte Leser*innenzahlen zu bringen. Mode- und Kosmetikkonzerne bieten ihre Produkte erfolgreicher denn je unter dem Label »Selbstermächtigung« feil, Musikstreamingdienste bieten Playlists mit den »Top Feminist Songs« an und wirklich jede*r im mittleren bis oberen Management weiß, dass es ohne »Diversity« kaum noch geht. Auch die berufliche Vernetzung entlang des gemeinsamen Nenners »Feminismus« läuft hervorragend: Man macht es den »Old-Boys’-Clubs« dieser Welt nach und schmiedet entlang der Geschlechtergrenze Seilschaften – für einen leichteren, schnelleren, erfolgreicheren Weg an die Spitze. Warum auch nicht? Immerhin könnte der geballte Feminismus in der Populärkultur, in den Medien, in Werbungen und in jedem Netzwerktreffen beruflich ambitionierter Frauen wird schon irgendwie und irgendwann durchsickern, so dass wir auch in unseren echten Leben etwas davon zu spüren bekommen, etwas, das weit über feministische Symbolik und feministische Ästhetik hinausgeht. Doch bisher ist nichts gesickert – und genau das ist das Problem.
Deshalb müssen wir uns dieses Phänomen genauer ansehen. Warum ausgerechnet jetzt? Warum wird Feminismus seit einigen Jahren genau von jenen umarmt, mit denen sich der Feminismus eigentlich angelegt hat? Der Schönheitsindustrie, den Mainstream-Medien, der Kulturindustrie und den Eliten, auch den weiblichen, wie sie dort auf dem neuerdings sehr feministischen Podium des W20-Gipfels zu finden waren. Was am Feminismus konnte zu einem derart funktionierenden Produkt umgeformt werden?
Doch was genau ist überhaupt »Feminismus«? Feminismus ist eine vielschichtige politische Bewegung. Trotzdem wird in diesem Buch lediglich in zweierlei Art von Feminismus die Rede sein: Erstens, wenn »Feminismus« genutzt wird, um etwas damit zu verkaufen – sich selbst, ein Produkt, einen Lebensstil. Und zweitens wird »Feminismus« auch in diesem Buch als politische Bewegung vorkommen. Ich möchte das Label »Feminismus« daraufhin abklopfen, inwiefern es die politische Bewegung »Feminismus« konterkariert. Wo das Label der politischen Bewegung widerspricht. Und wo das Label die politische Bewegung unterwandert, von den tatsächlichen Zielen ablenkt und diese pervertiert.
Abseits vom Label »Feminismus« gibt es viele Feminismen, mit jeweils unterschiedlichem Fokus. Diese Vielfalt bedeutet allerdings nicht Beliebigkeit, vielmehr zeugt sie von der Vielfalt feministischer Identitäts- und Interessenpolitiken (Wichterich 2019, 34). Mit Ausnahme des liberalen Feminismus, der die bestehenden Verhältnisse beibehalten und sie nur auf Geschlechtergerechtigkeit hin reformieren will, ist man sich weitgehend einig: Es soll darum gehen, den »ganzen Laden auseinanderzunehmen«, wie es die feministische Publizistin und Kulturwissenschaftlerin Sonja Eismann in einem Gespräch so schön ausgedrückt hat.
Aber gehen wir nochmal zurück zur Podiumsdiskussion beim W20-Gipfel. Diese Szene erklärt auch, warum es beim Feminismus als Bewegung nicht allein um eine Bewegung gegen die Diskriminierung von Frauen geht. Feministische Politik muss sich nicht darauf konzentrieren, die Interessen von Frauen wie Königin Máxima oder Ivanka Trump zu vertreten. Sie haben sämtliche Privilegien, die man sich vorstellen kann. Ich würde sagen: Diese Frauen kommen zurecht.
Zwar gibt es Diskriminierungserfahrungen, die alle Frauen teilen. Diese Erfahrungen kann man allerdings nicht isoliert von anderen bestehenden Ungleichheiten aufgrund von Gender, Klasse, Sexualität und der Einwanderungsgeschichte sehen. Feminismus muss auf der Seite derer stehen, die überlappenden Formen von Diskriminierung ausgesetzt sind. Er muss den Stimmen von schwarzen Frauen ebenso Gehör verschaffen wie jenen von Arbeiter*innen, intersexuellen Menschen, Menschen mit Migrationsgeschichte, Geflüchteten, Alleinerzieher*innen, Lesben oder Transfrauen. Er muss gegen Sexismus ebenso eintreten wie gegen Rassismus, gegen ökonomische Ungleichheit wie gegen Homo- und Transfeindlichkeit. Es ist dieser Ansatz eines intersektionalen Feminismus, wie ihn die US-amerikanische Rechtsprofessorin Kimberlé Crenshaw formuliert hat, der mir sinnvoll erscheint. Und nein, es ist nicht kompliziert. Es lässt sich einfach auf die Frage reduzieren, auf welcher Seite man stehen will. Und dabei können sich die Prioritäten je nach Problemlage auch mal verlagern.
Aber wie lässt sich nun daraus ein profitables Produkt machen? Die Frauenbewegung hat einige eingängige Slogans hinterlassen: »Our Bodies, Ourselves«, die Forderung, über den eigenen Körper entscheiden zu können, oder dass das »Private politisch« ist. Autonomie, Selbstbestimmung, Selbstermächtigung, Freiheit. Diese zentralen Begriffe des Feminismus sind auch große Versprechen des Konsumkapitalismus, der noch dazu die schnelle Einlösung dieser Versprechen in Aussicht stellt. Oder sagen wir so: Ein T-Shirt mit dem Slogan »Girl Power« oder »The Future is Female« hilft schon mal. Es schafft ein wohliges Gefühl des Fortschritts. Und die verheißungsvollen Forderungen nach Autonomie, Selbstbestimmung, Selbstermächtigung (Empowerment!) und Freiheit liefern nicht nur Produkte, sie schaffen auch einen wunderbaren Rahmen für neoliberale Praktiken, in denen die Verantwortung für sich selbst im Vordergrund steht, während staatliche soziale Netze immer löchriger werden.
Dass der Feminismus vom Kapitalismus gekapert wurde, das sagte Eva Illouz auch deshalb fast schon schulterzuckend, weil das in politisch-feministischen, aktivistischen und akademischen Kreisen auch längst bekannt ist. Die US-amerikanische Politikwissenschaftlerin Nancy Fraser hat darüber ebenso analytisch und kompromisslos geschrieben wie die britische Kulturwissenschaftlerin Angela McRobbie. Auch die US-amerikanische Publizistin und Popkulturexpertin Andi Zeisler hat sich ebenso ausführlich dem Ausverkauf des Feminismus gewidmet (Zeisler 2017). Und dieser Ausverkauf geht ungehindert weiter. Inzwischen ist die Vermarktung unter dem Label »Feminismus« so selbstverständlich geworden, dass sie auf vielen Ebenen nahezu unsichtbar ist. Das gilt auch für die Verknüpfungen von Feminismus mit karrieretechnischen Interessen.
Wir müssen deshalb ganz genau hinschauen, wo sich dieser marktförmige, populäre Feminismus überall findet und wie er sich entwickelt hat. Darüber hinaus müssen wir uns die Frage stellen: Inwiefern wirken wir selbst dabei mit, Feminismus als Marke zu nutzen, und berauben ihn so seiner politischen Kraft? Kapitalismus und Neoliberalismus umarmen den Feminismus. Und sie tun das inzwischen so fest, dass dem Feminismus als soziale und politische Bewegung die Luft genommen wird. So fest, dass jegliche Widersprüche plattgedrückt werden und jede Vielschichtigkeit, die ihn ausmacht und seinen kritischen Geist am Leben erhält, abhandenkommt.