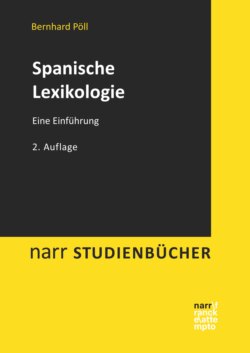Читать книгу Spanische Lexikologie - Bernhard Pöll - Страница 21
4.3 Strukturalistische Bedeutungsbeschreibung (“strukturelle Semantik”, “Lexematik”)
ОглавлениеDer im Wesentlichen in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts entstandenen “strukturellen Semantik”, die auf den Forschungen von Persönlichkeiten wie E. Coseriu, H. Geckeler, A.J. Greimas, G. Hilty, B. Pottier, P. Schifko1 u.a. beruht, liegt das Saussure’sche Postulat zugrunde, dass in der Sprache (als langue) nichts von sich aus gegeben ist, sondern alles als Produkt von Oppositionen angesehen werden müsse.
Diese Überzeugung kam erstmals in der Phonologie zum Tragen; gemäß der “Prager Schule” (insbesondere N.S. Trubetzkoy) erhält ein Phonem seinen Wert dadurch, dass es in direkter Opposition zu anderen Phonemen steht, von denen es sich in mindestens einer Eigenschaft unterscheidet: So ist beispielsweise im Spanischen das Phonem /b/ durch das Merkmal [+ stimmhaft] vom Phonem /p/, durch die Merkmale [– nasal] und [+ plosiv] vom Phonem /m/ geschieden. Die zitierten Beispiele unterscheiden sich natürlich noch durch andere Merkmale, die allerdings nicht distinktiv sind, also den funktionalen Wert des jeweiligen Phonems nicht mitbestimmen.
Implizit ist mit diesen Beispielen ein weiteres strukturalistisches Grundprinzip angesprochen: die Zerlegbarkeit in kleinere Einheiten bzw. die Kombinierbarkeit kleinerer zu größeren Einheiten.
Diese Prinzipien werden nun konsequent vom lautlichen auf den lexikalischen Bereich übertragen; so wie Phoneme durch ein Bündel von distinktiven Merkmalen bestimmt sind, wird die Bedeutung eines Lexems als die Summe seiner semantischen Merkmale (auch: Seme) verstanden. Man spricht deshalb von Merkmalssemantik (auch: Merkmalanalyse, Semanalyse).
Die Idee, die Bedeutung über Merkmale oder Komponenten zu definieren, ist nicht wirklich neu, sondern letztlich nur eine Formalisierung der Prinzipien aristotelischer Logik. Die Begriffsdefinition, wie sie seit Aristoteles betrieben wird – ein Begriff wird dadurch definiert, dass man ihn in seine nächsthöhere Klasse einreiht (genus proximum) und die Merkmale angibt, die ihn von seinen “Nachbarn” unterscheiden (differentia specifica) –, ist uns aus Wörterbüchern vertraut, da viele Definitionen so formuliert sind.2 Auch bei alltäglichen metasprachlichen Aktivitäten, wie dem Differenzieren von Synonymen, wird unbewusst mit semantischen Merkmalen operiert. Dieses Vorgehen wird vielfach auch als das Prinzip der hinreichenden und notwendigen Bedingungen bezeichnet: Um in eine Kategorie eingereiht zu werden, muss ein Begriff alle genannten Bedingungen erfüllen – sie sind für diese Kategorisierung notwendig –, und der Umstand, dass ein Begriff die relevanten Bedingungen erfüllt, führt automatisch zur Eingliederung in die Kategorie – die Bedingungen sind hinreichend.
Im Unterschied zu den Merkmalen der Phonologie, die mit Mitteln der akustischen Phonetik direkt physikalisch beschreibbar sind, ist der Status der semantischen Merkmale diffuser; ob sie neben ihrer offensichtlichen kognitiven Realität auch eine neuro-physiologische haben, ist unklar (cf. Lüdi 1985, 68 u. 88f.).
Die relevanten Oppositionen für das Aufdecken der Merkmale sind paradigmatisch und syntagmatisch: Lexeme stehen in Opposition zu anderen, u.U. bedeutungsähnlichen Lexemen; analog zu Minimalpaaranalysen können aus solchen Vergleichen die distinktiven semantischen Merkmale ermittelt werden. Bei der syntagmatischen Methode erfolgt die Bestimmung der semantischen Merkmale über die Distribution, d.h. die verschiedenen Kontexte, in denen das betreffende Lexem vorkommt.
Die paradigmatische Methode lässt sich anhand des schon klassischen Beispiels der “Sitzgelegenheiten” gut darstellen; ursprünglich wurde dieser Komplex von B. Pottier für das Französische analysiert. K. Baldinger (1970, 79) hat es analog für das Spanische durchexerziert. Zufällig decken sich hier die spanischen und die französischen Strukturen weitestgehend:
| s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | |
| chaise/silla | + | + | + | + | – | + |
| fauteuil/butaca | + | + | + | + | + | + |
| tabouret/taburete | – | + | + | + | – | + |
| canapé/canapé | + | + | – | + | + | + |
| pouf/posón (vulg.) | – | + | + | + | – | – |
“s” steht für die verschiedenen semantischen Merkmale (Seme):
s1 = con respaldo
s2 = sobre pie (= elevado sobre el suelo)
s3 = para una persona
s4 = para sentarse
s5 = con brazos
s6 = con material rígido
Die Summe der jeweiligen Seme des Lexems bezeichnet man als sein Semem. Auffallend ist, dass alle Lexeme die Seme 2 und 4 gemeinsam haben und sich jedes von den anderen in mindestens einem Sem unterscheidet. Für die Seme 2 und 4 existiert ein eigenes Lexem, das man als Archilexem bezeichnet (frz. siège, sp. asiento). Ein solches muss aber nicht existieren, wie das Deutsche beweist; man spricht dann von einem Archisemem, das man gegebenenfalls mit Hilfe eines Kompositums (Sitzgelegenheit) oder einer beschreibenden Paraphrase explizieren kann.
Anhand dieses Beispiels lassen sich einige Probleme und Missverständnisse im Zusammenhang mit der Semanalyse aufzeigen:
Solchen Analysen hat man gelegentlich vorgeworfen, es handle sich nicht um sprachliche, sondern um Sachfelder, die angenommenen Seme seien nichts anderes als Sacheigenschaften der Referenten. Dies kommt letztlich dem Vorwurf gleich, Bedeutung würde über die Referenz bestimmt. Richtig ist sicherlich, dass Seme teilweise Abbildfunktion für den Referenten haben, allerdings handelt es sich beim jeweiligen Bündel an semantischen Merkmalen keinesfalls um eine rein sachweltliche Strukturierung, sondern um eine sprachliche und – daraus folgend – häufig einzelsprachspezifische Strukturierung. E. Coseriu (1995, 118) hat dies in seiner umfassenden und wortreichen Apologie der Lexematik deutlich gemacht:
el campo fr. ‘siège’ estudiado por B. Pottier no es […] un campo no lingüístico, de ‘cosas’; es campo léxico del francés, con distinciones propias de la lengua francesa, y en que en otras lenguas podría presentar estructuración muy diferente. Los asientos mismos, sí, son objetos propios de un determinado ámbito de cultura material; pero no es hecho de cultura material la estructuración semántica de los lexemas que los designan.
Und weiter:
Así, todos los tipos de objetos designados por los lexemas del campo fr. ‘siège’ se conocen en la misma forma también en Rumanía; pero el correspondiente campo léxico rumano está estructurado de otro modo que el del francés. Y claro está, tampoco importa que los rasgos diferenciadores correspondan a propriedades objetivas de las cosas designadas; lo que importa es si son o no son rasgos distintivos del significado en una lengua. Por ejemplo, ‘con respaldo’ corresponde a una propriedad objetiva de las ‘chaises’ de Pottier, pero – aunque también las sillas rumanas tengan respaldo – no es rasgo distintivo del significado de rum. scaun, que, por ello, corresponde también a fr. tabouret.
Dennoch bleiben weitere Probleme bestehen:
1 Der Analyse der Oppositionen ist ein onomasiologisch motiviertes, d.h. von den Referenten ausgehendes Verfahren vorgeschaltet, in dem der zu untersuchende Wirklichkeitsausschnitt selbst bestimmt wird. Dabei kommt es – wie man z.B. Pottier vorgeworfen hat – zu einer unzulässigen Reduktion. Warum findet sich im Ensemble der Sitzgelegenheiten nicht auch sofa (sp. sofá) oder banc (sp. banco). Pottier hat seine Beschränkung mit pragmatisch-situationellen Argumenten zu retten versucht (Disponibilität der Lexeme in einer bestimmten Situation). Damit ist aber z.B. nicht geklärt, warum im Spanischen poltrona nicht mit einbezogen wurde. Die Hinzunahme anderer Lexeme könnte u.U. zu einer Erweiterung der relevanten Seme führen, da andere Distinktionen notwendig werden können.
2 Es ist nicht auszuschließen, dass Merkmale als distinktiv angenommen werden, die nur akzidentell sind und beim Referenten mit mehr oder weniger großer Konstanz beobachtet werden. Damit ist u.a. die in hohem Maße prekäre Unterscheidung zwischen sprachlichem Wissen und Sachwissen (enzyklopädisches oder Weltwissen) angesprochen.
3 Eine einmal durchgeführte Semanalyse kann nicht immerwährende Gültigkeit beanspruchen, da sich die Welt der Referenten ändern kann und die Bezeichnungen “mitziehen”. Im Lichte der Analyse von Sessel und Stuhl durch Hoinkes (1995), der die distinktiven Merkmale über die Funktion ermittelt (Stuhl: [zum Sitzen] vs. Sessel: [zum bequemen Sitzen]), wird man heute vielleicht auch die auf dem Vorhandensein oder Nicht-Vorhandensein des Merkmals [con brazos] beruhende Unterscheidung zwischen chaise/silla und fauteuil/butaca in Frage stellen dürfen. Daraus ist zu schließen, dass die Referenz nicht ausgeblendet werden kann, so wünschenswert dies auch manchen erscheinen mag.
4 Ein generelles Problem des strukturalistischen Herangehens an Bedeutung liegt im ausschließlichen Erfassen der denotativen Bedeutung, d.h. des objektiven und prinzipiell invarianten semantischen Gehalts. Konnotationen als expressive, emotionale, registerspezifische u.a. Bedeutungskomponenten meist überindividueller Natur können sich zur Denotation hinzugesellen, verändern sie aber nicht: Ob man die Ureinwohner Amerikas als indios bezeichnet oder als indígenas, verändert nicht den Wahrheitswert der Aussage, lässt aber beispielsweise auf Haltungen und Werte des Sprechers schließen. Soll man zur Beschreibung der Konnotationen zusätzlich Seme annehmen? Oder ist die Konnotation ein eigenes signifié, mit dem jeweiligen Lexem als signifiant?
Im Unterschied zur paradigmatischen Methode bedarf es bei der syntagmatischen Methode keines onomasiologischen Vorspanns zur Eingrenzung. Außerdem können die Lexeme in ihrer ganzen Bedeutungsvielfalt analysiert werden – bei silla etc. war ja im Vorhinein nur eine Bedeutung betrachtet worden (Monosemierung).
Exemplarisch lässt sich dieses Verfahren wieder unter Rückgriff auf die Sitzgelegenheiten illustrieren; Hilty (1995, 298) kommt durch eine Distributionsanalyse zu folgende Merkmalen von silla:
Die Darstellung als Baumdiagramm ist nicht zufällig, sondern spiegelt eine Hierarchie in den Merkmalen wider, die bei der paradigmatischen Analyse nicht zutage tritt. Die verschiedenen Lesarten (Sememe) entsprechen so unterschiedlichen Kombinationen und Strukturierungen von Semen.
Semantische Merkmale kann man nach dem Grad ihrer Allgemeinheit einteilen:
Seme sind die kleinsten distinktiven Merkmale; von ihnen können syntaktische Beschränkungen abhängen. Beispiele wären die Seme der Lexeme für Sitzgelegenheiten.
Archisememe (bzw. wenn lexikalisch realisiert: Archilexeme) sind Bündel von Semen (Semkomplexe), die sich spezifisch mit anderen sie determinierenden Lexemen verbinden. So gibt es z.B. bestimmte Adjektive, die nur mit den Vertretern einer bestimmten Gruppe von Substantiven verträglich sind (cf. Kapitel 4.6.1, mit Beispielen).
Klasseme sind sehr globale Seme, die allen Vertretern einer bestimmten Klasse gemein sind und diese konstituieren. Beispiele wären [Sache], [konkret], [abstrakt], [Tier], [weiblich] usw. Klasseme unterschiedlichen Allgemeinheitsgrades können in syntaktisch relevante hierarchische Beziehungen gebracht werden. Z.B. lässt sich [Sache] vs. [Tier] vs. [Mensch] besser so darstellen (cf. Greimas 1966, 54):
Zusammenfassend kann man festhalten: Die semantischen Merkmale sind “sprachspezifische Inhaltskomponenten lexikalischer Zeichen, die als Gebrauchsbedingungen interpretiert werden können und das systemhaft Relevante in den Zeichenbedeutungen, in der Paradigmatik […] ebenso wie in der Syntagmatik […] erschöpfend reflektieren” (Lüdi 1985, 84). Man muss jedoch darauf hinweisen – und dies ist schon ein Vorgriff auf den folgenden Abschnitt –, dass die semantischen Merkmale nicht zwingend bzw. nur z.T. die Gebrauchsbedingungen selbst reflektieren. M.a.W. ist der Gebrauch nicht unbedingt auf Basis der Merkmale vorhersagbar.
Auf die im Zitat angesprochenen paradigmatischen Beziehungen werden wir in Kapitel 4.5 näher eingehen; den syntagmatischen Beziehungen ist das Kapitel 4.6 gewidmet.