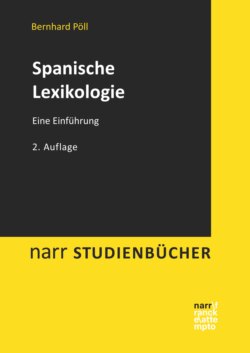Читать книгу Spanische Lexikologie - Bernhard Pöll - Страница 4
1 Lexikologie – eine Disziplin mit unscharfen Rändern 1.1 Der Gegenstandsbereich der Lexikologie
ОглавлениеIn der für die romanistische Linguistik maßgeblichen Romanischen Bibliographie (Online-Datenbank)1 finden sich in der Rubrik “Lexikologie. Etymologie. Lexikographie“ u.a. Arbeiten mit den folgenden Titeln:2
1 “Apuntes sobre lexicocronología española”
2 “Características lexico-semánticas de los verbos prefijados con ‘des-’ en DRAE 1992”
3 “El léxico indígena en el español hablado en Puerto Rico: variables socioculturales.”
Hier geht es – soweit sich dies ohne die genaue Kenntnis dieser Aufsätze sagen lässt – um Fragen der chronologischen Schichtung des spanischen Wortschatzes, um die Spezifika von Verben mit einem bestimmten Präfix wie sie im Wörterbuch der Real Academia Española (DRAE) beschrieben sind, und um die sozial bedingte Verwendung von indigenen Lehnwörtern im gesprochenen Spanisch von Puerto Rico.
In der darauffolgenden Rubrik, die den Titel “Semantik. Pragmatik” trägt, taucht erneut der Aufsatz über die präfigierten Verben im DRAE auf, daneben erscheinen hier aber auch
1 “Apuntaciones críticas sobre el diccionario de Cuervo. A propósito de los artículos fabricar, fácil y facilitar.”
2 “Die Bedeutung von spanisch silla.”
und viele andere mehr.
Zu Recht darf man sich fragen, ob den Verfassern da nicht Fehler unterlaufen sind: Sollte man (4), weil es ja um ein Wörterbuch3 geht, nicht besser unter “Lexikologie. Etymologie. Lexikographie“ eintragen? Gehört (3) nicht in eine ganz andere Kategorie, etwa Soziolinguistik? Hätte es nicht gereicht, (2) nur unter “Lexikologie. Etymologie. Lexikographie“ zu verzeichnen? Hat (5) nicht auch etwas mit Lexikologie zu tun?
Der Fairness halber wird man die Autoren der Bibliographie vom Vorwurf der Schlampigkeit oder des unüberlegten Handelns freisprechen müssen, denn solche Unsicherheiten, Doppelzuordnungen oder Überschneidungen sind symptomatisch für eine sprachwissenschaftliche Subdisziplin, in deren Gegenstandsbereich – dem Wortschatz – letztlich alle Fäden zusammenlaufen: Die Einheiten des Wortschatzes – nennen wir sie vorläufig einmal Wörter – haben Bedeutungen, und diese Bedeutungen bedingen sich oft gegenseitig, sie sind aus kleineren, isolierbaren Einheiten aufgebaut und lassen sich z.B. chronologisch nach ihrem Auftreten ordnen. Darüber hinaus ist ihre Verwendung, ihr Vorkommen in der Rede von vielfältigen u.a. geographischen, sozialen und individuellen Faktoren abhängig. Schließlich sammelt man sie auch mit verschiedenen Zielsetzungen und Ordnungskriterien in Inventaren – es entstehen Wörterbücher. Mit diesen wenigen Zeilen sind nicht einmal ansatzweise die Kernbereiche der Lexikologie beschrieben, im besten Falle haben wir eine Paraphrase der Titel unserer vorhin genannten Aufsätze. Die Ränder bleiben jedenfalls unscharf.
Dass der Aufgabenbereich der Lexikologie nicht ein für allemal fixiert ist, zeigt schon ein oberflächlicher Vergleich der in den letzten Jahrzehnten für verschiedene Einzelsprachen erschienenen Einführungen in die Lexikologie4 und ihrer jeweiligen Konzeptionen:
WUNDERLI, Peter (1989): Einführung in die französische Lexikologie. Tübingen: Niemeyer.Im Bewusstsein des interdisziplinären Charakters der Lexikologie greift der Autor in verschiedene relevante Bereiche aus: historische Schichtung, Entlehnung, Wortbildung, Translation (verstanden als syntagmatische Ausweichverfahren, um Schwächen der Wortbildung auszugleichen), Semantik (wird hier mit “struktureller Semantik” bzw. “Lexematik” [cf. Kapitel 4.3 dieses Bandes] gleichgesetzt).
SCHIPPAN, Thea (1992): Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer.Das 306 Seiten starke Werk behandelt sehr umfassend die folgenden Aspekte: Wort als sprachliche Einheit, Wortbildung, lexikalische Bedeutung, lexisch-semantisches System der Sprache (Bedeutungsbeziehungen; unter Einbeziehung psycho- und soziolinguistischer Aspekte), soziale Gliederung des Wortschatzes (mit Terminologie), neuere Entwicklungen im deutschen Wortschatz (Bedeutungswandel, Entlehnungen usw.). Einführende Kapitel versuchen den Gegenstandsbereich der Lexikologie zu umreißen, situieren die Lexikologie gegenüber “Nachbarwissenschaften” und geben allgemeine Informationen zur Schichtung und diatopischen Verbreitung des deutschen Wortschatzes.
LUTZEIER, Peter Rolf (1995): Lexikologie. Ein Arbeitsbuch. Tübingen: Stauffenburg.Um Formalisierung bemüht, fußt diese hauptsächlich auf das Deutsche abgestellte Einführung ebenfalls auf den Grundgedanken des Strukturalismus. Aspekte wie die kognitive Relevanz der von der Linguistik aufgedeckten lexikalischen Strukturen werden berücksichtigt (Stichwort: mentales Lexikon). Die Perspektive ist dominant synchronisch.
HALLIDAY, M.A.K./YALLOP, Colin (2007): Lexicology. A Short Introduction. London/New York: Continuum.Der schmale Band beschäftigt sich, ausgehend von Überlegungen zum Wortbegriff, primär mit grundlegenden Fragen der Semantik (denotative Bedeutung, Zusammenhang zwischen Wörtern und der Welt etc.). Überlegungen zu Etymologie, Lexikographie (insbesondere die Geschichte englischer Wörterbücher) und zum Vergleich von Wortschätzen unterschiedlicher Sprachen werden punktuell eingeflochten.
LEHMANN, Alise/MARTIN-BERTHET, Françoise (42013): Introduction à la lexicologie. Paris: Colin.Den Autorinnen zufolge sind die “domaines constitutifs” der Lexikologie die “sémantique lexicale” (lexikalische Semantik) und die “morphologie lexicale” (Wortbildung). Dem entspricht die Zweiteilung des Buches, wie sie in der Erstauflage (1998) vorgenommen wurde. Spätere Auflagen beinhalten auch ein umfangreiches Kapitel zur Lexikographie des Französischen. Im Bereich der Semantik werden auch neuere Ansätze (Prototypen, Stereotypen) behandelt.
HARM, Wolfgang (2015): Einführung in die Lexikologie. Darmstadt: WBG.Auf etwas mehr als 160 Seiten werden in diesem germanistisch ausgerichteten Band – wie auch in anderen Werken vom Konzept Wort ausgehend – die Form- und Inhaltsseite des Wortschatzes (Wortbildung und Modelle der Bedeutungsbeschreibung), Sinnrelationen zwischen Wörtern (paradigmatisch und syntagmatisch), die diasystematische Schichtung des Wortschatzes und der lexikalische Wandel sowie die Lexikographie behandelt.
Wir haben vorläufig als Gegenstand der Lexikologie den Wortschatz und seine vielfältigen Strukturierungen genannt. Intuitiv kann sich jeder etwas darunter vorstellen, weil dieser Begriff auch zur Alltagssprache gehört: Man hat einen großen, reichen, kleinen, differenzierten Wortschatz, etwas gehört nicht zu unserem aktiven Wortschatz, manche Wörter gehören überhaupt nicht zu unserem Wortschatz – oder zumindest behaupten das manche, um die Sprachreinheit besorgte Beobachter –, wenn es sich nämlich um Fremdwörter handelt.
Mit dieser alltagssprachlichen Verwendung ist nur ein Teil, wenngleich ein sehr wichtiger, des Interesses der Lexikologie abgedeckt, nämlich der individuelle Sprachbesitz wie er sich in Form von Wörtern und dem damit verbundenen semantischen, phonetisch-phonologischen, syntaktischen und pragmatischen Anwendungswissen manifestiert.
Um die damit nicht beschriebenen Bereiche zu umreißen, kommen wir nicht umhin, einen zusätzlichen, in hohem Maße mehrdeutigen (= polysemen) Begriff einzuführen: Lexikon.
Damit meinen wir
1 in Bezug auf die Sprache: den Wortschatz in Opposition zur Grammatik. Wer z.B. eine Fremdsprache lernt, eignet sich in diesem Sinne einerseits Lexikon und andererseits grammatische Regeln (= Grammatik) an.5
2 in Bezug auf das Individuum: lexikalische Kompetenz im Sinne der Fähigkeit zur Rezeption und Produktion. In der kognitiven Linguistik und in der Psycholinguistik spricht man vom mentalen Lexikon als dem Sitz dieser Kompetenz.
3 im Rahmen einer Sprachtheorie: eine Komponente des Sprachsystems in Form eines Inventars von Einheiten, auf das phonologische und syntaktische Regeln angewandt werden.
4 das konkret vorliegende, aufgrund von im Vorhinein fixierten Kriterien erstellte Inventar, d.h. ein Wörterbuch. Je nach Ausrichtung handelt es sich eher um ein Sprachwörterbuch oder um ein Sachwörterbuch, das Informationen zu den von den Wörtern bezeichneten Sachen angibt (cf. Lutzeier 1999, 16).6
In der weiter unten stehenden Tabelle versuchen wir, diese komplexe terminologische Situation wieder aufzulösen. Was darin als getrennt erscheint, wird in der Praxis jedoch häufig nicht so scharf geschieden.
Lag in der strukturalistisch geprägten Lexikologie das Hauptinteresse auf dem Lexikon 3, so haben sich seit den 1970er Jahren deutliche Verlagerungen ergeben: Die zentralen Bereiche der Lexikologie hängen heute am Lexikon 2 und Lexikon 3. Mit der sog. kognitiven Wende der 1960er und 1970er Jahre trat das mentale Lexikon als Erkenntnisobjekt neben das modelllinguistische Lexikon (= Lexikon 3).
| Objektbereich | Lexikon 1 (auch: Wortschatz) | Lexikon 2 (auch: mentales Lexikon) | Lexikon 3 (auch: Lexik) | Lexikon 4 (auch: Wörterbuch) |
| Element | Wort (oder größere Einheit, z.B. Redewendung) | Wort (oder größere Einheit, z.B. Redewendung) | Lexem (und seine Komponenten) | Wörterbucheintrag (auch: Lemma) |
| Reihenfolge bzw. Struktur der Anordnung der Elemente | ? | theorieabhängig | abhängig von Konzeption (alphabetisch, nach Lautung etc.) | |
| Status | schriftlich, mündlich | mental | theoretisch klassifiziert und beschrieben | schriflich fixiert, definiert |
| Rolle des Elements | Bestandteil einer Zeichenkette | Komponente eines (individuellen) Reservoirs | Komponente eines (überindividuellen) Reservoirs | Komponente eines Reservoirs |
| wissenschaftliche Prozeduren | Erforschung der Struktur, der Art des Zugriffs usw. | Deskription | Deskription und/oder Kodifikation | |
| Abhängigkeit des Objektbereiches nach Umfang und Struktur | von Lernprozess und Sprachbeherrschung | von einer bestimm-ten Sprachtheorie | von benutzerabhängigen Zielvorgaben | |
| wissenschaftliche Disziplinen | u.a. Sprachdidaktik, Lexikologie | Psycho-/Neurolinguistik, kogn. Linguistik, Spracherwerbsforschung, Lexikologie | theoretische Lin-guistik, Semantik, Terminologie, Lexikologie | Metalexikographie, Lexikographie, Terminographie |