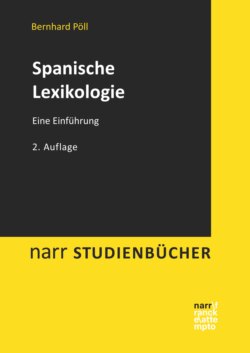Читать книгу Spanische Lexikologie - Bernhard Pöll - Страница 7
2 Die Einheiten des Wortschatzes 2.1 Wörter und Lexeme
ОглавлениеDas Wort als intuitiv erkannte Grundeinheit des Wortschatzes hat auch in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung seinen festen Platz, obwohl häufig nicht genau gesagt wird, was damit eigentlich gemeint ist. Wie bei ähnlichen Problemfällen, z.B. Satz, stört das in aller Regel aber nicht.
Fast alle gängigen Definitionen von Wort sind in höchstem Maße problematisch; zu den im Alltag häufigsten zählt „vorne und hinten abgegrenzte Buchstabenfolge“ – eine Definition, die z.B. für den Großteil des Mittelalters nicht gehalten hätte: In der Tat sind mittelalterliche Handschriften häufig ohne jeglichen Zwischenraum geschrieben, und erst mit Änderungen im Rezeptionsverhalten – selbst stumm lesen statt Vorgelesenes rezipieren – geht man von der sog. scriptio continua ab. Ein noch näher liegendes Beispiel ist die „neue“ deutsche Rechtschreibung von 1996, deren Regeln für die Getrennt- bzw. Zusammenschreibung ebenfalls bedeutende Auswirkungen auf die Wortdefinition haben, wenn sie auf graphischen Kriterien beruht.
Die Problematik solcher Kriterien tritt besonders deutlich zutage, wenn man
1 stilistisch oder grammatisch motivierte Schreibvarianten vor sich hat, z.B. quiero decírtelo vs. te lo quiero decir bzw. lo veo vs. viéndolo,
2 zwischensprachlich vergleicht und z.B. feststellen muss, dass ein und dasselbe Konzept in der einen Sprache mit einem graphischen Wort, in der anderen aber mit mehreren graphischen Wörtern ausgedrückt wird, z.B. dt. Zuckerrohr vs. sp. caña de azúcar.
Im ersten Beispiel wären te und lo einmal Teil eines Wortes, ein anderes Mal eigenständige Wörter, in (b) hätten wir im Deutschen nur ein Wort, im Spanischen gleich drei, wenn wir uns ausschließlich auf die Graphie berufen.
Dem graphischen Kriterium widerspricht u.U. eine weitere, häufig ins Spiel gebrachte Definition: „Ein Wort ist eine Einheit zwischen Sprechpausen.“ Mit diesem Merkmal kämen wir im obigen Beispiel caña de azúcar wieder zu einem Wort, da in normaler Sprechweise weder zwischen caña und de, noch zwischen de und azúcar eine Pause zu erwarten ist.
Wieder eine andere Definition sieht vor, dass Wörter minimale freie Formen sind, d.h. auch unabhängig vorkommen können: Leonard Bloomfield baut diese Argumentation in drei Stufen auf: 1. “forms which occur as sentences are free forms”, 2. “a free form which is not a phrase, is a word”, 3. “a word is a minimum free form” (Bloomfield 1933, 177f.). Damit können wir z.B. quiero in der Äußerung quiero decírtelo zweifelsfrei als Wort identifizieren, und diese Sicht deckt sich auch mit unserer Intuition. In anderen Fällen aber würden Einheiten ausgegliedert, die wir intuitiv sehr wohl als Wörter ansehen: Da beispielsweise der Artikel nie allein vorkommt und auch nicht als Satz auftreten kann, wäre er kein Wort, dasselbe gilt etwa auch für Präpositionen, die nie ohne das Element vorkommen, das sie regieren. Anders gesagt, es fallen alle sog. Funktionswörter, deren Leistung darin besteht, Beziehungen zwischen Elementen eines Satzes oder Textes herzustellen, aus der Definition heraus: Artikel, Konjunktionen, (adjektivische) Pronomen.
Das wesentliche und leicht mit unserer Intuition zu vereinbarende Kriterium zur Bestimmung des Wortbegriffs scheint der innere Zusammenhang von Einheiten zu sein. So können wir beispielsweise in dem Satz tienes que formatear el disco duro zwischen el und disco duro problemlos ein attributives Adjektiv, etwa nuevo, einfügen. Auf der darunterliegenden Ebene ist dies nicht mehr möglich: Bricht man Einheiten wie formatear oder disco duro auf, indem man ein Element einschiebt oder Komponenten vertauscht, ist das Ergebnis kein wohlgeformtes, d.h. den Regeln der spanischen Morphologie gehorchendes Produkt mehr. Analog gilt das auch für komplexere Einheiten: *caña azul de azúcar, *caña de mi azúcar usw. In diesen Fällen bleibt die Äußerung zwar prinzipiell interpretierbar (wie?), man kann damit aber wohl kaum mehr auf das Sachobjekt ZUCKERROHR referieren.
Unter Anwendung dieses Kriteriums können wir in dem Mini-Text
[ajkerespetaɾlas'foɾmas 'kujðalas'foɾmasiseɾasrespe'taðo]
problemlos diese elf Wörter wiedererkennen:
Hay que respetar las formas; ¡cuida las formas y serás respetado!
Allerdings werden manche vielleicht sagen, es handle sich nicht um elf Wörter, sondern nur um sieben. Beide Berechnungen sind auf ihre Weise richtig: Wer zum Ergebnis elf kommt, zählt einzelne Wortformen, wer nur auf sieben kommt, fasst jeweils zwei Wortformen zu einer abstrakteren Einheit zusammen, zu einem Lexem.1 Doch auch hinter den anderen Wortformen nehmen wir sinnvollerweise abstrakte Lexeme an.
Um Lexeme zu zitieren, verwendet man bei den flektierbaren Wortarten in der Regel den Infinitiv (beim Verb) bzw. die Form des Singulars2 (Substantive, Adjektive); gelegentlich wird auch nur der Stamm zitiert (z.B. respet-), insbesondere dann, wenn sie unter dem Gesichtspunkt der Wortbildung oder Morphologie betrachtet werden.3 Für Lexem als Basiseinheit des Lexikons verwendet man gelegentlich auch den vom französischen Semantiker Bernard Pottier geprägten Begriff Lexie.
Zusammenfassend können wir festhalten, dass wir es bei Wörtern entweder mit konkreten Wortformen oder abstrakten Lexemen zu tun haben. Wie der Gegensatz zwischen (Allo-)Phon und Phonem beruht auch diese Opposition auf der Saussureschen Dichotomie langue – parole.