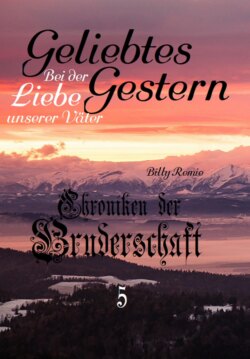Читать книгу Geliebtes Gestern - Billy Remie - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 6
ОглавлениеEr konnte nicht schlafen. Manchmal holte sich die Erschöpfung ihren Tribut und er dämmerte für etwa eine Kerzenlänge weg, doch nie tief genug, dass er sich danach erholt gefühlt hätte. Trotz Kopfschmerzen und Ermüdung fand er keine Ruhe. Und das lag nicht etwa daran, dass seine Lider nicht schwer oder sein Leib nicht kraftlos gewesen wären, sein Verstand gab keine Ruhe.
Sie redeten über ihn, vor dem Vorhang, sprachen leise miteinander mit Stimmen voller Sorge.
Er hasste es, wenn sie das taten, als ob er kein Gehör besäße. Oder als wäre er nur ein Tier in einem Käfig, über dessen Verfassung man diskutierte. Ob es vorzeigbar war.
Sie meinten es nicht böse, das rief er sich immer wieder in Erinnerung, sie sorgten sich und waren ratlos, doch er wäre ihnen dankbar, wenn sie verdammt noch mal seine Intelligenz nicht beleidigen würden, indem sie direkt vor seinem Schlafgemach standen und darüber flüsterten, dass er weder schlief noch aß noch den dunklen Raum verließ.
Desith saß auf der Bettkante und umklammerte das Holzgestell so fest, dass seine Knöchel weiß hervortraten. Im Kamin knisterte ein Feuer, das Vynsu vor nicht allzu langer Zeit mit fachkundigen Händen entfacht hatte. Nun stand Desiths Gemahl hinter dem Vorhang und flüsterte leise mit seinem Freund Jori über ihn. Wortfetzen wie »Ich weiß nicht…« und »…schläft immer noch nicht…« sowie »Sitzt nur da und starrt mit mörderischer Wut ins Leere…« drangen zu ihm herein.
Ein ums andere Mal wollte er hinausbrüllen, dass er nicht taub war, doch wenn er auch nur daran dachte, Luft zu holen und zu sprechen, verließen ihn seine Kräfte.
Desith fühlte sich dumpf und leer. Das einzige Gefühl, zu dem er noch fähig war, war die mörderische Wut, die Vynsu in seinen Augen bemerkt hatte. Sie war das, was ihn nicht schlafen ließ, denn es kam ihm falsch vor, zu ruhen und zu essen, wenn es so viel zu tun gab.
Sie konnten doch nicht einfach hier herumsitzen, während sein Vater kalt und steif in Elkanasai lag und dessen Mörder in aller Gelassenheit ins Nirgendwo flüchtete und sich vermutlich königlich über sie alle amüsierte.
Desiths Gesicht verzog sich vor Zorn, er löste die Hände von der Bettkante und ballte sie zu Fäusten.
Riath… dieser verdammte … Er hätte ihn töten sollen. Desith hätte ihn nie aus den Augen lassen dürfen… Ein angespanntes Zittern lief durch Desiths Arme, seine Kehle schnürte sich zu.
Schritte entfernten sich und gleichzeitig wurde der Vorhang zur Seite geschlagen. Vynsu duckte sich ins Zimmer, Desith brauchte sich nicht umzudrehen, er konnte dessen besorgten und ratlosen Blick im Nacken fühlen.
Zögerlich kam der Barbar näher auf Desiths Rücken zu, der in einem einfachen und weiten Wollhemd steckte. »Wellex‘ Fieber ist gesunken«, berichtete er, »er erholt sich schnell, möchte aber nicht reden.«
Desith starrte weiter ausdruckslos vor sich hin. »Was kümmert mich Lexi? Er kann von mir aus bis in alle Ewigkeit schweigen. Doch jemand sollte ihn bewachen, ich traue ihm nicht.«
»Das glaube ich dir nicht, er ist dein Bruder.« Vynsu machte noch einen Schritt auf ihn zu, aber die Breite des Bettes trennte sie voneinander. »Und es war nicht seine Schuld, das weißt du.«
»Nicht seine Schuld?«, presste er mit einem ironischen Grinsen durch die Zähne. »Er war dort, als es geschah! Er hätte es verhindern müssen! Aber das hat er nicht, stattdessen floh er feige!«
»Gib ihm nicht die Schuld, er hat deinen Vater so geliebt wie du. Lass es nicht an ihm aus, er hat gerade nur noch dich.«
Desith spürte, wie die Wut langsam in ihm hochkochte. Er wollte nicht böse auf Vynsu sein, doch sein Zorn wollte sich irgendwo bahnbrechen. »Er hat versucht, mich zu töten!« Er knirschte mit den Zähnen, was eine deutliche Warnung war, denn normalerweise hatte er seine Empfindungen immer gut unter Kontrolle. »Lexi ist gerade nicht mein vorrangigstes Problem, Vyn!«
»Aber ihr habt den gleichen Verlust erlitten«, sprach sein Barbar einfühlsam auf ihn ein. »Sollte euch das nicht wieder näherbringen? Es könnte dir guttun, mit ihm zu reden!«
Desith schwieg, weil er nichts Gehässiges und Verletzendes sagen wollte.
Vynsu seufzte bedauernd hinter ihm. »Ich weiß«, begann er wieder mitfühlend, »dass du denkst, ich könnte deinen Schmerz nicht verstehen…«
Abfällig zischte Desith und ließ den Kopf hängen.
Aber Vynsu sprach unbeirrt weiter auf ihn ein: »Doch auch ich habe vor kurzem meinem Vater verloren, Desith! Ich weiß sehr wohl, was du fühlst.«
»Nein, weißt du nicht«, erwiderte Desith mit dumpfer Stimme und schluckte, »du hast deine Rache nämlich bekommen.«
Daraufhin hörte er nur Schweigen. Er sollte dankbar darüber sein, doch das war er nicht. Desith wusste nicht, was er wollte, aber im Moment brachte ihn grundsätzlich alles auf. Verständnis ebenso wie Heuchlerei und Unverständnis.
»Wieso haben sie uns nichts gesagt?«, fragte er und drehte sich zu Vynsu um.
Sein Barbar hatte Schnee auf den fellbedeckten, breiten Schultern seines Wolfsumhanges, sein braunviolettes Haar schimmerte feucht im Schein der Fackeln. Ratlos hob er die Schultern.
»Mein Vater. Melecay.« Desith stand auf und kam um das Bett herum. »Warum haben sie uns nicht gesagt, dass Riath in Elkanasai ist? Sie wussten, dass ich nach ihm suche!«
»Vielleicht genau deshalb«, mutmaßte Vynsu, »sie wollten, dass wir nach Nohva reisen, dass wir uns auf eine Invasion vorbereiten. Hätten sie dir gesagt, dass sie Riath haben, hättest du alles über den Haufen geworfen, um dich an ihm zu rächen.«
Das leuchtete sogar ein, doch es machte ihn umso wütender. Desith wandte Vynsu wieder den Rücken zu und hatte nicht üble Lust, die Faust in die Wand zu rammen. Doch er hielt sich zurück, ballte nur die Hände und atmete tief durch.
»Die Nachricht in deiner Hand«, er hatte das Papier in Vynsus Fingern bemerkt, »sie kommt von Melecay.«
Sein Barbar nickte und knüllte das Papier. »Es hat sich nichts für ihn geändert, er schickt uns nach Nohva und schreibt, er habe die Lage im Kaiserreich im Griff. Er lässt deine Mutter und deinen Bruder Faith suchen.«
»Riath hat sie«, knurrte Desith. »Er wird sie nicht finden.«
»Vielleicht ja doch«, versuchte Vynsu, ihn zu beruhigen.
Desith hörte sich humorlos auflachen, bevor er sich davon abhalten konnte. Manchmal war sein Gemahl wirklich unheimlich naiv. Aber aus irgendeinem Grund besänftigte ihn das. Zumindest was seine Laune gegenüber Vyn anging, denn sein Barbar konnte am allerwenigsten an all den Umständen etwas.
Als hätte er gespürt, dass Desiths Abwehr bröckelte, trat er mit langsamen, aber mit großen Schritten auf ihn zu und legte ihm von hinten die starken Pranken auf die Oberarme. »Es tut mir so leid«, hauchte er ihm ins Haar und drückte sein Gesicht hinein. »So leid.«
Desith schloss gequält die Augen und schluckte gegen die Trauer an. Er konnte und wollte diese Gefühle jetzt nicht zulassen, wollte nicht spüren, wie ihm das Herz zerriss. Es war so vieles ungesagt geblieben, so vieles würde nun auf ewig schweigen. Er hatte seinen Vater geliebt, ihm dennoch immer den Rücken gekehrt. Er war egoistisch gewesen und hatte ihn oft verletzt. Sie hatten sich gerade zusammengerauft, zueinander gefunden. Nun blieb keine Zeit mehr für Entschuldigungen, sein Vater würde es nicht mehr hören.
»Ich hätte da sein müssen«, sagte er wütend. »Sie hätten es mir sagen müssen, dann wäre ich da gewesen und hätte ihn aufgehalten! Vater könnte noch leben, hätte man uns gesagt, dass Riath…«
Vynsu drückte seine Arme fest und brachte ihn zum Schweigen. »Das weißt du nicht, vielleicht wärest du an deines Vaters statt jetzt kalt.«
Erneut überkam ihn dieses widerliche, dumpfe Gefühl, das ihn nichts wahrhaftig fühlen ließ, nur lähmende Leere und Unglaube breiteten sich in ihm aus. Er konnte noch gar nicht begreifen, dass die Welt nun gänzlich anders war, als er sie kannte.
»Ich will ihn sehen«, sagte er entschlossen und drehte sich zu Vynsu um. »Ich muss ihn sehen!«
Sein Barbar ließ ihn los und blickte auf ihn herab, er wehrte sich nicht, als Desith ihm Melecays Nachricht entwand und eigenhändig in Stücke riss, die wie Schnee zu Boden rieselten. »Ist mir scheißegal, was der Großkönig befiehlt, wir reisen noch heute ab nach Elkanasai, ich will meinen Vater sehen!«
*~*~*
Flammen züngelten aus den dichten Baumkronen des Urwaldes gen Himmel, Rauchschwaden sickerten empor. Die weiße Stadt brannte lichterloh. Die Marmorsäulen der vielen Gebäude brachen zusammen, das Fundament des Reichs stürzte ein. Städter rannten durch die Straßen, schrien ob des großen Leids, sie flohen vor den blutigen Äxten der Barbaren, wurden einer nach dem anderen abgeschlachtet. Magier brannten auf den Scheiterhaufen, sie wurden zusammengepfercht und wie Vieh mit starken Seilen aneinandergebunden. In Reih und Glied, misshandelt und geschändet, wurden sie nacheinander zu den Pfählen geführt und mit Öl übergossen.
Die einstige so würdevolle und geordnete Dynastie Elkanasais ging in Chaos und Gewalt auf. Das Reich der Magier war gestürzt. Die Akademie bis auf die Grundfeste niedergebrannt. Und inmitten all der Flammen, all dem Tod und des Leids, saß thronend hinter den Scheiterhaufen am Marktplatz der Großkönig mit einer widerlichen Gleichgültigkeit, schlürfte Wein und legte die Hand auf den dunklen Schopf des geprügelten, geschändeten Sky, der in Ketten wie ein Hund zu Füßen eines Thrones aus Blut und Knochen lag.
Eiskaltes Wasser traf Kacey so hart wie ein Schlag mit dem Knüppel und riss ihn so unverwandt aus der düsteren Vision, dass sein Herz und sein Verstand für einen Moment aussetzten. Der Schock fuhr ihn durch alle Glieder, er warf sich laut nach Luft ringend vom Rücken auf den Bauch und japste. Das Wasser hatte ihn auf zwei Arten erstickt, zum einen waren ihm die Fluten aus dem riesigen Eimer in Nase und Mund gelaufen, zum anderen war es so kalt, dass es sich wie Nadelstiche in seinen Leib gedrängt und seine Atmung gelähmt hatte.
Kacey bebte vor Kälte, obwohl sein Körper von innen heraus durch das hohe Fieber brannte. Das Wasser verschaffte ihm jedoch keine Linderung, es verschlimmerte seinen Zustand umgehend. Zitternd wie Espenlaub kauerte er auf den Ellenbogen inmitten der eiseskalten Pfütze und konnte nicht einmal die Tropfen klar erkennen, die von seinem ausgemerzten Gesicht perlten.
Ein unsanfter Triff in den Magen beförderte ihn zurück auf den Rücken. Er war so abgemagert und ausgehungert, dass der Aufprall ihm beinahe eine Rippe anknackste.
»Du siehst, was geschehen könnte.« Daintys schmales Gesicht und sein weißer Mantel tauchten über Kacey auf, doch er erkannte ihn nur unscharf. »Ich bin nicht gewalttätig, mein Schöner. Gib mir, was ich will, und ich kehre mit dir zu meinem Gemahl nach Elkanasai zurück, um ihm einen kleinen Teil seines Gewissens zu wecken.« Und leiser, beinahe verständlich und mitfühlend, fügte er an: »Wir könnten ihm gemeinsam ein Gewissen geben. Wenn du klug bist und wenn dir wirklich etwas an deinem Volk liegt, dann ergibst du dich uns und machst das Beste aus deiner Lage.«
Kacey brauchte von Tag zu Tag länger, um Daintys Träume von den eigenen zu unterscheiden. Er brauchte sogar länger als ihm lieb war, sie von der tatsächlichen Gegenwart zu unterscheiden.
»Wexmell…«, keuchte er und schluckte gegen die Übelkeit an, ein Zittern erfasste und erschütterte seinen Leib erneut. Er setzte von vorne an. »Wexmell… wir…wird das nicht… zulassen.«
Dainty verzog bedauernd das Gesicht, er warf den Eimer zur Seite und ging neben Kacey in die Hocke. »Er hat doch keinen Einfluss mehr, Kacey, Schatz. Elkanasai gehört bald vollständig uns. Dein Volk wird Nohva zu hassen lernen. Melecay wird es gegen Wexmell führen.«
Kacey schüttelte den Kopf, er wollte das nicht glauben, so einfach konnte Carapuhr das Reich nicht übernehmen.
»Du und Riath habt Elkanasai gestürzt, weißt du nicht mehr? Wexmell wird euch nicht mehr helfen.«
Kaceys Wut über diese Intrige belebte seinen Geist und Körper für einen Moment wieder, er sah seinen Entführer angewidert an und dieses Mal traf seine Spucke. »Riath… wird… dich töten!«, zischte er mit ungehaltenem Hass, dann brach er erschöpft auf den Boden und musste wegen des Schwindels kurz die Augen schließen.
Völlig unbeeindruckt wischte Dainty den Speichel aus seinem Auge und streifte ihn an Kaceys lumpigen und zerrissenen Gewand ab. »Du bist so dumm, so voll mit falschem Stolz. Dabei geht es nicht nur um dein Leben, sondern auch um das deiner Anhänger.« Erneut beugte Dainty sich über Kacey, dann packte er sein Kinn und zerrte es zu sich herum. »Denk nach, tot nützt du niemanden etwas! Gib mir deine verdammte Macht, was auch immer sie ist, und lebe weiter, um das Dasein derjenigen nachhaltig zu schützen, die dir immer Treue entgegengebracht haben!« Er stieß Kaceys Kopf hart zur Seite und schnaubte verächtlich. »Wexmell würde es verstehen, das unterscheidet dich von einem wahren Herrscher.«
Kacey starrte mit brennendem Zorn in eine dunkle Ecke des Zimmers. »Er wird kommen«, flüsterte er als düsteres Versprechen vor sich hin. Und er sprach nicht von Wexmell.
Dainty schüttelte mit verdrehten Augen den Kopf über ihn, dann streckte er noch einmal die Hand aus und legte sie über Kaceys Stirn. »Du stirbst an diesem Fieber, du sturer Bock.«
»Ich sterbe lieber…«, hauchte Kacey kraftlos und doch entschlossen, »…statt… wieder… ein Sklave zu sein.«
Dainty schwieg einen Moment, dann wurde seine von Besessenheit angespannte Stimme ein wenig weicher. »Daher weht der Wind, hm? Doch Sklavenleben ist nicht gleich Sklavenleben, Kacey. Denk darüber nach. Stirb allein aus Trotz, oder lebe in dem Wissen, anderen eine Zukunft zu ermöglichen.«
»Keine Zukunft…«, flüsterte er zu sich selbst und schloss gequält die Augen, »…ohne Freiheit.«
Daintys Worte trafen ihn, das konnte er nicht leugnen. Sie sickerten in seinen Verstand und säten Zweifel. Er wollte jedoch nicht ins Wanken geraten, denn er wusste zu genau, dass Dainty ihn zu manipulieren versuchte. Denn selbst wenn er sein Wort hielt und Kacey durch seine Kapitulation die Gelegenheit bekam, Leben zu retten – Magier zu retten –, blieb er am Ende doch nur ein Sklave ohne Wort und ohne Willen. Außerdem ging es um mehr als um Leben und Zukunft, es ging um das Licht in seiner Aura. Er würde es nicht verkaufen wie eine billige Krone. Es ging um so viel mehr als um Menschenleben, das Licht war so kostbar und wertvoll wie die Existenz ihrer gesamten Welt. Vielleicht sogar noch wertvoller. Und das Überleben des Lichtes, ebenso seine Zukunft, hing von Kaceys Entscheidungen ab. Er trug die Verantwortung über dieses Licht, er würde es nicht verraten.
Es ging um mehr als um Elkanasai. Vermutlich hätte er sich Dainty gefügt, sich selbst verkauft und zum Sklaven gemacht, Melecay unterstützt, nur um das Leben seiner Magier zu retten. Doch das Licht hatte alles verändert. Es ging nur noch darum, Kaceys gesamte Welt drehte sich darum.
Und bevor er zuließ, dass es in falsche Finger geriet, würde er lieber mit ihm sterben, denn ihre Leben waren verknüpft.
Schützend legte er die Arme um das Licht und drehte sich auf die Seite, mit dem Rücken zu Dainty, der ihn durchbohrend anstarrte. Kacey zog die Beine an, die Kälte machte ihn steif, und das Fieber ließ ihn frösteln und schwitzen zugleich.
Kopfschüttelnd erhob Dainty sich wieder. »Du wirst nicht einfach sterben, dummes Prinzchen«, schwor er ihm und schnippte mit einem Finger, woraufhin sich die schwere Tür knarrend öffnete. »Mehr Felle und saubere Gewänder.«
»Jawohl, mein Prinz«, ertönte die ergebene Stimme eines Barbaren.
Noch einmal beugte Dainty sich zu Kaceys Ohr und flüsterte finster: »Doch ich werde dafür sorgen, dass du dir in jedem Augenblick, ob wach oder schlafend, wünschst, du würdest endlich sterben.«
Kacey zweifelte nicht daran und allein der Gedanke an weiteres Leid, ließen ihn eine qualvolle Erschöpfung verspüren. Er wollte weinen, riss ich aber zusammen.
Als Dainty ging, lag er noch immer zusammengekauert in der kalten Pfütze und hielt die Arme überkreuzt über der Brust. Er hatte stark sein wollen, aber seine Kräfte neigten sich dem Ende zu, er wollte nur noch weinen. Also blieb ihm am Ende nichts mehr anderes übrig, als so laut er konnte um Hilfe zu rufen. Nicht mit dem Mund natürlich, es hätte nichts gebracht, aber irgendwo dort draußen war der Mann, mit dem er verbunden war.
Der Mann, der es vermutlich als einziger vermochte, ihn aus dieser Lage zu befreien.
Denn, bei den Göttern, Kacey hatte nicht genug Stolz, es allein zu versuchen. Er würde von hier nicht aus eigener Kraft entkommen. Niemals. Er war gefangen und bis aufs Blut ausgeliefert.
»Riath!«, flüsterte er scharf und setzte all seine verbliebene Willenskraft in dieses Wort. »Carapuhr. Eisnacht.«