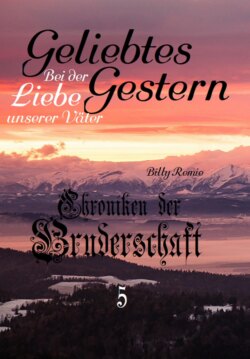Читать книгу Geliebtes Gestern - Billy Remie - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 9
ОглавлениеWährend draußen die Nacht hereinbrach und der Schnee eine leise, aber gefährliche Kälte über das Gebirge brachte, starrte Wexmell in die heißen Flammen des prasselnden Feuers im Kaminzimmer der Hohen Festung.
Er lehnte mit den Armen auf seinen Schenkeln und hielt einen halbvollen Kelch mit blutrotem Wein in den Händen, während er nachdenklich in die schillernde Glut blickte und Stunde um Stunde zusah, wie das Holz den Flammen zum Opfer fiel. Hin und wieder nahm er einen bedächtigen Schluck Wein.
Ein paar Kerzen standen verteilt auf Anrichten und dem Sims, doch die Dunkelheit holte sich in Form dichter Schatten den Großteil des Zimmers, nur Wexmell schien im Licht zu sitzen und zu grübeln.
Und wieder hatte er ein Kind zu beklagen, wieder ein Kind, das er nicht selbst zu Grabe tragen konnte. Erst May, die im Dschungel fiel und vor Ort von ihren Geschwistern verbrannt worden war, dann Sarsar, der noch in derselben Nacht, als May starb, spurlos verschwand, vermutlich tot. Und nun Eagle, sein erwachsener Sohn, sein einziger Nachkomme, der seinen eigenen Lenden entstammte. Wexmell hatte ihn nicht aufgezogen, seine Mutter – eine Verräterin an Nohva – hatte ihn hier auf dieser Festung versteckt, nachdem sie die Mauern samt der Armee verzaubert und jahrzehntelang versklavt hatte. Er hatte Eagle als jungen, idealistischen Mann kennengelernt, nicht als seinen Sohn, und auch wenn sie jahrelang versucht hatten, ein familiäres Verhältnis zu knüpfen, irgendwie war er doch immer weniger sein Sohn gewesen als Riath, Xaith, Sarsar oder Vaaks, die er als Söhne aufgezogen hatte.
Und doch saß er nun hier und spürte die gleiche Trauer, selbst in Angesicht der vergangenen Ereignisse. Es hatte Differenzen gegeben, das war nicht zu leugnen, Wexmell hatte dennoch immer gehofft, sie würden einen Weg finden, alles friedlich beizulegen. Auch wenn Eagle enttäuscht war, dass er scheinbar Derius` Söhne ihm vorgezogen hatte. Ihm – laut Eagles Worten – nicht vertraute, als er ihn vor Riaths Macht warnte.
Wexmell war nicht dumm, er hatte außerdem auf Derius´ Bauchgefühl vertraut, was Riath anging, so war er nicht blind. Der Junge war uneinsichtig und in vielen Dingen dachte er zuerst an sich selbst, was sein Rachedurst an Melecay bewies. Doch damit zeigte er auch, wer sein Vater war.
Nichtsdestotrotz hatte Wexmell nie öffentlich gemacht, wer sein Nachfolger werden würde, sollte er vorzeitig ableben. Es gab Vorkehrungen, ganz gewiss, er hatte genau wie Derius für alle Eventualitäten einen Plan in der Hinterhand. Doch er wäre naiv, seinen Nachfolger in die Welt hinauszutragen und zu riskieren, dass dieser noch vor seiner Krönung zur Zielscheibe würde.
Was Riath anging… den ließ man besser im Glauben, er bekomme, was er wollte, denn Wexmell würde sich bei allem, was zurzeit schieflief, nicht einen so mächtigen Feind machen, indem er Riath vor den Kopf stieß.
Abgesehen von Riaths magischen Fähigkeiten und seinen unberechenbaren Launen und fixen Ideen, folgte ihm halb Nohva. Das halbe Land war ihm treu ergeben. Wexmell hatte nicht den Fehler gemacht, Riath zu enterben. Natürlich war er schockiert und zutiefst enttäuscht – erschüttert – gewesen, als Riath ihm gebeichtet hatte, dass er Sarsar in den Trümmern des Turmes zurückgelassen, ihn sogar hineingestoßen hatte, aus Furcht, er könnte ihm die Krone stehlen. Wexmell hatte Riath weggeschickt, verbannt. Doch noch bevor er das Gebirge verlassen konnte, war Wexmell ihm nachgeritten und hatte ihn zurückgeholt.
Das war der falsche Weg. Riath hätte aus Wut das Land gespalten, das halbe Volk gegen Wexmell geführt, Melecay hätte sie leicht überrannt.
Wenn Riath in der Lage dazu war, seinen eigenen Bruder zu töten, war Wexmell absolut sicher, dass er noch zu viel mehr Morden imstande war, wenn man ihm keine Wahl ließ.
So gesehen hatte Wexmell zur Erbfrage niemals eine richtige Entscheidung öffentlich gemacht, das Volk und alle Verbündeten nahmen einfach an, Riath würde die Krone von ihm erhalten, sobald er alt genug wäre – und Wexmell hatte sie lediglich nicht aufgeklärt.
So erzürnte er zwar Eagle und Melecay, sorgte aber dafür, dass sein Volk keinen Grund hatte, gegeneinander zu rebellieren, weil sie darüber stritten, wem sie Treue schuldeten. Einem Airynn oder einem M`Shier.
Gequält schloss er die Augen und rieb sich mit einer Hand über das müde Gesicht. Ein Königreich zu führen war reichlich kompliziert und sein Kronrat hatte recht behalten. Als Diplomat und Berater war es leicht, den eigenen Idealen zu folgen. Als König konnte man die Welt aber nicht in schwarz und weiß betrachten.
Eagle hatte das gewusst, er war verdammt klug gewesen, aber nicht klug genug, sich vor Melecay zu schützen. Seine Angst vor unkontrollierbarer Magie hatte ihn blind für weltliche Gefahren gemacht.
Doch im Vergleich zu Melecay, war Riath im Moment noch ein Junge, grün hinter den Ohren und formbar, wenn man Geduld aufwies. Ein junger Hund, lernfähig und fähig zur Einsicht und Reue, was die Sache mit Sarsar bewies.
Melecay hingegen war wie ein alter, wilder Bär, dessen Instinkt zu Töten man niemals vergessen durfte; den man nie aus den Augen lassen durfte, denn wenn er Hunger bekam, schlug er zu und fraß alles auf, ohne einen Hauch von Schuldempfinden. Weil er es gewohnt war.
»Es ist nie leicht, einen Sohn zu überleben.«
Überrascht hob Wexmell den Kopf und richtete sich gleichzeitig in seinem gepolsterten Kaminsessel ein wenig auf, als er die sanfte und unaufdringliche Stimme vernahm. Aus den Schatten, die in Richtung Ausgang lagen, trat eine sehr kleine und zierliche Gestalt, die ein langes Kleid aus Schwanenfedern trug, das ihre flache Oberweite abschnürte. Sie lächelte äußerst zärtlich zurück und trat vorsichtig näher. Durch die Bewegung schwebte ihr schneeweißes, langes Haar um ihre dürre Taille. »Verzeiht, Eure Hoheit, ich wollte Euch nicht erschrecken noch Eure Gedanken unterbrechen, doch Ihr saht so tief versunken aus.«
Er lächelte milde. »Wie oft soll ich dir noch sagen, dass Förmlichkeiten unangebracht sind, Culina. Wir sind doch quasi eine Familie unter diesem Dach.«
Sarsars Mutter kam ins Licht und setzte sich ihm schräg gegenüber in den leeren Sessel, als er sie mit einer Geste dazu einlud.
»Das stimmt nicht so ganz, wir haben Euch und König Desiderius immer wohl gedient und euch beiden Kinder geschenkt«, warf sie mit Blick in die Flammen ein, »doch wir gehören nicht zur Hohen Familie. Das haben wir auch nie angestrebt.« Ein bitteres Lächeln legte sich über ihre feinen Gesichtszüge. »Nun ja, zumindest Seehna und ich nicht.« Dann blickte sie ihn mit ihren bodenlosen, stets schüchternen Augen entschuldigend an. »Was Kassins und Annaly getan haben, ist unverzeihlich und Verrat an unserem kleinen Zirkel gewesen, ich kann nur hoffen, dass Ihr das wisst.«
Wexmell lächelte erneut nachsichtig, nahm den Kelch in die andere Hand und streckte die freie Rechte aus, um Culinas zarte Finger zu drücken, die angespannt in ihrem Schoß lagen. »Ich weiß.«
Er vertraute ihr und ihrer Zirkelschwester Seehna blind, denn sie hatten ihm nie Grund dazu gegeben, es nicht zu tun. Stets waren sie loyal und hatten sich sogar bei der Erziehung ihrer Kinder im Hintergrund gehalten. Wie sie es versprochen hatten, hatten sie ihnen ihre Kinder geschenkt, sie gehörten Derius, dem leiblichen Vater, und Wexmell, dem Ziehvater. Sie, als Mütter, hatten auch ihre Rolle übernommen, doch sie hatten sich niemals als Elternteil gesehen. Nie. Kassins, Riaths Mutter, und Annaly, Xaith Mutter, hatten hingegen ihre Söhne zu Werkzeugen gemacht. Und das hatte die Kinder auf ihre ganz eigene Weise geprägt. Wexmell schalt sich dafür immer noch einen Dummkopf, er hätte es wissen und erkennen müssen, und eingreifen sollen, als es noch nicht zu spät gewesen war. Doch er und Derius waren zu sehr von sich selbst überzeugt gewesen, dass ihre Liebe, Zuneigung und auch liebevolle Strenge ausreichen würden, den Kindern das Beste mit auf den Weg zu geben.
Manchmal musste man eben noch genauer hinsehen, wenn es um das Wohl der eigenen Kinder ging.
Culina und er starrten gemeinsam ins Feuer. Er nippte an seinem Wein.
Die ruhige Hexe war ihm von allen schon immer die allerliebte Hexe gewesen. Trotz ihres doch mittlerweile höheren Alters hatte sie sich nicht verändert. Sie wirkte jung und knabenhaft für eine vollerblühte Frau, zerbrechlich und schüchtern, aber sie strahlte eine angenehme Ruhe und Weisheit aus.
»Es tut mir leid«, hörte er sich sagen.
Sie schaute ihn mitleidvoll und überrascht zugleich an.
Er lächelte freudlos über sich selbst, als er ihren Blick erwiderte. »Bei allem, was zurzeit geschah, habe ich vergessen, dass auch du und Seehna einen Verlust zu betrauern habt.«
Irritiert schüttelte sie leicht den Kopf, sodass ihre seidenglatte, schneeweiße Mähne nach vorne fiel. »Ich glaube nicht, dass er tot ist. Und Mays Tod… es ist schon so lange her, genau wie Ihr, lernten wir mit ihrem Fehlen weiterzuleben. Ich glaube sogar, dass ich fühle, dass es ihr gut geht.«
Sie streckte ihren Arm aus und drückte nun seine Hand.
Er starrte auf ihre Finger, dann sah er sie wieder an. »Ich meinte Kassins Hinrichtung«, gestand er.
Sie wirkte ein wenig schockiert und sah dann zurück in die Flammen.
Er lächelte wieder freudlos, hielt ihre Finger fest. »Auch wenn sie eine Verräterin war, sie war eure Schwester. Es ist ein Verlust. Und es tut mir aufrichtig leid.«
Culina starrte die Flammen an, die sich in ihren hellen Augen spiegelten. Er folgte ihrem Blick, als sie sich nicht rührte.
Eine Weile saßen sie so da und sagten nichts. Er hatte das Gefühl, dass sie sich an ihm festhielt, und er sich an ihr. Sie verstand seinen Schmerz und er den ihren.
Dann hörte er sie Atem schöpfen, eher sie zögerlich sprach. »Kassins und Annaly waren schon immer anders gewesen. Ja, wir haben sie geliebt, aber am Ende haben sie sich ihr Schicksal selbst zuzuschreiben.« Sie sah ihn bedauernd an. »Sie haben sich und uns verraten, indem sie mit Macht spielten. Annaly wollte, dass ihr Sohn der mächtigste unserer Kinder wird, und bezahlte mit dem Leben. Kassins nutzte ihren Sohn aus, um durch ihn an die Krone zu gelangen, sie wollte eine Marionette auf dem Thron, deren Fäden sie selbst zog. Auch sie starb den Tod, den sie sich selbst zuschrieb.«
Wexmell dachte über ihre Worte nach, wandte den Blick in die Flammen und trank einen Schluck. Ihre Augen lagen auf ihm.
»Ich frage mich dennoch«, gestand er erschöpft, »ob ich das Richtige tat, als ich sie-«
»Das habt Ihr«, unterbrach sie ihn und drückte seine Hand.
Er kam nicht umhin, zu lächeln. »Danke.« Er legte den Daumen über ihre Hand und zog Kreise auf ihrer dünnen Haut. Sein Lächeln wurde weicher, als er über sich selbst schmunzeln musste. »Manchmal ist es, als ob ich mit einer verlorenen Schwester spreche, wenn wir uns unterhalten.«
Ihre Miene verzog sich ebenfalls zu einem wohlwollenden Ausdruck. »Manchmal, ja…« Doch sie blickte plötzlich wieder ins Feuer und wirkte nachdenklich.
Neugierig legte er den Kopf schief und betrachtete ihr Profil. »Er hatte viel von dir.«
Sie wusste, wovon er sprach, und senkte den Kopf. »Ja«, ein trauriger, wehmütiger Schatten legte sich über ihr Antlitz. »Kam Euch das nie seltsam vor?«
Er zog die Stirn kraus. »Sollte es?«
Sie sah ihn an und wechselte abrupt das Thema: »Er ist nicht tot, Wexmell. Ich habe es Euch doch gesagt, so oft. Ich weiß, dass er noch irgendwo ist. Irgendwo. Ich würde es doch fühlen, wäre er tot.«
Ihre Worte waren nicht die einer von Trauer zerfressenen Frau, die mit ihren Gefühlen nicht mehr aushalten konnte und anfing, die Gegenwart zu leugnen, weil sie zu schmerzlich für sie war. Nein, sie sagte es ganz bedächtig und ruhig, wie ein alter, weiser Gelehrter. Sie wusste es.
»Wenn«, schwor er und drückte wieder ihre Hand, »finden wir ihn.«
Ihr Blick glitt zurück zu den Flammen, die Wärme des Feuers hatte ihre sonst blassen Wangen einen Hauch schimmernde Röte verliehen. »Hexen vererben eigentlich keine Abstammung, mein König, das wisst Ihr doch. Nur magische Fähigkeiten.«
Wexmell zog nachdenklich die goldblonden Augenbrauen zusammen. »Ja, ich weiß.« Natürlich wusste er das.
»Ihr wisst auch, dass wir durch einen Zauber und magische Phiolen den Samen des Königs in uns einpflanzten, um diese vier Kinder zu zeugen.« Sie sah ihn an. »Als wir das taten, vollzogen wir ein Ritual, das es erlaubt, unsere weltlichen Vererbungen weiterzugeben. Unsere Abstammung, nicht nur die magische, vor allem die sterbliche. Mit diesem Ritual stellten wir sicher, dass unsere Kinder das Blut des Königs in sich trugen, nicht nur die Gabe des Blutdrachens. Das weltliche Erbe war uns wichtiger als das magische. Es war unser Geschenk an das Große und Ganze, an das Schicksal, um die Ordnung auch nach dem Tod des Blutdrachenkönigs zu erhalten. Niemand sollte das Recht auf den Thron der Prinzen und der Prinzessin anzweifeln.«
Wexmell nickte langsam, denn er wusste nicht, worauf sie hinauswollte. All das war ihm selbstverständlich nicht unbekannt, Seehna hatte sie über alle Rituale informiert, es gab kein Geheimnis zwischen ihm und den Hexen, die in seinem Turm lebten. Zumindest hatte er das geglaubt.
Culina wich seinem Blick aus, sie wirkte schuldbewusst, doch gleichzeitig krallten sich ihre Fingerkuppen in seine Hand.
»Du kannst mir alles sagen«, hauchte er versprechend, »ich werde nicht wütend.«
Sie lächelte traurig. »Ich weiß.«
Er wusste nicht, wie er das deuten sollte.
Sie sah ihn an, bevor er etwas sagen konnte. »Wenn wir Sarsar finden, Wexmell, wird er noch mehr zur Zielscheibe als Riath oder Xaith«, sagte sie befürchtend, ihr Griff um seine Hand wurde verzweifelter. »Denn niemand hätte mehr Anrecht auf diese Krone als er.«
Wexmell schüttelte irritiert den Kopf und lehnte sich ihr entgegen, dabei stellte er den Kelch eilig auf den Tisch zwischen ihren Stühlen, und griff dann mit beiden Händen ihre Hand, die seine Finger beinahe zermalmte. »Ich verstehe nicht, was du meinst«, gestand er einfühlsam. »Wenn du mir etwas sagen möchtest, sprich frei heraus.«
Sie belächelte ihn schuldvoll.
Er bekam es mit der Angst zu tun.
»Ihr wisst, dass meine Mutter eine magisch begabte Dirne war«, erzählte sie und er nickte zögerlich. »Und ich erzählte Euch, ich würde nicht wissen, wer mein Vater sei.« Tränen traten in ihre Augen. »Das war eine Lüge.«
Wexmell runzelte die Stirn, sagte aber nichts dazu.
Sie atmete angespannt ein, hielt seinen Blick aber mit dem ihren fest. »Ich wurde gezeugt, bevor Euer Vater und Eure Familie von den Verrätern in der Kirche verbrannt wurden.«
Nach all den Jahren hätte er gedacht, dass ihn die Erwähnung der Ermordung seiner gesamten Familie keinen Stich mehr versetzte. Doch er hatte sich etwas vorgemacht, es war noch immer wie ein kalter Schock, wenn das Thema so unerwartet aufkam.
»Ein paar Monate nach diesem Ereignis kam ich zur Welt«, erklärte sie, »und wurde in das Chaos hineingeboren, in ein Land, das Hexen und Luzianer verfolgte. Meine Mutter floh mit mir im Bauch aus Dargard, bevor der König gestürzt wurde, sie stieß zu ihrem Zirkel, der sich an der Küste versteckte. Dort wurde zum ersten Mal das Ritual vollzogen, das auch wir Jahrzehnter später nutzten. Damals tat der Zirkel meiner Mutter es, damit ich das weltliche Erbe meines Vaters in mir trage, als ich geboren wurde. Sie versteckten mich von dort an bei sich, doch in den zwanzig Jahren Eurer Abwesenheit, wurden wir gejagt und hingerichtet, bis nur noch ich und drei weitere junge Hexen – Seehna, Kassins und Annaly – übrig waren. Auch wir wären beinahe den Verrätern zum Opfer gefallen, hätte König Desiderius uns nicht befreit.«
Wexmell schüttelte irritiert den Kopf. »Ich… weiß wirklich nicht…«
Tränen stiegen ihr wieder in die Augen, sie runzelte traurig ihre Stirn. »Meine Mutter war keine Dirne, sie war die Schwester eines Lords aus den Fruchtbaren Hügeln, mein König. Ihre Mutter und ihre Großmutter waren alles Hexen, die ihre Fähigkeiten vor den eigenen Männern versteckt hielten. Meine Mutter war ebenfalls eine Magiebegabte, die den eigenen Vater fürchten musste. Doch ihr größter Fehler hatte nichts mit Magie zu tun, oh nein, es war Liebe, die ihr gefährlich wurde.« Sie machte eine bedeutsame Pause, oder traute sich nicht, es auszusprechen. Einmal holte sie tief Luft, dann spuckte sie es aus: »Sie fiel in Ungnade, als sie sich eurem Bruder Zorrtan hingab.«
Wexmell starrte sie an, unfähig auch nur zu denken.
Sie versuchte, zu lächeln, doch es wirkte zerknirscht. »Damals war vieles anders, meine Eltern mussten ihre Liebe aus gesellschaftlichen Gründen verstecken. Es schickte sich nicht für meine Mutter, vor der Vermählung bei einem Mann zu liegen. Aber sie waren nun mal beide jung, und die Verlobung eures Bruders Karic war gerade erst bekannt, sie waren das Warten wohl leid. Außerdem war der Vater meiner Mutter ein Lord der Menschen und ein Verräter, er wollte sie nicht einem Luzianer zur Frau geben. Also hat Zorrtan sie nach Dargard geholt, für sie ein Zimmer gemietet und sie versteckt wie eine verschmähte Geliebte. Doch dann wurde sie schwanger und die Unruhen machten ihr Angst, denn sie war eine Hexe mitten im Brennpunkt, und sie fürchtete, ich könnte sie und mich verraten, wenn sie ihre Magie an mich weitergibt…«
»Also floh sie zu einem Zirkel«, schloss Wexmell mit tonloser Stimme wie gelähmt ab. »Und sie vertraute sich den Hexen an, die deine Abstammung bewahren wollten, weil sie-«
»Ahnten, wohin die Unruhen führten.« Sie nickte.
Wexmell konnte nicht aufhören, sie anzusehen.
Culina lächelte wieder mit Tränen in den Augen. »Es war vielleicht auch unsere Schuld, dass Kassins und Annaly glaubten, ihre Söhne anstacheln zu müssen. Sie wussten, dass mein Kind … dass Sarsar…mehr Anrecht auf diese Krone hat als ihre Kinder. Und beide sahen sich wohl in der Rolle der Mutterkönigin.«
Mit einem langsamen Kopfschütteln versuchte Wexmell, die Neuigkeiten zu verdauen. Er richtete sich auf und spürte, dass er den Speichel schluckte, der sich in seinem offenem Mund gesammelt hatte.
»Mein Vater war Euer Bruder«, dicke Tränen schimmerten auf ihren Augenlidern. »Ich bin Eure Nichte.«
Wexmell atmete aus, aber seine Brust fühlte sich eng an. »Und das bedeutet…, dass Sarsar … sowohl ein M`Shier… als auch ein Airynn ist.«
*~*~*
Es war der Ruf eines Drachen, der ihn weckte. Weit entfernt, irgendwo im tiefsten Dschungel, von den gegenüberliegenden Bergen her erscholl der dunkle Schrei so laut, dass er beinahe durch das halbe Land echote. Kraftvoll und animalisch vibrierte der Laut über seinen Leib und zupfte an seinen Saiten, um ihn aus dem erschöpften Schlaf zu wecken.
Es war Nacht, als er die Augen in seinem Käfig aufschlug. Fackelschein schimmerte hinter den Lederwänden der runden Zeltbehausungen, Rauchschwaden sickerten zusammen mit Essensgerüchen durch die winzigen Öffnungen der Dächer.
Die Tierwelt im Dschungel zirpte, schabte und raschelte. Gutturale Laute der Frauen drangen in die Dunkelheit, jemand lief auf dem sandigen Boden zwischen den Zelten und riesigen Dschungelbäumen Patrouille.
Und in der Ferne rief der Drache.
Sarsar rappelte sich auf, etwas zog an seinem Herzen und verlieh ihm ungeahnte Kraft.
Nachts, wenn es etwas kühler war, ging es ihm besser. Seine Aura zog jeden milden Lufthauch in sich auf, wie ein ausgetrockneter Fisch jeden Tropfen Wasser, und stärkte sich daran. Mehr denn je spürte er, dass er Kälte brauchte, um an Kraft zu gewinnen. Doch etwas war in dieser Nacht anders. Er wusste nicht, ob etwas Fremdes in der Luft lag, der Ruf des Drachen dafür verantwortlich war oder doch eher das deftige und nährstoffreiche Essen, das ihm überraschenderweise seit dem Morgen angereicht wurde; er fühlte sich nicht mehr, als ob er gleich sterben würde.
Er spürte förmlich, dass etwas im Busch war, das gesamte Lager schien von einem Nebel Glückseligkeit ummantelt. Als ob hier jeder durch eine Droge unter einem Rausch stand. Die Kriegerinnen waren fröhlich, das bekam auch er zu spüren. Doch trotz allem Argwohn, war er zu schwach, um das Essen abzulehnen. Er nahm alles, was er kriegen konnte, um an Kraft zu gewinnen, denn seit Wochen hatte er sich gefühlt, als würde er nicht mehr länger durchhalten. Zu heiß war es in der Hitze gewesen, zu nährstoffarm die karge Kost.
An diesem Tag ging es ihm besser, der Eintopf der Kriegerinnen hatte seinen Schwindel gedämpft, außerdem hatte es den ganzen Tag geregnet und erst am Abend war alles wieder getrocknet. Es war zwar unheimlich schwül und Schweiß klebte wie eine zweite Haut auf seinem Körper und Gesicht, aber es ging erstaunlicherweise stetig ein milder Wind.
Ungewöhnlich für den Dschungel, doch er hieß es willkommen.
Als er den Ruf des Drachen – und es war ein Ruf, das sagte ihm sein Herz – zum dritten Mal ertönte, richtete er sich auf. Erstaunlich war, dass niemand ihm auf die Finger schlug, als er das Bambusgitter umfasste, denn es war niemand da, der Wache bei ihm stand.
Das brachte ihm allerdings nichts, er war in Ketten gelegt und so erschöpft, dass er niemals genug Magie aufbringen könnte, um sich zu befreien, ohne sich dabei zu töten.
Er sah sich um und stellte nachdenklich fest, dass kaum eine Kriegerin Wache hielt. Irgendetwas ging in dem großen Gemeinschaftszelt vor sich, ein Fest oder eine Versammlung, er sah das viele flackernde Licht und die vielen zuckenden Schatten hinter den Wänden, Gelächter drang daraus in die Nacht, Gesang und dumpfe Trommelschläge.
Noch ein Ruf erklang und ließ ihn den Kopf in Richtung Dschungel drehen. Der Drache war so weit entfernt und der Ruf für die Ohren so leise, dass die Frauen ihn nicht hörten oder noch keine Gefahr witterten. Oft erscholl das Kreischen eines Drachen im Dschungel, oft näher als dieser es war. Doch irgendetwas an dem Ruf zog Sarsar magisch an. Als ob es ihm galt.
Und er war zu klug, um es nur als Hirngespinst abzutun.
Seine Ketten rasselten, als er wie ein Hund über den Boden seines Käfigs krabbelte und gen Osten blickte. Vor ihm lag nur von der Nacht dichtgeschwärzter Dschungel und irgendwo krauchte eine Raubkatze durch die Baumkronen. Er konnte so viel Lebensbahnen vor und um sich wahrnehmen, so viel mit seinem magischen Auge sehen und mit seiner Aura erahnen. Doch am meisten spürte er den Drachen, der so weit entfernt war, dass er weinen wollte.
»Hier«, flüsterte er heiser und umfasste die Bambusrohre mit den Händen. »Ich bin hier.«
Seine Stimme klang fremd, er hatte lange nicht mehr gesprochen, außerdem war seine Kehle rau und trocken.
Wieder rief der Drache, und Sarsar hauchte noch einmal: »Hier bin ich. Hier…« Er versuchte, seine Aura auszustrecken, versuchte mit aller Macht, an dem Seil zu ziehen, das ihn zu dem Drachen hinzog, doch er war zu schwach – oder wurde nicht erhört.
Der Ruf entfernte sich, verzweifelt und traurig.
Sarsar lehnte das Gesicht gegen den Bambus und seufzte, seine Hände fielen ermattet herab. »Ich bin doch hier…«
Der Drache entfernte sich weiter und weiter, bis der raschelnde Wind in den Baumkronen seinen Ruf endgültig übertönte.
Schritte auf dem sandigen Boden ließen ihn herumfahren. Im ersten Moment blinzelte er die dunkle Gestalt vor seinem Käfig nur an, bis sein Verstand erkannte, dass er einen alten Freund wiedersah.
»Was machst du hier?«, war alles, was Sarsar dazu einfiel, obwohl er vor Freude Tränen in den Augen und eine enge Kehle hatte.
»Die… ähm…« Chuseis Panterschwanz zuckte aufgeregt, als er hinter sich zu den beiden Kriegerinnen deutete, die Sarsar geflissentlich vor lauter Wiedersehensfreude ignorierte. »Ich soll übersetzen.«
Es war ihm gleich, weshalb sie den Halbpanter zu ihm geführt hatten. Chusei war seit seinem Leben als Sklave sein einziger Freund. Und Sarsar stellte fest, dass er vermutlich für niemanden so viel empfand wie für dieses Mischlingswesen aus Tiermensch und Mensch.
Als Sarsar sich in Bewegung setzte und zu ihm robbte, war es auch Chusei gleich, dass er bewacht wurde, er machte drei mutige Schritte auf den Käfig zu, sodass sie sich trafen. Niemand ermahnte sie, die zwei Frauen hinter ihm, die festlich bemalt waren und nur Röcke aus Blättern zu ihren geflochtenen Frisuren trugen, warteten mit unbewegten Mienen ab. Sie hatten nicht einmal Speere oder Bogen bei sich.
»Ich dachte schon, du wärest tot!« Sarsar lachte mit einer Mischung aus Freude und Erleichterung auf.
Chusei ging vor ihm in die Hocke und legte seine Finger um Sarsar verkrustete Knöchel, die tagtäglich mit Peitschen geschlagen wurden, wenn er die Bambusrohre anfasste, um sich hochzuziehen.
Sie hatten eben Furcht, dass er sie aufbrechen könnte.
»Witzig, das dachte ich auch von dir«, gab der Halbpanter zurück.
Sarsar lächelte, er konnte nicht anders, und lehnte das Gesicht an den Bambus, nur um seinem Freund nahe zu sein, der sich immer so gut um ihn gekümmert hatte. Ohne Chusei hätte er keinen Tag überlebt.
»Sag es schon, es war eine blöde Idee von mir, meine Kräfte zu offenbaren.«
Chusei konterte: »Es wäre nicht gerecht, dich zu bespucken, wenn du schon am Boden liegst.«
Sarsar lachte auf.
Doch als sein Freund nur kurz schmunzelte und dann bedauernd den Blick senkte, runzelte er besorgt die Stirn.
»Was ist los?«, fragte Sarsar mit belegter Stimme.
Chusei sah auf und ihm ins Gesicht. »Sie trägt ein Kind unter dem Herzen.«
Sie. Die Stammesführerin. Sarsar hatte ihren Zuchtsklaven heilen wollen, doch was dessen Männlichkeit beeinträchtigt hatte, waren keine körperlichen Beschwerden gewesen, sondern die einfache Tatsache, dass er bei Frauen nicht hart wurde. Das hatte Sarsar unfreiwillig geheilt und diente seither als Anschauungsobjekt, wenn der Sklave seine Herrin besteigen sollte.
Nun, da sie Früchte trug, wurde Sarsar nicht mehr gebraucht.
Er blickte Chusei ernst und tief an, seine Augen zuckten kurz zu den Frauen, die sie beobachteten, aber ihre Sprache nicht verstanden, dann sah er seinen Freund wieder an. »Du bist nicht hier, damit sie mich zurück in die Mienen bringen, befürchte ich.«
Der Halbpanter schüttelte langsam den Kopf.
Sarsar schluckte und fiel matt auf den Hintern. »Bringen sie mich fort?« Auch wenn er Chusei nur noch sehr selten sah, es hatte ihm Kraft gespendet, ihn in der Nähe zu wissen. Außerdem wollte er nicht als der magische Sklave einer Druidin enden, die ihm vielleicht seine Gaben aussaugte. Er trug eine Macht in sich, die er vor den Augen anderer Magiebegabter verstecken musste.
Ratlos hob Chusei die Schultern. »Davon weiß ich nichts, aber sie werden dich jetzt rausholen und waschen, damit du an der Zeremonie teilnehmen kannst. Ich soll dabei sein und dich beruhigen, du darfst dich nicht wehren.«
»Das sollst du mir sagen?«, fragte Sarsar bitter und eine Spur zu trotzig. Er hatte keine Kraft mehr und wollte nicht wieder dem ganzen Stamm ausgeliefert sein. Plötzlich kam ihm das Innere seines Käfigs so vertraut und sicher vor. Sein Zuhause, seine Festung. Es war so absurd.
»Es ist wichtig, dass du dich nicht wehrst«, betonte Chusei und zeigte echte Angst um Sarsar. Er packte die Bambusrohre und suchte drängend seinen Blick. »Das Fest nach der Empfängnis ist ihnen heilig, sie rufen Mutter Natur an, geben etwas zurück, belohnen den Sklaven – vielleicht ja auch dich! – und erbitten den Segen der Mutter. Sie sagen, ich soll dir erklären, dass sie mir die Kehle aufschneiden und mich opfern, wenn du nicht brav wie ein zahmes Hühnchen bist! Und wer weiß, vielleicht wirst ja auch du belohnt, du hast geholfen!«
Sarsar bezweifelte, dass sie ihn belohnen würden. Doch dann dachte er an das Essen, das er den ganzen Tag gereicht bekommen hatte, und wurde unsicher.
»Wenn du dieses heilige Ritual störst, werden sie dir bei lebendigem Leibe die Haut abziehen, und das ist keine dramatische Redewendung, mein Freund!«
Sarsar sah Chusei an, sie schauten sich in die Augen und kommunizierten.
Die Frauen wurden ungeduldig und traten vor, traten Chusei auffordernd gegen die Schenkel.
Notgedrungen erhob sich der Halbpanter, der an den Füßen mit einer langen Kette zusammengebunden war, genau wie Sarsar. »Wehr dich bitte nicht, um unser beider Willen«, flehte Chusei ihn an. »Ich bin sicher, es passiert nichts Schlimmes, in Ordnung?«
Sarsar hätte sich nicht einmal wehren können, hätte er gewollt. Aber er wollte seinem Freund auch keinen Kummer bereiten, er war nicht so naiv, sich zu wehren, wenn es sinnlos war.
Sie öffneten seinen Käfig, packten seine Fußkette und zogen ihn grob heraus, sodass er hart auf dem Boden landete. Er beschwerte sich nicht.
Dann wurde er durch einen Seitenschlitz ins Festzelt geführt, gefolgt von Chusei, der immer die direkten und knappen Anweisungen der Frauen übersetzte.
Nicht bewegen. Hände ruhig halten, sonst schnitten sie ihm die Finger ab.
Es war nicht so, dass er die Frauenstämme als besonders grausam beschrieben hätte, sie waren nicht von Grund auf böse. Ganz im Gegenteil, er lebte in ihrer Mitte und sah deutlich, dass sie ein friedliches Volk waren, das Nachbarstämme empfing und Reisende mit offenen Armen aufnahm, sie waren liebevoll und loyal untereinander, sogar diplomatischer als manches Königreich. Sie waren nicht tyrannisch, das nicht. Aber sie hatten Jahrhunderte lang gelernt, Männer zu versklaven, ganz gleich welcher Herkunft. Für sie waren Männer nutzlos, bis auf die Fortpflanzung. Männer bedeuteten Unruhe und Unterdrückung, deshalb mussten sie in Ketten gelegt werden. Dahinter verbarg sich weniger Grausamkeit, als man glaubte. Die Stämme kannten es einfach nicht anders, seit Jahrhunderten sahen sie Männer nur als eine Art Nutzvieh. Männer waren in ihren Augen nicht fähig, zu denken oder zu lernen.
Vielleicht hatten sie damit sogar nicht ganz unrecht, dachte Sarsar ein ums andere Mal.
Sarsar wurde in einem kleinen Zwischenraum von seinen Ketten befreit. Der rostige Stahl fiel zu Boden und Chusei übersetzte ihm die Anweisung, dass er sich bloß keine Zuckung erlauben durfte.
Der Gesang und die Trommeln waren hier lauter und er roch köstliches Essen und das, was man in seiner Heimat Spuckbier nannte.
Sie übergossen ihn mit lauwarmen Wasser, er zuckte trotzdem zusammen, dann schrubbten sie ihn grob ab und ließen dabei keine Ritze aus. Sie taten es eigenhändig, überließen keinem Sklaven diese wichtige Aufgabe, als trauten sie Männern keine angemessene Reinigung zu.
Sie schubsten ihn nach vorne und er konnte sich gerade noch an einem Tisch abfangen, dann wuschen sie auch den Rest von ihm. Nachdem sie ihn abgetrocknet hatten, bemalten sie ihn mit Farbe, die nach Schlamm roch, bis Kreise und Wellenlinien seinen Körper zierten. Knochenketten wurden um seinen Hals gelegt, bunte Federn in sein schneeweißes Haar geflochten.
Nackt, bemalt und nur mit etwas Schmuck behangen, führten sie in das Hauptzelt.
Es war überfüllt, genau wie bei dem letzten Mal, als er mit Chusei hereingeführt worden war. Gesellig saßen sie auf Fellen und Leder auf dem Boden um Erdöfen herum, tranken aus Ton- und Hornbechern, alle halbnackt, bemalt und festlich geschmückt. Auf einer kleinen Empore saß die Stammesführerin, eine kraftvolle Frau, die stolz in ihrem Thron aus Holzästen und Knochen hing. Ihr muskulöser Bauch war mit einer großen, weißen Spirale verziert. Neben ihr stand geschmückt wie ein Tier der Zuchthengst und starrte unbeteiligt geradeaus.
Niemand kümmerte sich um Sarsars Ankunft.
»Tu mir einen Gefallen«, sagte er zu Chusei. Sein Freund sah ihn an. »Bitte schau nicht zu.«
Der Halbpanter runzelte irritiert die Stirn.
Sarsar wagte nicht, seinen Blick zu erwidern. »Bewahre mir meine Würde und sei du der Einzige, der gleich nicht hinsieht.«
»Was meinst du?«
Er hatte wirklich keine Ahnung, doch Sarsar wusste instinktiv, dass er nicht belohnt wurde. Nein, er würde die Belohnung sein.
Tja, er hatte es die ganze Zeit erwartet, er hatte nur nicht gedacht, dass es ihn trotzdem so kalt erwischte und er sich wie gelähmt fühlte. Er wollte wegrennen, doch seine Füße waren wieder zusammengebunden und ließen nur kleine Schritte zu. Außerdem käme er nicht einmal aus dem Zelt heraus und würde somit seines und Chuseis Schicksal besiegeln. Denn ja, das hier sah wirklich wie eine heilige Feier aus.
Die Stammesführerin erhob sich, als sie ihn entdeckte und ein Zeichen an ihre Kriegerinnen gab. Der Gesang verstummte kurz, doch die Trommeln wurden weitergespielt. Während sie redete und die Frauen hin und wieder zustimmend dazwischenriefen, stießen sie Sarsar in den Rücken, so lange bis er in der Mitte des Zeltes vor dem Thron der Stammesführerin stand. Vor sich auf dem Boden sah er einen aufgetürmten Strohhaufen, darüber lag eine grobe Decke mit Stickmustern.
Ihm wurde es weich in den Knien.
Der Jubel in dem Zelt schwoll an, als der Zuchthengst herabgeführt wurde. Er sah unbeeindruckt aus.
Sarsar sah ihn geflissentlich nicht an.
Ja, er war die Belohnung. Er schloss die Augen.
Die Stammesführerin beendete ihre Rede mit erhobener Stimme und Becher, die Kriegerinnen klatschten und bespritzten Sarsar und den Zuchthengst mit ihren Getränken.
Sarsar zog die Schulter angewidert hoch, um sein Gesicht zu schützen.
Der Jubel klang nun drängend, sie blickten alle zu ihnen in die Mitte.
Er versuchte, nur die Decke anzustarren, die vor ihm lag. In diesem Moment wusste er endgültig, dass er ein Sklave war. Auch wenn er stets die Hoffnung gehegt hatte, jemand würde ihn finden, immerhin war er ein Prinz und Sohn des Blutdrachen. Sein Vater würde ihn gewiss suchen!
Doch er machte sich etwas vor, er war kein Prinz mehr, er war kein Sohn mehr, er war ein Nichts. Er war ein Sklave. Er war Vieh. Und er gehörte jetzt diesen Frauen, ganz und gar.
Als ihn etwas am Ellenbogen berührte, fuhr er dennoch herum und starrte dem Sklaven hasserfüllt in sein goldenes Antlitz. Schwarze Wimpern umrandeten braune Augen, die ihn voller Bedauern ansahen und um Entschuldigung baten. Der Sklave tat auch nur, was von ihm erwartet wurde. Sarsar wusste das. All die Monate hatte dieser Zuchthengst ihn nicht angerührt, obwohl er die Erlaubnis dazu gehabt hätte. Er hatte Sarsar geschützt. Das hier war nicht seinem Willen entsprungen, er musste sich fügen, genau wie Sarsar.
Und doch konnte er in diesem Moment für niemanden so viel Hass aufbringen wie für den Mann, der vor ihm stand. Sie beide saßen im einen Boot, dennoch war er derjenige für Sarsar, dem all sein Hass und all seine Abscheu gehörten. Er wünschte, er hätte ihn zu Eis verwandeln können.
Wieder fasste der Sklave ihn am Arm, ganz behutsam und sachte. Sarsar durchbohrte ihn mit angewiderten Blicken aus seinen schneeweißen Augen, doch er ließ zu, dass der Kerl ihn umdrehte und sanft nach vorne beugte. Er ließ zu, dass sein Oberkörper auf den mit einer Decke bedeckten Haufen Stroh gebeugt wurde, zur Unterhaltung der Frauen, die sie anfeuerten.
Entschuldigend und vorsichtig berührte der Sklave ihn, packte ihn an seiner schmalen Hüte mit seinen großen Pranken, goldene Haut auf elfenbeinfarbener Haut. Sarsar biss die Zähne zusammen, in seiner Brust lag ein verzweifeltes Brüllen, das er mühsam unterdrückte.
Er entdeckte Chusei, der seine Zehenspitzen anstarrte, aber aschfahl und schuldbewusst aussah.
Nein, dachte Sarsar, es war nicht Chuseis Schuld, sie hatten ihm schließlich nichts gesagt. Aus gutem Grund. Und Sarsar war so unheimlich froh, dass er ihn nicht ansah.
Er drehte den Kopf auf die andere Seite, um im Gegenzug ihn auch nicht sehen zu müssen. Er redete sich ein, wenn nur die Frauen hier waren, würde es gar nicht wirklich passieren.
Immerhin gaben sie ihnen Öl, aber Sarsar hasste es, die vielen Frauenhände zu spüren, die sie beide einsalbten. Gegröle wurde laut, die Stimmung im Zelt knisterte freudig. Und er lag dort halb stehend, halb gekrümmt auf einem stinkendem Haufen Stroh und etwas zerbrach in ihm.
Der Zuchthengst beugte sich über ihn, ein einziges Wort kam ihm über die Lippen rau und heiser, als hätte er seit Jahren nicht gesprochen. Er kannte Sarsars Sprache nicht, nutzte nur das Wort, das er dafür kannte. Doch Sarsar wusste, was es in seiner Sprache hieß: »Es tut mir leid.«
Leider fühlte es sich überhaupt nicht so an, als könnte er jemals vergessen, was in diesem Moment geschah. Ganz im Gegenteil, es war ein heißes Zerreißen und Brennen, das er niemals vergessen würde, obwohl der Sklave sich bemühte, ihm nicht wehzutun. Doch es schmerzte, körperlich, seelisch, in jedweder Weiser, wie etwas schmerzen konnte. Tränen brannten in seinen Augen, aus Verzweiflung und noch mehr aus Wut.
Ein Glassplitter, tief in der Seele, der eine Wunde riss, die nicht so schnell heilen würde.
Und während er es über sich ergehen ließ, dachte Sarsar bei jedem Stoß, bei jedem reißenden Schmerz: Ich. Bin. Ein. Sklave.