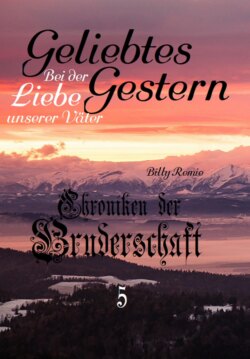Читать книгу Geliebtes Gestern - Billy Remie - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 3
ОглавлениеEine weitere Woge prickelte heiß durch seinen Körper, zog seinen Unterleib pulsierend zusammen und schoss ihm in die Lenden. Heiseres Keuchen traf den Schaft seines Meisters, teils aus Seligkeit, teils aus Leid.
Dass Lust so schmerzen konnte, hätte er niemals erwartet. Dass das warme und leicht kribbelnde Gefühl, das ihn so oft in Hochschwingungen versetzt hatte, ihm solch ein Leid verursachen konnte...
Sein Geschlecht stand zwischen seinen Schenkeln aufrecht wie ein Fahnenmast, es war so felsenhart, dass es tatsächlich schmerzte. Es tropfte, es zuckte und es pochte wie eine Verletzung, die nach Linderung lechzte. Als ob ein Hammer darauf geschlagen und gleich darauf ein hübscher Knecht es zärtlich geküsst hätte. Doch jede Berührung machte es nur schlimmer, als ob es einfach zerbersten würde, wenn nur ein Lufthauch darauf traf.
Es war schrecklich, weil er sich gleichzeitig anfassen und auch nicht anfassen wollte. Sein Geschlecht reiben und nicht reiben wollte.
Und die Wogen, oh diese heißen Wogen, die seinen Leib immer und immer wieder erfassten wie Schüttelfrost bei einem schlimmen Fieber. Er wollte keine Lust empfinden, aber es interessierten seinen Geist und Körper nicht, was er wollte. Die Lust war da und blieb stundenlang, ließ ihn keuchen und stöhnen, sich Erleichterung wünschen und ein Ende von allem, doch es wurde nur schlimmer. Immer schlimmer. Als ob sein ganzer Körper juckte, er aber nicht kratzen konnte, weil es nicht auf, sondern unter der Haut kitzelte.
Sein Atem ging schwer, seine Wange war längst erschöpft auf den nackten Schenkel gesunken. Seidige, klebrige Haut fuhr über seine Lippen und ließ erneut eine heiße Welle durch ihn schwappen und ihn unwillkürlich aufbäumen.
Er öffnete den Mund, leckte weiter die Härte seines Widersachers und spürte mit jedem Zungenstrich, wie sein eigenes Geschlecht wilder und stärker pochte.
Je mehr er den anderen verwöhnte, je mehr eigene Lust prickelte durch ihn, als ob es für ihn das höchste und schönste Gefühl der Welt wäre, den anderen zu verwöhnen. Wie ein Sklave, wie ein Hund, der nur glücklich war, wenn er seinen Herrn glücklich machen konnte.
Er wusste, dass er das nicht tun wollte und er versuchte, sich zu wehren, doch immer wieder sah er sich selbst das Gesicht strecken und gierig wie eine Hafenhure nach dem nassen Geschlecht seines Meisters lechzen, wimmern und stöhnen. Er wollte es nicht, aber er brauchte es. Konnte nicht aufhören, obwohl er es wollte. War im Rausch und süchtig nach Erlösung. Warm prickelte sein Körper, sein Unterleib zog sich genüsslich zusammen. Je mehr Lust er dem Meister bereitete, je mehr Erleichterung empfand er. Als wäre seine Lust an die Freuden des anderen Mannes gebunden.
Hinter ihm knisterte ein heißes Feuer im Kamin, unter ihm befand sich das weichste aller Felle auf der bekannten Welt. Der Meister saß auf der Kante eines breiten Bettes, ebenfalls auf Fellen, einen Fuß auf dem Boden und den anderen auf die Kante gestützt.
Er kniete dazwischen, die Fuß- und Handgelenke mit feinen, goldenen Ketten verbunden. Gefesselt, ausgeliefert. Die dauerhafte Lust machte ihn zu einem sabbernden Stück Fleisch, das den Kopf auf den warmen Schenkel des Meisters gebettet hatte, der ihm zärtlich und loben durch das Haar kämmte.
»Siehst du, es gefällt dir«, raunte er ihm zu und streichelte weiter. »Es muss doch gar nicht schlimm sein. Es kann so schön, so angenehm für uns beide sein. Du hast ein Bett, ein Haus, ein Feuer und wir könnten so viel Freude miteinander haben. Ich möchte dich so gern verwöhnen, mit leckeren Speisen und einem Zimmer aus purem Gold und Samt, mein schönes, kostbares Haustierchen!«
Wie flüssiger Honig tröpfelten die Worte süß und zäh in sein Ohr, das liebevoll umfasst und zwischen zwei zarten Fingerkuppen gerieben wurde.
»Es gefällt dir, mich zu verwöhnen.« Der Meister hob den Fuß vom Fell und drückte ihn gegen die Härte seines Sklaven, dem ein heißer Blitz durch den Schaft schoss. Er stöhnte auf das Geschlecht seines Herrn, vor Leid und Lust zugleich.
»Gut so, lass es zu, zeig mir deinen Schmerz und deine Lust. Schau, wie sehr es dir gefällt. Du kannst es immer haben, wenn du dich mir öffnest.«
Zwei Zehen nahmen die tropfende, violett angelaufene Eichel zwischen sich und rieben die klebrige Feuchte über die seidene Haut, sodass eine weitere Woge ihn erfasste und seine Beine unkontrolliert zum Zittern brachte. Er glaubte, zerbersten zu müssen wie eine Glasscheibe, die von einer magischen Druckwelle erfasst wurde. Auch er konnte der Berührung nicht standhalten, dem Sturm der Lust nicht entkommen, er wurde fortgetragen von der Gier und dem Rausch.
»Leck mich, bis ich deine göttlichen Lippen mit meinem Saft besudle«, raunte der Meister rau vor Genuss, »und sieh zu, wie auch du vor Glück kommst, weil du mir Freude bereitest.«
Etwas an diesem Gedanken störte ihn, oder der Meister ließ vor lauter Lust die Leinen etwas lockerer. Was es auch war, er spürte plötzlich mit einer ohnmächtigen Wut, wie sich sein Geist von dem Rausch losriss und sich aufbäumte.
»Neeeiiiiin!«, knurrte er und riss sich los. »Raus aus meinem Kopf!« Die Wucht seiner Gegenwehr warf ihn auf den Rücken, er konnte die geistigen Ketten reißen hören, als er seine Gedanken befreite. Hart kam er auf kaltem und nacktem Gestein auf. Das heimelige Schimmern des Feuers verschwand einem kühlen, silbrigen Licht, das durch schmutzige Fenster in ein karges und trostloses Turmzimmer fiel.
Kacey warf sich herum und hievte sich schwer keuchend auf die Ellenbogen. Der harte Stein war eiskalt und auch ein wenig feucht durch den Schnee, der draußen unentwegt fiel. »Raus aus meinem Kopf!«, wiederholte er atemlos und blinzelte.
Beinahe war er froh, kein gemütliches Schlafgemach samt weicher Felle und warmen Kaminfeuer zu sehen, sondern nur das dunkle und kahle Zimmer, in dem er seit Wochen eingesperrt war. Keine physischen Fesseln ketteten ihn an, aber die magischen Runen leuchteten auf seinen Handgelenken und sperrten noch immer seine Magie in sich ein.
Ein leises Lachen erklang so düster wie die finstere Ecke, aus der es ertönte.
Kacey hob noch immer keuchend den Kopf, der Zauber sickerte aus seinen Schläfen, als ob jemand langsam zwei Nadeln aus seinem Schädel zog. Er blinzelte, bis er klarsehen konnte.
Dainty hob den Fuß vom Knie und lehnte sich nach vorne, eine Kerze flammte auf und beleuchtete sein langes, hübsches Gesicht. Er saß auf einem alten Holzstuhl an einem Tisch nahe der eisenverstärkten Tür. Sein dunkles Haar war zu seinem langen Zopf geflochten, er hatte den Verband abgelegt und die Kerze gab die Narben unter seinem angenähten, spitzen Ohr preis. Er war gehüllt in weiße und hellbraune Wolle und seinem weißen Fuchsmantel, dazu trug er Stiefel aus weichem Leder, die ihm lautloses Schleichen ermöglichten.
»Hör auf damit«, sagte Kacey keuchend zu ihm. »Bleib aus meinem Kopf draußen.«
»Aber würde es dir nicht gefallen«, säuselte er und grinste gehässig. »Nach all den Wochen, weigerst du dich noch immer, ein warmes Bett und ein knisterndes Feuer anzunehmen, um dich zu wärmen und auszuruhen. Stell es dir vor, spürst du nicht schon die Hitze auf deiner Haut prickeln? Wie wäre es mit einem schönen, heißen Bad und einem warmen Met?«
Kacey nahm all seine Kraft zusammen, zog einen Schleimklumpen seinen Hals hinauf und spie in Daintys Richtung aus. Natürlich war er viel zu weit entfernt, aber die Botschaft kam trotzdem an. »Fick dich.«
Dainty lachte nur in sich hinein. »Deine Sturheit bringt dich noch um.«
Erschöpft sank Kacey auf dem Boden zusammen, er rollte sich mit dem Rücken auf den kalten Stein. Es gab hier drinnen weder ein Bett noch ein Kissen oder eine Decke. Nur am hintersten Rand des Zimmers lag etwas Stroh, ansonsten besaß er nur einen Tisch und den Stuhl. Kalte Luft zog durch ein Loch im Boden in den Raum, das für seine Notdurft gedacht war. Er hatte versucht, durch es zu entkommen, doch es war vergittert und gerade groß genug, den Kopf reinzustecken. Er hatte aus dem Fenster springen wollen, doch sie gingen nicht auf, und selbst wenn es ihm gleich wäre und er durch das Glas brechen wollen würde, ging es mehrere tausend Fuß – oder sogar mehr – tief in einen Abgrund voller scharfer Felsen. Er wusste nicht, ob seine Magie – falls sie trotz Bannfesseln überhaupt dazu in der Lage war – ihn schnell genug zusammenflicken würde, um dann noch aufzustehen und den Drachen zu entkommen, die unentwegt kreischend und brüllend um die Burg kreisten.
Unsterblichkeit endete im Magen eines Drachen, so viel war ihm bewusst.
Es gab kein Entkommen von Eisnacht, die Burg lag zu hoch auf einem Berg, das winterliche Wetter an Carapuhrs Grenze war zu rau, die Drachen zu hungrig.
Ein Schatten fiel auf Kacey und er blinzelte.
Dainty warf seinen Umhang über die rechte Schulter nach hinten und ging neben ihm in die Hocke. »Du könntest es wirklich guthaben, kleiner Schönling«, säuselte er, »ich will nur, dass du mir gibst, was auch immer das da ist.« Er hob eine Hand und tippte Kacey auf die Mitte seiner Brust.
Das Licht, das dort in seiner Aura schimmerte, zog sich ängstlich zurück. Wütend schlug Kacey die Hand des dreckigen Assassinen zur Seite und bedeckte das Licht mit beiden Händen.
Dainty lächelte auf ihn herab, die Gelassenheit in Person. »Ich habe Zeit und ich werde herausfinden, was es ist und wie ich es bekommen kann.« Er tätschelte Kaceys Wange, strich zärtlich mit dem Daumen darüber, beinahe väterlich. »Irgendwann brichst du, ich sehe deine Aura schon täglich schwächer leuchten. Irgendwann wirst du einknicken, das wissen wir beide. Weil du deine Kraft verlierst und langsam und qualvoll verwelkst.« Er lächelte zufrieden. »Und ich muss nur hier sitzen und warten, während ich dir dabei zusehe.«
Damit stand er auf und ging lautlos zur Tür. Kacey machte sich nicht die Mühe, ihm nachzublicken, er schloss gequält die Augen und versuchte, gegen seine aufkommende Übelkeit anzukämpfen.
Dainty hatte recht, er verblasste und mit ihm seine Aura und das Licht, das von der Macht seiner Aura zehrte. Solange seine Kräfte durch die Fesseln gebannt waren, würden sein Körper und Geist angreifbar sein. Seine Magie sickerte durch ihn hindurch wie Wasser durch ein Sieb. Die Kälte, die er weder gewöhnt war noch vertrug, hatte ihn sofort krank gemacht. Und er konnte nicht gesunden. Die eingesperrte Magie kämpfte dagegen an, doch auch sie war nicht so erfolgreich, wie sie es sein sollte, seit Kacey diese Fesseln trug. Er war geschwächt, in jeder Hinsicht. Er brauchte wirklich ein Feuer und ein weiches Bett, um sich zu erholen. Das Fieber machte ihn so schwach wie ein ausgedörrter Wal, der an einer Küste gestrandet war.
Aber er würde lieber sterben, als Dainty das Licht zu überlassen – oder auch nur seine Würde.