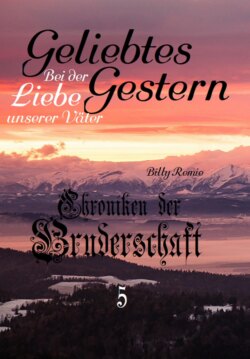Читать книгу Geliebtes Gestern - Billy Remie - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1
ОглавлениеDie dunklen Wellen brachen sich an den scharfen Klippen unterhalb der gewaltigen Festung, die genau an der Kante des Gebirges lag und vom Weiten aussah, als drohte sie jeden Augenblick wegzubrechen und im dunklen Gewässer des Tobenden Meeres für immer zu verschwinden.
Die Gischt spritzte bis zu den schwarzen Eisengeländern der Treppen, die sich wie eine Serpentine an der Klippenwand entlang schlängelten und von der Burg hinab in eine unruhige, verborgene Bucht führten, wo stets drei winzige Boote vertäut waren, falls die königliche Familie fliehen musste.
Auf dieser Seite der Anlage hatte die Öffentlichkeit keinen Zutritt, die Gärten und die Rückwand waren für das einfache Volk der Unteren Stadt nicht zugänglich, auch keine Bediensteten kamen hierher, es war ein einsames Fleckchen, denn an den Klippen wehte stets ein rauer Wind und die Luft schmeckte nach dem Salz der See. Bis auf ein paar wenige Blumen gab es keine Pflanzen und somit auch kein Grün. Die Aussicht erstreckte sich über eine unruhige See, und die Treppen waren direkt ins karge Gestein gehauen, mehr als schwarze Wellen und grauer Felsen gab es hier nicht zu sehen. Und doch war es der Ort, an dem er ihn immer und immer wieder gefunden hatte, wenn ihm selbst der verschlungene und blühende Obstgarten mit seinen wilden Kaninchen zu überlaufen gewesen war.
Der Wind riss an schwarzem Haar und einem schwarzen Umhang, als Wexmell die Stufen hinabstieg und sich neben ihn stellte, den Blick über das Meer zum nördlichen Horizont gerichtet. Sie sahen beide dorthin, die Gesichter kritisch und angespannt.
»Der Nebel verdichtet sich«, sagte Wexmell in den kreischenden Wind hinein und besah die weißen und dichten Schwaden, die über der See hingen und wie Geister langsam dem Land entgegenkrochen. »Ein Sturm zieht auf.«
»Wir haben schon viele Stürme überdauert«, erwiderte der Mann neben ihm mit verschränkten Armen und entschlossener Miene, »wir überdauern auch diesen, Wex.«
»Ich werde unsere Heimat – unsere Krone! – niemals aufgeben«, sagte Wexmell mit Grimm und Stärke in der Stimme. »Ich werde ihnen nichts je einfach so überlassen. Sie werden mir unsere Krone aus den kalten und toten Händen reißen müssen, wenn sie sie haben wollen.« Er spürte Derius´ Blick auf seinem Profil und wandte ihm das Gesicht zu, er musste zu ihm aufsehen. Erregt atmete aus. »Wir haben so lange hierfür gekämpft und so viel dafür geopfert und verloren, ich werde ihnen unsere Krone und unsere Freiheit nicht verkaufen, ganz gleich wie viel Druck sie auf mich ausüben.«
Ein milder Ausdruck machte Derius´ sonst so granitharten Züge weich, er wirkte auf einmal so jung wie damals, als sie sich das erste Mal begegnet waren. »Nein, wir werden ihnen nichts schenken, Wex. Was sie auch für einen Sturm auf uns loslassen, Nohva wird standhalten. Das haben wir doch immer. Vor allem mit dir als König.«
»Ich habe keine Furcht vor ihnen.« Wexmell musste den Blick abwenden, sein Herz zog sich schmerzlich zusammen. Tastend wanderten seine eisblauen Augen über die schwarzen Wellen und ihre weißen Schaumkronen. »Obgleich ich eingestehe, angespannt zu sein und mich darüber zu sorgen, ob das Gerede über mich vielleicht wahr ist. Möglicherweise bin ich zu naiv und darüber hinaus zu eigensinnig, mich weiterzuentwickeln.«
»Ich würde gar nicht wollen, dass du dich veränderst, dann wärest du nicht mehr du«, flüsterte Derius liebevoll. Er hob eine Hand und legte sie zärtlich in Wexmells Nacken, wo sich goldene Locken um seine Fingerspitzen schlängelten. »Warum solltest du dich weiterentwickeln, wenn du so, wie du immer warst, das Beste für alle bietest? Wex, ich wählte dich zum König, weil ich niemanden sonst mehr vertraue als dir. Als der, der du immer warst, nicht der, den andere gerne sehen würden.«
Wexmell sank in sich zusammen und seufzte dankbar. Mit geschlossenen Augen drehte er das Gesicht, sodass Derius` große Hand an seine Wange rutschte und er sich sehnsüchtig hineinschmiegen konnte. Er konnte sogar den Hauch von Wärme und Stärke fühlen, die seinen Geliebten immer umgeben hatten. »Du fehlst mir so«, raunte er schmerzlich.
Derius wandte sich ihm gänzlich zu und zog ihn sanft in seine Arme, eine Hand auf Wexmells Hinterkopf und eine auf seinem Rücken, hielt ihn fest und gab ihm den Halt, den er brauchte.
Tief inhalierte Wexmell den vertrauten Duft nach Mann, Leder und herber Würzigkeit, schmiegte die Wange an den schwarzen Brustharnisch und verlor sich in seinen Armen.
»Ich bin da.« Derius` Atem strich heiß über Wexmells Haar, dann spürte er die Lippen seines Geliebten an der Schläfe und kämpfte mit Tränen der Trauer und der Erleichterung. »Ich werde dich nie verlassen, Wex. Vor allem nicht in dunklen Stunden.«
»Ich weiß«, gab er mit erstickter Stimme zurück und legte die Hände auf Derius` Rücken, um sich festzukrallen. »Ich wünschte nur so sehr, du wärest es wirklich.«
Er spürte Derius` Lächeln an der Schläfe, liebevoll strich er ihm über den Hinterkopf. »Wer sagt, dass ich es nicht wirklich bin, Geliebter?«
Wexmell schmunzelte und hielt ihn noch fester, Geborgenheit umhüllte ihn wie ein warmer Sonnenschein, doch er wusste leider zu gut, dass der Abschied nahte.
Ein Rabe krächzte, und als er deshalb die Augen öffnete, sah er sein auf die Seite gekipptes Schlafgemach, statt der unruhigen See.
Blinzelnd ließ er den Traum los. Am Anfang war es ihm noch schwergefallen, Derius` zurückzulassen, und er hatte krampfhaft versucht, erneut einzuschlafen, da er nicht mit Sicherheit wusste, wann er ihn wieder im Traum sehen würde. Doch mittlerweile wusste er, dass das wahre Leben wartete, und er hatte genug Pflichten, die ihn aus den Laken trieben.
Es waren Jahre vergangen und die leere Seite des Bettes machte ihn noch immer so traurig wie am ersten Tag, doch er hatte mit dem Schmerz zu leben gelernt. Derius fehlte ihm so sehr wie sein eigenes Herz in der Brust, mit ihm war vieles auch in Wexmell gestorben, aber die Erinnerung an ihn schenkte ihm nach all der Zeit Mut und Kraft, statt bittere Verzweiflung.
Er konnte es sich nicht leisten, im Bett zu liegen und zu trauern, das hatte Melecay ihm klar gemacht.
Einmal, dachte Wexmell grimmig, nur ein einziges Mal hatte er den Fehler begangen, in Trauer versunken zu wehklagen und auf Melecays Anwesenheit zu vertrauen. Ein fataler und schwacher Fehler, wie sich später herausstellte. Natürlich hatte Melecay nur sein Spiel gespielt und Wexmells dumme Schwäche ausgenutzt.
Trotzdem blieb Wexmell nach jedem Traum von Derius, noch einen Augenblick länger in den Kissen liegen und drehte sich zur leeren Seite um, streckte den Arm aus und legte ihn auf die flache Decke, wie früher auf Derius` Brust. Mit den Fingerspitzen fuhr er die goldenen Stickereien nach, streichelte die filigranen Blätter der Lilien, die alles zierten und ihn daran erinnerten, dass er quasi der letzte Überlebende so vieler legendärer Männer war.
Ausgerechnet er, der von allen – seiner Ansicht nach – am wenigsten geleistet und geopfert hatte. Derius, Cohen, Zasch, Niegal, Luro und Allahad… sie fehlten ihm so, sie hätten es seiner Meinung nach so viel mehr verdient, jetzt hier zu sein und zu atmen. Er hoffte nur, sie warteten an einem leuchtenden Lagerfeuer auf ihn, mit einem Schluck Wein aus einem alten Reisetrinkbeutel. Denn er hätte alles Gold und Samt und Seide eingetauscht, um wieder mit ihnen durch die Welt zu streifen, nur damit er sie noch einmal lebend sehen konnte.
Wieder ertönte das Ächzen eines Raben und erinnerte Wexmell daran, warum er aufgewacht war. Er runzelte die Stirn, denn aus einem ihm unerfindlichen Grund, trieb das laute Krächzen seinen Herzschlag höher. Und als es erneut erklang, wie ein panischer Ruf in der Ferne, fiel es ihm wie Schuppen von den Augen und er warf sich im Bett herum, um zum Fenster zu blicken.
Er kannte diesen Ruf!
Nach all den Jahren hätte er nicht vermutet, dass er aus all den ähnlichen Krächzen ein bestimmtes wiedererkennen würde, er hatte ja nicht einmal gewusst, dass es sich von anderen unterschied. Doch als der Ruf ihn an diesem Morgen weckte, wusste er es einfach. Woher und warum er es wusste, konnte er nicht erklären. Er spürte es mit einer Klarheit, die ihn sofort jede Müdigkeit und Melancholie aus dem Leibe trieb.
Vor den Fenstern flog ein heller Schatten vorbei. Wexmell verfolgte ihn mit den Augen, während er die schwere Decke aus vielen Lagen Samt zurückschlug und die Füße auf den Boden stellte. Sein Nachtgewand bestand aus einem schwarzen Hemd, das ihm bis zu den Schenkeln reichte. Das Feuer war verglüht, es war kühl im Schlafgemach, doch das kümmerte ihn nicht, während er auf nackten Sohlen über gewebte Teppiche und nacktes Gestein eilte und den Schatten verfolgte, der auf der Klippenseite der Festung an einem der Fenster, draußen auf der steinernen Bank, mit lautem Flügelschlag landete und mit seinem gewaltigen Schnabel gegen die rotgefärbte Scheibe klopfte.
Wexmell schlug das Herz vor Erleichterung und Freude bis zum Hals, er riss das Fenster auf und wollte bei dem Anblick des weißen Raben in Tränen ausbrechen.
Es war Winter und vom Meer her wehte ein eiskalter Wind in Wexmells Gesicht, der Frost würde nicht mehr lange auf sich warten lassen.
»Xaith«, flüsterte Wexmell. Natürlich nicht zu dem Vogel, der ihn aus Augen ansah, die alles zu wissen schienen. Nein, er flüsterte es, weil er so erleichtert war, endlich ein Lebenszeichen seines Sohnes zu erhalten, der seit so vielen Jahren verschwunden, geächtet und verfolgt worden war, aufgrund völlig falscher Gerüchte.
Am Bein des Raben hing eine eingerollte Nachricht, die der Vogel Wexmell auffordernd entgegenstreckte. »Dringend! Dringend!«, ächzte er. »Meister sagt wichtig, wichtig. Ernst nehmen! Ernst nehmen.«
Wexmell nahm den Raben von der Fensterbank und drückte ihn an seine Brust. Der Vogel protestierte erst, hielt dann aber still, als Wexmell die Nachricht an sich nahm und umständlich mit einer Hand entrollte. Zwischen zwei Fingern hielt er den kleinen Zettel und las die geschwungene Handschrift. Wexmell musste grinsen, denn erstaunlicherweise war sie seiner ähnlicher als Derius`. Nein, er hatte diese Kinder nicht gezeugt, sie trugen nicht sein Blut in sich, und doch entdeckte er unter all ihren Eigenarten nicht nur einen Hauch von ihrem leiblichen Vater, auch er hatte seine Spuren in ihnen hinterlassen. Und es erfüllte ihn mit einer übermütigen Liebe, zu wissen, dass sie auch etwas von ihm in sich trugen, denn so bewies er trotz aller Gegenargumente, dass sie auch seine Söhne und seine Erben waren.
Auf dem Papier befanden sich jedoch enge und winzige Zeilen, die beinahe ein Vergrößerungsglas benötigten, damit er sie entziffern konnte. Lesend wandte er dem offenen Fenster den Rücken zu, noch immer mit dem weißen Raben unter dem Arm, und ihm zog der kalte Wind in den Nacken. Doch was ihn letztlich frösteln ließ, war die Botschaft in seiner Hand.
Wexmell, Vater,
frag nicht, woher ich es weiß, aber vertrau mir, wenn ich dir mitteile, dass etwas Dunkles auf uns zukommt. Ich sah den Schleier, er ist verseucht, Fäule und Tot haben diesen Ort übernommen und machen ihn schwach. Ich weiß nicht, wie sich das auf unsere Welt auswirkt, aber ich sehe eine Katastrophe voraus, nenn es Bauchgefühl. Du musst die Hexen darauf aufmerksam machen, haltet die Augen offen, haltet euch bereit für… was auch immer. Ich sah auch einen Sturm, gewaltig und magisch, voll dunkler Magie. Es scheint, als ob die Zeit unserer Welten abgelaufen ist. Du musst die Magier vereint halten, du brauchst ihre Kräfte, falls der Schleier stirbt oder gar zerbricht, denn dann steht nichts mehr zwischen dir und der Fäule, die dort gefangen ist.
In Liebe,
Xa Dein Sohn.
Ein lautes Klopfen an der Tür riss ihn aus seiner Schockstarre, sein Verstand hatte schon immer eine schnelle Auffassungsgabe besessen, doch Xaiths Zeilen musste er mehrfach lesen, und konnte dann immer noch nicht richtig begreifen, was er ihm damit sagen wollte. Als es dann klopfte, zuckte er so heftig zusammen, als wäre ein göttlicher Richthammer auf ihre Welt gefallen.
Er schluckte und schüttelte daraufhin den Kopf, um sich zu sammeln. »Ja, bitte?«
Anhand der Art des Klopfens – Härte und Dringlichkeit – konnte er bereits vorausahnen, wer es war. Und schon drang die raue Stimme seines schweigsamen, aber loyalen Leibwächters durch die Tür. »Eure Hoheit, General Hierraf mit einer Botschaft.«
Wexmell setzte den weißen Raben auf eine Stuhllehne, wo der Vogel sich schüttelte, und umhüllte die Botschaft mit der anderen Faust, während er nach seinem schweren, weinroten Morgenmantel griff. »Er kann eintreten.«
Knarrend öffnete sich die Tür, mit grimmiger Miene ließ Haahreel – sein Leibwächter, der ursprünglich aus der Wüste stammte und einen entsprechenden Teint besaß – den General vor.
Wexmell schloss gerade den Mantel und stopfte die Botschaft in die Taschen. »Hierraf, wie gut, dass Ihr hier seid! Lasst die Hexen rufen, wir müssen beunruhigende Neuigkei– Was ist passiert?« Mitten im Satz brach er ab und spürte eine eiskalte Faust nach seinem Herzen greifen.
Der General blickte ihm nicht in die Augen, er trat ein und hielt eine Botschaft in der rechten Hand, die ein gebrochenes, goldgelbes Siegel mit einer Taube darauf zeigte. Eine Nachricht ihrer Spione.
Wexmell sank das Herz. »Riath…?«, fragte er dünn. Seit Riath die sichere Festung verlassen hatte, wartete Wexmell auf den Tag, wenn er Meldung über seinen Tod erhielt.
Doch der General schüttelte den blonden Kopf. Endlich hob er den Blick, seine Lippen waren nur ein dünner Strich, doch seine zusammengezogenen Augenbrauen wirkten entschuldigend, nicht wütend. »Mein König…«, er schluckte und hob die Botschaft vor seinen schwarzen Brustharnisch mit dem Wappen des Königs darauf – einem Drachen, der sich um eine Lilie schlängelte – als müsste er die Nachricht ablesen.
Wexmell trat näher. »Sag es, ich komme damit zurecht«, forderte er und wappnete sich innerlich gegen alles.
»Es tut mir so leid«, begann der General vorsichtig, »wir haben Meldung aus Elkanasai.«
Ihm blieb der Atem weg, doch das ließ er sich nicht anmerken, ernst wartete er ab.
»Es heißt, Euer Sohn… Eagle«, voller bedauernd seufzte Hierraf, »es heißt, Prinz Riath habe ihn erdolcht. Er ist tot, mein König! Und Großkönig Melecay … übernahm die führungslose Stadt.«
*~*~*
»Das ist unerhört!«, donnerte die erstaunlich kräftige Stimme des alten Mannes durch den Thronsaal.
»Dem stimme ich vollkommen zu, Ratsherr.« Der Großkönig stieg die Stufen zum Sitz des Kaisers hinauf und warf sich hinein. Er war ein Bulle von einem Mann, der zu groß für das zarte Möbelstück auf der Empore war. »Die Dinge, wie sie gerade liegen, sind unerhörter Naivität geschuldet.«
Der Ratsherr ließ sich davon nicht beeindrucken, er machte einige Schritte auf den Großkönig zu, der nur mit einem müden Lächeln den Kopf schieflegte und gemütlich die Beine übereinanderschlug.
»Ihr habt kein Recht, uns wie Vieh oder Sklaven von Euren verdammten Barbaren hierher eskortieren zu lassen, als müssten wir Euch Rede und Antwort stehen! Ebenso besitzt Ihr nicht die Befugnis, über die Stadt zu bestimmen, als gehörte sie Euch. Und schon gar nicht dürft Ihr im Thron des Kaisers Platz nehmen! Ich erwarte, dass Ihr umgehend aufsteht und Euch für Eure Arroganz entschuldigt! Dies ist Elkanasai, Ihr seid nur Gast in diesem Land!«
Gut gesprochen, dachte Ashen und blickte mit stolzer Miene zum Thron hinauf. Er stand hinter dem Rat der Fünf, die vor dem Thron aufgereiht und von den ranghöchsten Generälen und Hauptmännern der Stadt umgeben waren. Barbaren-Krieger waren überall im Raum positioniert, in der Stadt sah es seit Tagen – Wochen! – nicht anders aus. Der Kaiser war noch nicht kalt gewesen, als die Carapuhrianer aus jeder Ecke des Urwaldes in die Stadt gestürmt und alles unter ihre Kontrolle gebracht hatten. Der Rat war so geschockt über die Gerüchte, wer den Kaiser ermordet hatte, dass er die Bevölkerung um Ruhe und Fügsamkeit gebeten hatte, damit sie Leben schützten, während sie den Mord an Kaiser Eagle untersuchten.
Melecay belächelte die fünf Ratsherren – darunter Ashens Onkel – und besah sie nacheinander von oben herab. Er legte die großen Hände auf die Stuhllehnen, sein geflochtener Barbarenzopf hing wie eine Schlange über seiner Schulter, während seine rasierten Schädelseiten mit roter Farbe – oder war es gar Blut? – bemalt waren. Er sah durch und durch barbarisch aus.
»Der Kaiser ist tot«, betonte der Großkönig, als hätten sie es alle vergessen. »Ermordet von einem jungen Hexenmeister, dem Ihr naiven alten Säcke Vertrauen entgegengebracht habt. Der Junge, den ihr als des Kaisers Nachfolger benannt habt, ist mit dem Mörder eures Kaisers geflüchtet. So wie ich das also sehe, ist euer Land führungslos!«
Ashen konnte die Wut, die er auf diesen Mann besaß, nicht beschreiben. »Wexmell Airynn ist Kaiser von Elkanasai«, platzte es aus ihm heraus, er ballte an den Seiten seiner weißen Toga die Hände zu eisenharten Fäusten. »Er führt das Land.«
Melecay schnaubte. »Aber Wexmell ist nicht hier und er wird auch kaum hier auftauchen, angesichts der eigenen Unruhen in Nohva.« Durchdringend spießte sein blauer Blick Ashen auf, doch auf seinen Lippen lag ein spöttisches Grinsen. »Nur keine Sorge, kleiner Spitzel, zu dir kommen wir noch.«
Ashens Onkel schob sich vor ihn und sagte diplomatisch. »Niemand in diesem Raum ist ein Spitzel, Eure Hoheit. Doch wie ich meinem Ratskollegen recht geben muss, so seid Ihr doch nur Gast in diesem Land und wir müssen Euch bitten, diesen Thron und diesen Saal nun zu verlassen.«
Der Großkönig begann – im scheinbaren Unglauben – zu lachen: »Ihr habt ein Reich ohne besetzten Thron, Ihr seid führungslos, und lehnt meine helfende Hand ab?«
»Ihr seid ein Tyrann!«, rief ein anderer der Ratsherren. Bevor Ashens Onkel ihn davon abhalten konnte, fuhr er wütend fort: »Der Mord an Kaiser Eagle wird noch untersucht! Alles, was Prinz Riath und Prinz Kacey belastet, ist Eure Aussage. Es erschließt sich uns einfach nicht, warum Prinz Riath und Prinz Kacey den Mord an unserem Kaiser geplant und durchgeführt haben sollten, nachdem sie bereits einen diplomatischen Sieg über ihn errungen hatten. Das ergibt nicht den geringsten Sinn für uns und wir werden der Sache nachgehen, darauf könnt Ihr Euch verlassen, Barbarenabschaum! Und solange es keinen Kaiser gibt, untersteht die Stadt und das Reich von Elkanasai dem Rat der Fünf, bis der wahre Kaiser einen neuen Vertreter wählt oder wir Prinz Kacey ausfindig machen konnten!«
Melecay hob die Augenbrauen mit gespielter Ungerührtheit, während seine Augen plötzlich eiskalt und gefährlich glitzerten. So wie bei einer Schlange, kurz bevor sie zubiss.
»Bezichtig Ihr mich der Lüge, Ratsherren?«, fragte er leise, aber schneidend, sodass Ashen fröstelte. »Behauptet Ihr, ich würde lügen? Ich, ein König und Verbündeter?«
Zischend zog Ashens Onkel seinen Kameraden wieder zurück und wandte sich besonnen an den Großkönig. »Verzeiht uns unsere Aufgebrachtheit, Großkönig, und unseren derzeit fehlenden Respekt. Natürlich schätzen wir Eure Absichten, doch unser Volk ist verängstigt und ohnmächtig ob der Gerüchte. Wir würden niemals einen König der Lüge bezichtigen, doch vielleicht lagen die Dinge nicht so, wie Ihr selbst glaubtet. Es ist unsere Pflicht, den Mord genaustens zu untersuchen, denn die Zukunft der Magier hängt von diesem Verbrechen ab.«
»Ich weiß.« Ein genüsslicher Ausdruck voller Zufriedenheit kehrte auf Melecays harte Züge zurück, er lächelte. »Und Eure Stadt würde unter dem Streit der Magier und den Normalsterblichen brennen, würden meine Krieger nicht für Ordnung und Ruhe sorgen, oder wollt ihr das etwa abstreiten?«
Eine betretene Stille legte sich über die Anwesenden. Unglücklich sah Ashen zwischen den Beteiligten umher, doch auch ihm schnürte die Erkenntnis die Kehle zu. Die vier der Fünf derzeitigen Ratsherren tauschten betroffene Blicke.
Melecay lächelte weiterhin auf sie herab, als wären sie alle einfältige Kinder. Er lehnte sich nach vorne und stützte das Kinn auf seine verschränkten Hände. »Aber ich hatte natürlich befürchtet, dass ihr meine Hilfe nicht zu schätzen wisst.«
»Verzeiht«, sagte Ashens Onkel bemüht um Höflichkeit, ganz der Diplomat. »Doch derzeit wirkt Eure Hilfe in unserer Stadt nicht wie Freundschaft, sondern mehr wie eine Übernahme.«
»Mh«, machte Melecay. Er nahm die Arme runter und legte den Kopf schief. »Das liegt vielleicht daran, dass ich wie ein Tyrann behandelt werde, während ich im Namen aller Freundschaft und Liebe das Reich meines ermordeten Verbündeten schützen möchte. Falls ich euch daran erinnern darf, der Mord an Eagle wäre nie passiert, hättet ihr nicht den falschen beiden Hosenscheißern Macht versprochen. Das Blut des Kaisers klebt genauso an euren Händen wie an Riaths. Ihr hättet Eagle vertrauen müssen.«
Er schimpfte sie aus wie ein König seine Untertanen. Doch bevor einer von ihnen wieder entrüstet den Mund aufmachen konnte, erhob sich der Großkönig plötzlich und breitete die Arme aus.
»Dieses Reich ist vergiftet durch Jahrhunderte lange Intrigen über Intrigen und das, was ihr Politik nennt.«
Ashen starrte stirnrunzelnd zu ihm auf, im Augenwinkel bemerkte er genau zeitgleich mit allen anderen, die herannahenden Krieger.
Sie wurden zusammengepfercht, die Generäle griffen nach ihren Waffen, um den Rat abzuschirmen. Doch Ashen bemerkte einen Barbaren an der Wand, der nur gelassen seine Axt zückte, aber nicht auf sie zutrat.
»Was dieses Reich braucht, sind keine alten Säcke, die es führen und immer weiter vergiften, eure Demokratie hat versagt«, fuhr Melecay mit einer harten Stimme fort, die Ashen alle Haare zu bergen stehen ließ. »Es wird Zeit für eine Veränderung. Die Mittäter des Mordes an Kaiser Eagle werden ihre Strafe ebenso erhalten wie der Mörder selbst.«
»Was soll das heißen? Was geht hier vor?«, fragte Ashens Onkel und löste sich aus der Menge. »Eure Hoheit, Ihr bedroht den Rat der Fünf! Auch wenn Ihr ein Verbündeter des Reichs seid, habt Ihr Euch an unsere Gepflogenheiten und Gesetze zu halten.«
Stirnrunzelnd blickte Ashen wieder zu dem Krieger an der Wand. Direkt neben ihm war ein Seil festgeknotet. Ashen folgte seinem Verlauf mit den Augen, es führte unscheinbar hinauf zur Decke, war durch einige schwere Eisenringe gezogen worden und hielt einen Kronleuchter, der direkt…
Ashen blickte wieder auf die Ratsherren, die zusammengetrieben wurden, und riss die Augen auf. »Nein!«, schrie er, »Vorsicht!«
Die Ratsherren drehten sich um, einschließlich seines Onkels und der Generäle. Im gleichen Moment hörte er das helle Ping, den Einschlag der Axt auf dem harten Marmor, als das Seil durchtrennt wurde. Es war totenstill, als es an der Decke ratterte und rumpelte. Alle Gesichter fuhren auf und starrten nach oben.
»Nein! Weg da!«, schrie Ashen und wollte mit ausgebreiteten Armen zwei Ratsherren einen groben Stoß in den Rücken verpassen, als der schwere Kronleuchter auch schon herabschlug.
Ashen fiel instinktiv zurück, der Aufprall war ohrenbetäubend und im Saal dröhnte das Geräusch noch lange über die glatten Wände, der Boden hatte einige Macken eingebüßt.
Ashen starrte fassungslos auf das, was ihn beinahe wie alle anderen zermalmt hätte. Irritiert fuhr er sich mit der Hand über das Gesicht und besah seine Finger. Er war vollgespritzt mit Blut. Ein kaltes Grauen und Unglaube erfassten ihn.
Nein! Das konnte nicht wirklich sein.
Er hob den Blick, die Generäle standen neben ihm, ebenso erstarrt und verständnislos wie er, als ob sie nicht begriffen, was gerade geschehen war. Hinter dem Kronleuchter erblickte er seinen Onkel, der mit offenem Mund und aschfahl auf die Überreste seiner Ratskollegen hinabstarrte, unter dem Kornleuchter zuckte noch eine Hand, als würde sie um Hilfe bitten.
»Ihr seid wahnsinnig!« Ashens Onkel fand zuerst die Sprache wieder, er wirbelte zu Melecay herum. »Dafür werdet ihr – Ürrgh…«
»Nein!« Ashen streckte die Hand aus, als könnte er es noch verhindern, doch die lange Klinge des Großkönigs ragte bereits aus dem Rücken seines Onkels, dunkles Blut tropfte an der Spitze zu Boden.
Das konnte alles nicht wahr sein! Das … konnte nicht wirklich passieren! Ashen gelang es nicht, das Gesehene für wahr zu befinden, sein Verstand konnte den Schock nicht verwinden. Er wusste irgendwo im hinteren Teil seines Gehirns, dass er aufstehen sollte. Dass er fliehen oder schreien oder kämpfen sollte. Irgendwas, nur nicht einfach dort auf dem Boden kauern und immer wieder Nein rufen, als ob es nicht wahr wäre, obwohl es das war. Er… konnte sich nicht bewegen.
Dafür aber die Generäle der Stadt, die ihre Schwerter aus den Scheiden rissen und deren Wut nichts mehr halten konnte. Die Barbaren stellten sich ihnen in den Weg, um den Großkönig zu schützen.
Es waren zu viele Feinde in diesen Hallen und die Generäle hielten inne, tauschten Blicke aus und zuckten angriffslustig mit den spitzen Ohren, doch blind vor Zorn würden sie sich nicht abschlachten lassen, dafür hatten sie zu viel Erfahrung.
Melecay schnalzte mit der Zunge. So geschmeidig, wie er seine Klinge gezogen und in Ashens Onkel gerammt hatte, so geschmeidig glitt sie auch wieder aus dem Leib des Sterbenden heraus.
Ashen spürte Tränen, konnte sie aber nicht begreifen. Als sein Onkel auf den Boden sank und sein Blut über den weißen Marmor floss, wollte er zu ihm kriechen, aber er konnte sich immer noch nicht rühren.
Was… sollten sie denn jetzt tun?
»Meine lieben Waffenbrüder!« Melecay zog die Klinge über die weiße Toga des Sterbenden und versenkte sie in der Scheide, dann breitete er vor den Generälen die Arme aus. »Eure letzten Führer wurden so eben der Nachwelt übergeben. Klingt für mich bisschen so, als ob euer Reich endgültig übernommen wurde.« Er lächelte, die Generäle wirkten ratlos und irritiert, sodass Melecay sich nach vorne lehnte und flüsterte: »Ich bin jetzt der Großkönig von Elkanasai und Carapuhr, ihr seid mir zu Treue verpflichtet.«
Einer der Generäle erwiderte grimmig: »Ihr seid ein Mörder, nichts weiter!«
»Das stimmt nicht ganz, ich habe nur die Männer bestraft, die einen Verräter auf euren Thron setzen wollten. Männer, die für den Tod des Kaisers mitverantwortlich sind.« Melecay zuckte gelassen mit den Schultern und legte die Hände hinter dem Rücken zusammen. »Kämpft, wenn ihr wollt, ihr würdet alle in diesem Raum sterben. Das wisst ihr doch, oder?«
Die Männer sahen sich wieder an, die Lippen grimmige Striche. Ihre Wut wich dem Selbsterhaltungstrieb, sie sahen die Überzahl der Barbaren und verloren ihre Entschlossenheit.
»Jeder gute Soldat tut seine Pflicht gegenüber der Heimat. Eurer Kaiser wurde ermordet, aber ich bin nicht hier, um Elkanasai zu vernichten, ich töte nicht jeden Mann. So kämpft, wenn ihr denkt, dass ihr es müsst. Oder«, er hob die Arme, »ihr nehmt euren Posten wieder ein, behaltet eure Leben und euren Rang, und einen Sack voll Gold aus des Kaisers Schatzkammern, indem ihr weiterhin der Stadt dient.« Er grinste scheinheilig. »Es ändert sich doch nur, wer auf dem Thron sitzt, euch kann es doch gleich sein. Und um euer Volk zu schützen, solltet ihr schon dort weiter machen, wo ihr aufgehört habt, oder nicht? Also steckt die Waffen wieder weg, nehmt euch etwas Gold, und macht euch an die Arbeit, Brüder. Ich töte euch nicht, wenn ihr mir keinen Grund gebt. Und heute Abend könnt ihr eure Geliebten und Kinder in die Arme schließen, statt hier sinnlos zu krepieren wie eure uneinsichtigen, unfügsamen Anführer.« Er machte eine vage Handbewegung in Richtung Kronleuchter. »Lohnt es sich für ein Stück blutiges Fleisch zu sterben – oder lohnt es mehr, einem neunen Herrscher zu dienen und zu leben?«
Es war plötzlich totenstill, als der Großkönig geendet hatte. Die Zeit schien einen Augenblick stillzustehen, eher sie wieder tief einatmete. Ashen sah mit ohnmächtigem Unverständnis dabei zu, wie erst zwei und dann der Rest des halben Dutzend Männer die Klingen senkte.
Melecay lächelte zufrieden. »Nun denn, wäre jemand dann so freundlich«, meinte er und wandte sich ab, um den Thron erneut zu besteigen, »Wexmells kleinen Spitzel zu töten.«
Ashen wurde noch bleicher, als die Männer sich irritiert nach ihm umsahen. Er kannte sie alle mit Namen, pflegte zu beinahe jedem Kontakt, wenn auch keinen engen. In ihren Augen war kein Hass, vier von ihnen zögerten erschrocken, zwei verzogen bedauernd das Gesicht, kamen aber auf ihn zu.
Erst in diesem Moment ging ein Ruck durch ihn und er strampelte mit den Beinen, um vor ihnen davon zu robben.
Melecay setzte sich auf den Thron und rieb sich die Augen, er verlangte nach Wein.
Ashen schmiss sich herum, hinter ihm lagen die zwei geschlossenen Flügel der Tür. Natürlich waren sie bewacht und die zwei grobschlächtigen Barbaren zogen mit gehässigen Gesichtern ihre Äxte aus den Schlaufen ihrer Gürtel.
Gehetzt sah Ashen sich um, sein Herz pochte so wild und stark, dass er bereits befürchtete, es würde einfach zerspringen, bevor er auch nur einen Schritt wagen konnte.
Vor ihm lag die Tür, bewacht von Barbaren, hinter ihm näherten sich die Männer, die ihn einst beschützt hatten. Sie wirkten nicht so entschlossen wie die Barbaren, doch auch diese genossen die Panik in seinem Gesicht und kamen gemütlich heran, da es für ihn keinen Ausweg gab.
Ashen fuhr hin und her, wurde wie ein Lamm in die Enge getrieben, das zur Schlachtbank geführt werden sollte.
»Wehr dich nicht, dann tut es weniger weh«, bat ihn einer der Generäle mit väterlicher Miene. »Ich mach es ganz schnell.«
Ashen starrte ihn an und wusste nicht, ob er dankbar oder wütend sein sollte. Ein Teil von ihm konnte ihn sogar verstehen, Loyalität war nicht immer leicht zu halten, wenn es kaum eine echte Wahl gab. Mit einem flehenden Kopfschütteln sah er dem General entgegen, konnte keinen klaren Gedanken fassen und sich nicht einmal an das Gesicht und den Namen erinnern.
»Es ist ganz schnell vorbei«, versprach er, die anderen ließen ihm den Vortritt.
Ashen spürte seine kräftige Hand im Nacken und wurde an ihn herangezogen, er sträubte sich noch, war jedoch wie gelähmt und sein Herz zersprang beinahe in seiner Brust.
Der andere hob die Klinge mit der Spitze voran auf Höhe des Herzens und leckte sich die Lippen, er sah Ashen in die Augen.
Sein Fehler, er sah es nicht kommen. Ashen drehte sich an der tödlichen Klinge vorbei, beinahe wie bei einem Tanz wirbelte er in die Arme des Generals, Rücken an Brust, und rammte ihm den spitzen Ellenbogen in die Rippen. Grunzend beugte er sich vorüber, Ashen packte seinen Arm, stieß seinen Ellenbogen darauf, bis die Finger den Waffengriff freigaben und er ihm das Schwert entwenden konnte.
Er war kein Kämpfer, all das geschah aus reiner Verzweiflung und ohne nachzudenken. Ungeschickt sprang Ashen aus der unfreiwilligen Umarmung hervor und fuchtelte warnend mit der Klinge, um die anderen im Raum auf Abstand zu halten. Die Elkanasai waren verblüfft, die Barbaren lachten wie Katzen, die jetzt erst ihren Spaß mit der Maus haben würden.
Ashen wich zurück, immer weiter zurück.
»Jemand sollte dem jetzt ein Ende bereiten, so interessant es auch gerade ist«, kommentierte der Großkönig das Geschehen.
Ashen achtete nur auf die Waffen, die sich vor ihm befanden. Verzweifelt schlug er nach den Körpern, die ihn wieder in die Enge treiben wollten. Doch dieses Mal bestimmte er die Richtung.
»Gleich ist er weg«, sagte Melecay unbeeindruckt.
Da trat Ashen mit dem Fuß die Bedienstetentür auf und schlüpfte rückwärts durch die Wand in einen mit Fackeln beleuchteten Gang. Er sah die Angreifer voranstürmen und schaffte es gerade so, die Tür zuzuwerfen und das Schwert durch die beiden Eisengriffe zu schieben, um sie zu verriegeln.
Taumelnd wich er zurück, als die Männer dagegen rannten. Sie rammten mit den Schultern das Türblatt, rüttelten an den Griffen und traten zu.
»Und schon ist er weg, wie ärgerlich«, hörte er Melecay belustigte Stimme. Er schien weder verwundert noch in Panik darüber. »Na dann sucht mal besser den Palast ab.«
Ashen stolperte rückwärts, konnte noch gar nicht richtig begreifen, was geschehen war, und fuhr sich erneut mit der Hand über die mit Blut besprenkelte Wange. Staub rieselte aus der Decke, als die Tür weiter gerammt wurde. Eine Axt schlug einen Spalt ins Holz, es brach knirschend.
Erst in diesem Moment drehte er sich um und eilte den dunklen Gang entlang, abermals hörte er im Palast Soldaten durch die Flure marschieren und Befehle rufen, genau wie an dem Tag, als Kaiser Eagle ermordet worden war.
Er rannte, als ob die gesamte Unterwelt hinter ihm her wäre, blieb in den Gängen der Bediensteten, doch dort wurde ihm bald der Weg abgeschnitten. Er musste zum Stall, er brauchte ein Pferd! Er musste zu Liz, der seit Wochen in der Wildnis zu Nohva einen tollwütigen Drachen jagte!
Liz! Oh Götter, er wollte seinen Gemahl noch einmal sehen, betete inständig darum, dass das Schicksal ihm gnädig war! Liz! Er musste ihn warnen, damit er nicht in eine Falle lief!
Die Wege zum Stall waren versperrt, überall standen Barbaren und wartete nur darauf, dass er sich zeigte. Zum Glück war er dünn, konnte in Nischen und hinter Statuen mit den Schatten verschmelzen, sodass er nicht nur mit Blut besprenkelt, sondern auch mit Staub bedeckt war.
Sie trieben ihn in die Küche, es war seine letzte Chance, auszuweichen. Dort gab es noch einen Weg in die Ställe, doch er würde nicht damit rechnen, dass er es lebend zu einem Pferd schaffte.
Es musste einen anderen Weg aus der Stadt geben!
Hinter ihm im Gang hörte er Rufe und Stiefelgetrampel, Fackeln erhellten den halbdunklen Flur und er fuhr erschrocken herum, um rückwärts aus dem Gang in die Küche zurückzuweichen, wo er prompt über etwas stolperte und sich überschlug.
Für einen Moment war er so benommen, dass er den erschrockenen Aufschrei und die Feuchte gar nicht bemerkte.
»Mein Herr Ashen!«, rief eine verwunderte Stimme.
Ashen saß zusammengesunken an einem Schrank und rieb sich den Hinterkopf. Vor ihm kniete einer der jungen Bediensteten mit einem Lappen in der Hand, ein Putzeimer war neben ihm umgekippt und sie knieten beide darin.
Rufe ertönte aus dem Gang, der andere Elkanasai blickte auf und schien die Situation zu begreifen. Mit riesigen Augen sah er Ashen an, seine Iriden funkelten so gelblich als wären sie aus Citrin.
»Bitte«, bat Ashen und streckte die Hand aus, »verrat mich nicht!«
Der junge Elkanasai blickte von ihm zum Gang und wieder zurück. Dann schien er eine Entscheidung zu treffen, denn er warf den Lappen fort. »Kommt!«, er half Ashen auf, der ihn nur verwundert anstarren konnte. »Ich weiß, wie wir rauskommen.«
»Sie werden auch dich jagen«, befürchtete Ashen, ließ aber bereitwillig zu, dass der andere seinen Arm um ihn legte und aus der Küche führte. »Und sie werden dich foltern!« Seine Lunge brannte, seine Beine brannten, sein Kopf tat weh vom Aufprall und der Schock ließ ihn jeden Mut verlieren. Nur der Gedanke an Liz trieb ihn vorwärts.
»Dann komme ich eben nicht wieder zurück, Herr Ashen.« Er spähte auf den Gang, von links nach rechts. »Ich habe im Gefühl, dass es für uns alle besser wäre, zu flüchten.«
Er führte sie zum Abort und hob den Holzdeckel mit dem Loch in der Mitte an. Es stank so bestialisch, als wäre einer der fleischsüchtigen Barbaren kurz zuvor darauf gewesen.
»Nicht sehr einladend, aber der einzige sichere Ausweg«, entschuldige sich der Küchenjunge.
Ashen zögerte nicht, in die feuchte und dunkle Kanalisation zu steigen. Er musste überleben und berichten, was geschehen war.
Er musste berichten, dass Elkanasai verloren war…