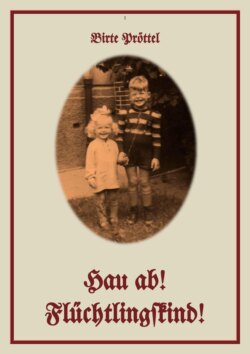Читать книгу Hau ab! Flüchtlingskind! - Birte Pröttel - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
… Pommernland ist abgebrannt...
ОглавлениеIch kann den Ton von Sirenen nicht leiden. Auch ein Krankenwagen mit Martins-Horngeheul lässt meinen Adrenalinspiegel und den Blutdruck in die Höhe sausen. Gänsehaut läuft mir den Nacken runter und die Ohren schreien Alarm. Wenn Sirenen heulen, rasen Gespenster, böse Geister und alle erdenklichen Unholde durch die Lüfte und im Auf- und Abschwellen des grauslichen Lärms gefriert mir das Blut in den Adern, auch heute noch. Warum ist dieses Marterinstrument nach dem lockenden, säuselnden Gesang der Sirenen in der Mythologie benannt? Oder waren die Sirenen gar nicht so zarte Wesen? Aber das ist wohl ein Fall für Historiker oder Altphilologen.
Als ich klein war, bedeutet dieses Getöse das Ende süßer Träume und des nächtlichen Schlafs. Mutter reißt uns gnadenlos aus den kuschelwarmen Betten und wir müssen, so schnell uns unsere Kinderbeine tragen, in den Luftschutzkeller. Wenn der „Volksempfänger“ eine Bombennacht vorhersagt, legt Mutter uns angezogen ins Bett. Ich finde das prima, denn das abendliche Wasch-, Zahnputz- und Umziehritual fällt dann weitgehend flach.
Unser Luftschutzkeller ist im Nachbarhaus. Die Sirenen heulen und wir stolpern und torkeln wie ferngesteuert schlaftrunken die Treppen runter, durch den Vor- in den Nachbargarten, durch die kleine Kellertür ab in den Luftschutzbunker.
Hier ist die Luft nicht geschützt, wie man von dem Namen „Luftschutzkeller“ erwarten könnte. Es miefelt gruselig nach Angstschweiß, ungewaschenen Haaren, feuchten Wolldecken und was sonst noch Menschen in der Nacht ausdünsten. Ein langer, unbelüfteter, spärlich beleuchteter Raum mit Bänken an den Wänden. Wie Sardinen in der Büchse sind wir hier eingefüllt.
Jede Familie hat ihren Stammplatz. Mein großer Bruder und ich hocken mit angezogenen Beinen auf der Bank. Mutter schaukelt das Baby, meinen kleinen Bruder, an ihrer tröstenden Brust. Eine schwarze Locke fällt dem Baby ins Gesicht und es nuckelt glücklich an der Strähne. Mutter lächelt uns zu und wickelt uns in unsere warmen Kuscheldecken. Ich mag es, wenn sie lächelt, dann hat sie immer ein kleines Grübchen und sieht nicht so streng aus. Dann sitzen wir da, dösen und warten. Warten, bis die Sirenen Entwarnung heulen. Die Erwachsenen flüsterten miteinander. Ein alter Mann schnarcht und wir schauen fasziniert auf ihn. Nach jedem Schnarcher sinkt sein Kopf weiter nach vorne, bis er beinahe umkippt. Dann schubst ihn die Frau neben ihn und flüstert: „Opa, schlaf nicht ein!“
Die nächtlichen Besuche im Luftschutzkeller gehören für uns zum täglichen Leben. Schulkinder freuen sich, dass sie nach Bombennächten freihaben.
Unser Haus war ein Mehrfamilienhaus, daneben standen noch zwei oder drei ganz gleiche Häuser. Es waren Gebäude der Reichsbahn und wurden von ihren Mitarbeitern bewohnt. Ob nun alle zusammen einen Luftschutzkeller benützten, das weiß ich nicht, mir jedenfalls kam es vor, als hätte sich das ganze Stadtviertel hier versammelt. Ich mochte die Menschen nicht und nicht ihre stinkige Nähe. Am liebsten hätte ich sie alle ans Schienbein getreten und raus befördert. Aber ein braves Mädchen macht so was ja nicht.
Wir schlummern auf unserer Bank. Plötzlich knallt die eiserne Kellertüre auf und meine Tante Charlotte wankt herein, sinkt auf den kalten Boden aus gestampfter Erde. Ihre dunklen Locken kleben blutgetränkt um ihr Gesicht, ihr eleganter grauer Tuchmantel ist voll Erde, Gras und Schlamm.
„Jetzt jagen sie Menschen wie die Feldhasen, es ist eine Schweinerei!“, schimpft ein alter Mann mit hoher Fistelstimme. Große Aufregung, die Erwachsenen knallen fast mit den Köpfen zusammen, als sie sich über die Frau beugen. Alles schnattert durcheinander. Wir brauchen einen Arzt. Tante Charlotte krümmt sich vor Schmerzen. Sie wollte noch schnell in den rettenden Keller und wurde von Bombensplittern getroffen. Aber Tante Charlotte ist nicht tot. Hellwach schießen auch wir von unseren Plätzen hoch. Neugierig wie Leute, die auf der Autobahn einen Unfall beglotzen, drängen wir uns zwischen die Großen. Sie starrt mich mit ihren grauen Augen an, weint nicht, ist ganz still.
„Warum guckst du so, Tante Lotte?“, sie antwortet mir nicht. Ich wundere mich, sonst ist sie nämlich immer sehr nett zu mir.
„Wir müssen warten, bis der Alarm vorbei ist!“ Tante Lotte rollt sich auf die Seite und wimmert leise. Niemand sagt was. Mir wird langweilig. Ich hocke mich wieder auf die Bank. Später erzählt Mutter uns, dass Tante Charlotte sieben Granatsplitter im Rücken hatte. Eine Operation hat sie aber gerettet.
Während sich noch alles um unsere Tante kümmert, gibt es einen ohrenbetäubenden Lärm. Der Keller, nun notdürftig von Taschenlampen erhellt, scheint zu wackeln und zu beben.
„Wie sind getroffen!“ schreien die Erwachsenen und klammern sich erschreckt aneinander und wir schlüpfen wie Küken unter Mamas Mantel.
Einer der wenigen Männer, die bei uns und nicht im Krieg waren, öffnet vorsichtig die Kellertür. Schutt fließt über seine Füße und Staubwolken vernebelten den Keller.
„Oh, Gott!“ Schnell stemmt er sich gegen die Tür und legt den eisernen, quietschenden Hebel um, der sie sicher verschließt.
„Alles brennt draußen. Wir müssen drinnen bleiben!“
„Mein Gott, wir sind in einem Backofen!“Meine Erinnerung an diese Bombennacht ist eigentlich ziemlich dürftig. Am nächsten Morgen, als wir draußen knietief in qualmendem Geröll und zwischen Mauerstücken stehen, klagt Mutter:
„Wir sind ausgebombt!“
Die Rückseite unseres Hauses ist weg. Die Räume sind offen wie Puppenstuben. Ich bin begeistert, es sieht einfach toll aus. Die Küche mit den bunten Kacheln, daneben das Zimmer von Emma, unserem Kindermädchen. Es ist wie in einer Möbelausstellung. Über Emmas Bett schaukelt das Kruzifix, das ich immer mit Schauern betrachte. Ein toter Mann auf einem Kreuz. Nun ist er staubig und geholfen hat er auch nicht. Emma glaubt aber doch, denn ohne den Toten am Kreuz wäre alles viel schlimmer gekommen, flüstert sie und bindet sich ihre Kittelschürze fest. Mutter ist ganz steif und still und streicht sich eins ums andere Mal die verschwitzten Haare aus dem Gesicht.
„Sag, dass das ein böser Traum ist!“
Nun haben wir eine eigene Ruine, es ist zwar keine Burgruine, aber immerhin. Wir tasten uns vorsichtig in unsere Wohnung. Mutti will das Nötigste holen. Aber das interessiert mich nicht weiter. Doch eines ist mir ins Gedächtnis gebrannt: Arnes Tasse.
Ich war so eifersüchtig, als er die Tasse wenige Tage zuvor zum Geburtstag bekommen hatte. Ich hätte ihm gegönnt, dass die Tasse auch ausgebombt worden wäre, aber nein, sie steht da wie zum Hohn. Mit Goldrand! Ob wir die schöne Goldrandtasse mitgenommen, oder ob sie gar die Flucht überstanden hat, weiß ich nicht. Wenn sie meine gewesen wäre, ich hätte mich nie von ihr getrennt.