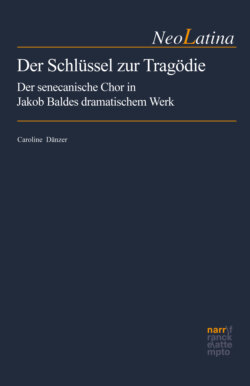Читать книгу Der Schlüssel zur Tragödie - Caroline Dänzer - Страница 13
1.3. Theodizee
ОглавлениеFür die Zwecke dieser Untersuchung essentieller ist die Frage nach der inhaltlichen Absicht. Uneinigkeit besteht einerseits in der Frage nach einer etwaigen belehrenden Intention der Stücke und andererseits nach ihrer Aussage. Es finden sich politische Anspielungen, pädagogische Züge sowie im Besonderen philosophische Denkmuster. Gerade hier wurde jedoch vielfach festgestellt, dass sich signifikante Brüche im Vergleich zu Senecas Prosawerken finden.1 Diese auffälligen Passagen sind vor allem im Bereich des Umgangs mit dem Konzept des fatum und damit einhergehend mit der Frage der Theodizee angesiedelt. Fischer hat eine umfassende Untersuchung zu dieser Problematik in Senecas Tragödien im Zusammenhang mit den Prosaschriften unternommen.2 Sie konstatiert: „In den Dramen agieren die Götter anders, als nach den philosophischen Schriften zu erwarten wäre. Trotz der unterschiedlichen Genera und trotz der poetischen Tradition, in der sich Seneca mit seinen Tragödien bewegt, ist das durchweg negative Bild, das die Dramenfiguren von den Göttern zeichnen, auffällig.“3 Die Problematik liege darin, dass bei Seneca theologische und moralische Fragestellungen ineinandergreifen: „Im Vergleich zur stoischen Tradition wandelt sich bei Seneca das Verhältnis zwischen Religion und Philosophie: Gott spielt in seiner Philosophie in erster Linie eine ethische Rolle. Theologie und Ethik stehen bei Seneca in engerem Bezug zueinander als bei den Stoikern vor ihm.“4 Doch eine göttliche providentia, die das Handeln der Menschen positiv beeinflussen könnte, scheint in den Tragödien zu fehlen.5 Um diese Diskrepanzen zu erklären, haben sich verschiedenste Ansätze herausgebildet. Lefèvre will in den senecanischen Tragödien zwei Typen unterscheiden: „der dem stoischen Ideal nahekommende und der nach Ansicht dieser Lehre in verdammenswerter Weise den Affekten unterliegende Mensch.“6 Allerdings trifft diese schematische Unterscheidung in richtiges und falsches Verhalten nicht immer zu. Viel häufiger bewegen sich die Figuren in einer Art Grauzone: Sie scheitern auf grausame Weise, doch ist es nur in einigen Fällen möglich, ihren Untergang aus ihrem eigenen Fehlverhalten zu erklären.7 In einer Vielzahl von Fällen scheint die Machtlosigkeit des Menschen, der zum Spielball der Launen des Schicksals gerät, im Vordergrund zu stehen.
Radikal folgert Joachim Dingel hieraus, die Tragödien müssten von den Prosaschriften getrennt betrachtet werden und seien „autonom poetisch“8 und gar „die poetische Negation stoischer Vorstellungen“9. Er plädiert für eine rein poetische Lesart der Tragödien.10 Auch Alessandro Schiesaro spricht sich gegen eine stoische Interpretation der Stücke aus. Der Leser sympathisiere auf emotionaler Ebene eher mit den Schurken denn mit den Helden, da er sich in deren Gefühlswelt besser hineinversetzen könne.11 Eine Einordnung der Stücke als „philosophical propaganda plays“, wie Berthe Marti sie postulierte, ist sicherlich zu starr und radikal.12 Dennoch ist stoisches Gedankengut ein integraler Bestandteil der Stücke. Wiener legt ausgehend von den Thesen von Staley dar, Seneca unterstelle dem stoischen Leser auf Grundlage der stoischen Psychologie kritisches Urteilsvermögen, um die emotionalen Eindrücke der Stücke adäquat zu verarbeiten.13 Wiener weist außerdem darauf hin, dass es wichtig sei, von dem Konzept „einer handbuchartig fixierten stoischen Lehre“14 abzurücken, und die Philosophie als dynamisches Konzept zu begreifen, mit dem man sich intensiv auseinandersetze. Besonders geeignet dafür sei die Gattung der Tragödie, weil sie ermögliche, das Verhalten der Menschen in außergewöhnlichen Extremsituationen zu beleuchten. Das bedeute, dass eine Abweichung vom orthodoxen stoischen Gedankengut nicht gleichzusetzen sei mit einer Abwendung von der Stoa als solcher. Gleichwohl muss ein Weg gefunden werden, um, ausgehend von dieser Prämisse der Flexibilität, die kritische Sichtweise auf das fatum zu erklären. Erklärungen setzen hier am Verständnis des fatum-Konzepts an.15 Boyle möchte den Begriff des fatum umdefinieren, um die Stücke verständlich zu machen, und versteht ihn nicht im Sinne von ‚Schicksal‘, sondern wortwörtlich als „what has been said.“16 Fischer legt hingegen dar, es sei zu unterscheiden zwischen dem physikalischen Begriff des Schicksals im Sinne einer kausalen Handlungskette, die mit fatum/natura gleichzusetzen sei, und dem ethischen. Im Folgenden zieht sie abwechselnd den jeweils besser zur individuellen Situation passenden Terminus heran.17 Diese Methodik löst zwar einige Widersprüche, es erscheint jedoch problematisch, Senecas fatum-Konzeption für sein tragisches Werk derart umdeuten zu wollen, zumal er selbst keinerlei Hinweise für eine solche Begriffsveränderung gibt. Es ist zwingend notwendig, von Senecas üblichem Begriffsverständnis auszugehen, um die Tragödien adäquat einordnen zu können. Eine Umdefinition von unbequemen Konzepten erscheint nicht legitim.
Die AnnäherungDe beneficiis an das fatum muss also auf inhaltlicher Ebene erfolgen, ohne den Epistulae moralesäußeren semantischen Rahmen zu verändern. Erschwert wird das Verständnis dadurch, dass die Begriffe fatum, deus und fortuna bei Seneca in den Tragödien oft ineinanderfließen.18 In den Prosaschriften grenzt er fortuna stärker vom fatum ab. Fischer definiert fortuna in den Tragödien als Wahrnehmung von fatum aus menschlicher Perspektive.19 Hierbei sei fortuna eine willkürliche, rational nicht begreifbare Macht, die mithilfe der virtus in Schach gehalten werden könne. Fortuna gerate somit zur Bewährungsprobe, an der man seine virtus beweisen könne.20 Auch Lefèvre ist der Ansicht, fatum und fortuna erschienen in den Tragödien nicht „als eine Macht, die dem Menschen böswillige Fallen stellt […], sondern vielmehr in der Funktion, daß sich der stoisch Gebildete als ihr gewachsen erweisen kann, ohne daß ihr Wirken nach moralischen Kriterien gemessen wird“, und weiter: „Auf die Fähigkeit, dem Geschick zu begegnen, kommt es ihm an; denn nicht, was der Mensch erträgt, ist entscheidend, sondern wie er es erträgt. […] Er kann sich stärker erweisen als alles von außen Einwirkende.“TragödienPhaedra21 Doch Senecas Protagonisten gehen allesamt zugrunde. Selbst Figuren wie Astyanax oder Polyxena, deren Ende etwas versöhnlicher erscheint, können höchstens erreichen, in Würde zu sterben, ein tieferer Sinn in Form einer ‚Bewährungsprobe‘ ist auch hier nicht ersichtlich.22 Lefèvre möchte das Scheitern aus einem bewussten Fehlverhalten erklären: „Wer Gott anerkennt und sich ihm unterwirft, ist in Wahrheit frei“,23 doch bringt die Unterwerfung unter das Schicksal keine Rettung. Sicherlich misst die stoische Lehre dem Menschen trotz seiner Determination eine gewisse Selbstverantwortung für das eigene Handeln zu, da ihm durch seine ratio die Möglichkeit gegeben ist, sich für das Richtige zu entscheiden.24 Dies beinhaltet somit auch die Freiheit zum Schlechten.25 Lefèvres Deutung allerdings, der Mensch stehe durch diese Entscheidungsmöglichkeit über dem fatum,26 ist problematisch. Scheint sie noch für eine Medea, Phaedra oder einen Atreus zu funktionieren, deren falsche Entscheidungen dadurch erklärbar sind, dass sie von Affekten geleitet und nicht von Vernunft motiviert sind,27 beginnt das Konzept bei den TroadesTragödienTroades oder im OedipusTragödienOedipus zu wanken. Die Existenz dieser Figuren erscheint in der determinierten Welt absurd, da kein Versuch, ihre Situation zu verbessern, einen Ausweg bietet. Diese negative Sichtweise auf das Schicksal als willkürliche, unverständliche Macht scheint der Auffassung des zumeist in den Prosaschriften skizzierten fatum als lenkende, wohlwollende Instanz diametral entgegengesetzt.28 Lefèvres Idee, für diese problematischen Stücke die Präsenz einer göttlichen Macht zu negieren,29 ist ebenfalls schwierig. Senecas Protagonisten kommen gerade wegen der stets gegenwärtigen Allmacht des fatum ständig an ihre Grenzen und gehen daran zugrunde. Doch dies macht die Stücke nicht unstoisch, im Gegenteil: Sie sind geprägt von einem unverrückbaren Glauben an die Existenz eines fatum als alles regierender Instanz. Was sie aufzeigen, sind die negativen Auswirkungen, die dieses Weltprinzip für das Individuum haben kann. Die Tragödien stellen keinesfalls einen Versuch dar, stoische Konzeptionen zu negieren, sondern sie zu relativieren. Es wird aufgezeigt, dass die eigene Existenz in Extremsituationen nicht immer sinnhaft erklärbar sein kann. Dies jedoch wie Fischer als Aporie zu bezeichnen, geht zu weit: So stellt Fischer für die TroadesTragödienTroades die Überlegung an, Seneca wolle hier gar keine Antwort geben, sondern es werde „in diesem Drama nur die Vereinbarkeit von Determination und menschlicher Willensfreiheit visualisiert […] und nicht das Theodizeeproblem.“30 Die Frage nach Determination und Willensfreiheit ist indes ein notwendiger Schritt im Umgang mit dem Theodizeeproblem. Ferner zeigt Seneca durchaus Möglichkeiten auf, wie man trotz der scheinbaren Absurdität des Seins einen Weg finden kann, um daran nicht zugrunde zu gehen.
Insgesamt ist es schwierig, sich dieser Problematik zu nähern, da Seneca selbst nirgends Hinweise auf die Deutung seiner Tragödien gibt und so keinerlei externe Hilfestellung bietet, um die Stücke besser zu verstehen. Allerdings steht dies nicht im Widerspruch zu einer philosophisch-didaktischen Intention Senecas. Wiener legt dar, dass die senecanischen Tragödien nicht dazu gedacht seien, konkrete Inhalte zu lehren, sondern eine Sichtweise auf eine sehr viel komplexere Welt zu ermöglichen und somit vielschichtigere Fragestellungen zu präsentieren, als es in Senecas philosophischen Traktaten der Fall sei.31 Die Tragödien seien ein multidimensionales System, das eine große Fülle an Demonstrations- und Exemplifikationsmöglichkeiten bietet. Problematisch sei jedoch die Frage, wie Seneca sichergehen könne, dass der Leser die erwünschten Schlüsse ziehe.32
Hierfür hat Seneca den Dramen einen stückimmanenten Überbau beigegeben, der die Komplexität des Stückes vereinfacht und es dem Rezipienten ermöglicht, den Argumentationsverlauf der Tragödie und damit ihre Interpretation selbst zu erschließen. Es handelt sich hierbei um einen Part, dessen Funktion mindestens genauso umstritten ist wie die Tragödien selbst: die Chorlieder.