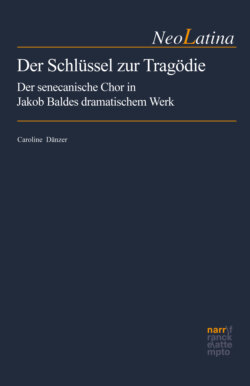Читать книгу Der Schlüssel zur Tragödie - Caroline Dänzer - Страница 18
4.1.2. Göttliche Strafe für vorsätzlichen Frevel
ОглавлениеCreon kehrt vom Orakel zurück und referiert dessen Antworten. Diese sind voll von manifesten Anspielungen auf OedipusTragödienOedipus.1 Trotzdem sind weder Creon noch OedipusTragödienOedipus selbst in der Lage, den Inhalt zu verstehen (responsa dubia sorte perplexa iacent, 211). OedipusTragödienOedipus versucht deswegen, die Umstände des Todes von Laius genauer zu ergründen und befragt Creon ausführlich zu den Begebenheiten. Auch hier findet sich eine Vielzahl von deutlichen Hinweisen auf seine eigene Beteiligung, doch anstatt die Wahrheit zu finden, entfernt sich OedipusTragödienOedipus immer mehr von der Erkenntnis, der er doch während seines Prologs schon recht nahe gekommen TragödienOedipuswar.TragödienOedipusTragödienOedipus2 Um mit Hilfe der Götter die Lösung zu finden, wird der blinde Seher Tiresias herbeigerufen, um zusammen mit dessen Tochter Manto eine Opferschau zur Erhellung von Apolls Willen zu vollziehen. Sowohl das Verhalten der Flammen (307–334a) als auch der Opfertiere (334b–344), das Aussehen der Wunden (345–351) und schließlich der Eingeweide (352–383) geben Hinweise auf OedipusTragödienOedipus, doch dieser sieht sich weiterhin außer Stande, die Zeichen zu deuten.TragödienOedipusTragödienOedipus3 Das Extispicium zeigt deutlich: Allem Aufwand zum Trotz, der hier betrieben wird, bleiben die Götter unverstanden. Sie geben zwar Hinweise auf OedipusTragödienOedipus als Ursache des Leids, aber diese sind zu kryptisch, um für einen nicht Eingeweihten verstanden zu werden. Ferner fehlt jegliche Anleitung, um die Situation zu verbessern. Die Götter stellen den Menschen vor vollendete Tatsachen. Sich um sie zu bemühen, ist im Grunde nutzlos. Diese Einstellung mag epikureisch anmuten, doch gibt es in Senecas Konzeption einen wesentlichen Unterschied: Eine göttliche Macht existiert nicht nur, sondern plant aktiv das Leben der Menschen und lenkt es unerbittlich in die vorgeschriebenen Bahnen. In Thebens Schicksal ist dabei eine gütige providentia nicht zu erkennen.4 Die menschliche Existenz wird damit absurd.TragödienOedipus5 Schließlich wird der Entschluss gefasst, eine Totenbeschwörung durchzuführen, um Laius selbst nach seinem Mörder zu fragen. Am Ende des zweiten Aktes findet somit eine Abwendung von der Vorgehensweise statt, bei den Göttern Hilfe zu suchen, da diese zweimal gescheitert war.
Das zweite Chorlied (403–508) ist ein Loblied auf Bacchus. Hier wird oft ein unlogischer inhaltlicher Bruch gesehen.6 Doch Bacchusenkomien sind in der Tragödie durchaus üblich, da sie der Funktion des Gottes als Patron des Theaters Rechnung tragen.7 Außerdem hatte Tiresias das Preislied explizit angeordnet (populare Bacchi laudibus carmen sonet, 227). Schließlich ist Bacchus der Schutzgott Thebens.8 Dass hier ein rituelles Preislied für den Stadtpatron TragödienOedipusgesungen wird, ist eine nachvollziehbare Handlung. Im ersten Lied hatten die Bürger Thebens ihr Leid geklagt, im zweiten machen sie sich auf die Suche nach Hilfe und wenden sich an ihren göttlichen Beschützer. Außerdem steht das Chorlied in direktem Bezug zur vorhergegangen Handlung des zweiten Aktes, da sie in Form einer lyrischen mise-en-abyme wichtige Kernelemente zusammenfasst.
Der hymnische Charakter ist in den ersten beiden Versen durch den daktylischen Hexameter bestimmt.9 Zunächst wird Bacchus in all seiner Herrlichkeit beschrieben und um Schutz gebeten (403–428). Auffällig ist die Betitelung des Gottes als lucidum caeli decus, die eigentlich Apoll vorbehalten ist.10 Dieser hatte bisher jedoch keine Hilfe bringen können. Seine göttlichen Eigenschaften werden nun auf Bacchus übertragen. Zudem wird er mit einer Vielzahl an Attributen bedacht, die Fruchtbarkeit, Sanftheit und blühendes Leben implizieren.11 Bacchus bildet so eine Kontrastfigur zur Dürre und Ödnis, die Theben in der Gewalt haben und mit Apoll assoziiert werden. Der Chor betont im Folgenden die militärische Stärke von Bacchus. Das Motiv der Feldzüge in alle Weltregionen, das im ersten Chorlied bereits angeklungen war, wird aufgegriffen und weiter ausgebaut.12 Bacchus erscheint als unwirkliche Lichtgestalt in all der Not, die die Thebaner erleiden. Der Gebetsstil wird durch die te-Anapher aufrechterhalten, es handelt sich also weniger um einen impliziten Vorwurf als um ein flehentliches Bitten, das aber durchaus vom do-ut-des-Gedanken motiviert ist.
Im Weiteren preist der Chor das Gefolge des Bacchus (429–444). Dessen erster Vertreter ist ein angetrunkener Silen (429–430), auf den die Maenaden folgen, deren Taten der Chor beschreibt. Zuerst wird anhand geographischer Hinweise auf die Geschichte von Orpheus angespielt, der von den Bacchantinnen zerrissen wurde (432–435). Orpheus habe als Sänger dem Gott Apollon nähergestanden als Bacchus, was diesen erzürnt habe. Sodann folgt die Rückwendung nach Theben mittels der Pentheusgeschichte.TragödienOedipus13 Pentheus hatte sich als Frau verkleidet, um das Treiben der Maenaden heimlich zu beobachten und sich somit über das Verbot von Bacchus hinwegzusetzen. Die von Bacchus in Rausch versetzten Maenaden bemerken ihn jedoch und töten ihn. Besonderes Augenmerk gilt der Mutter von Pentheus, Agaue, die ihren eigenen Sohn zerrissen habe. Für Agaues Verbrechen werden die Begriffe impia und nefas gebraucht, als Hinweis auf einen Verstoß gegen die göttliche Weltordnung. Das zerstörte Mutter-Sohn-Verhältnis ist eine weitere manifeste Anspielung auf OedipusTragödienOedipus, der durch den Inzest mit Iocaste ebenfalls die Familiengesetze außer Kraft setzt.TragödienOedipusTragödienOedipus14 Allerdings sind die Handlungen der Maenaden und insbesondere die von Agaue nicht selbstverschuldet, sondern durch Ekstase provoziert worden.15 Dies gibt dem Abschnitt einen negativen Beigeschmack, da Bacchus offensichtlich nicht davor zurückschreckt, wehrlose Marionetten zu schaffen und für eigene Rachegelüste zu instrumentalisieren.16 Zwar erscheint Bacchus umso mächtiger, doch missbraucht er seine göttliche Gewalt für egoistische Zwecke. Das ambivalente Bild verstärkt sich in den folgenden Abschnitten des Liedes.
Es werden weitere Taten des Gottes in Erinnerung gerufen. Zunächst werden seine Triumphe zu Wasser genannt. Der Chor erzählt die Geschichte von Ino (445–448), der Amme des Gottes, die Bacchus als Säugling zusammen mit ihrem Mann Athamas vor der eifersüchtigen Iuno verbarg. Aus Rache trieb Iuno Athamas in den Wahnsinn, der daraufhin seinen Sohn Learchos tötete. Ino stürzte sich auf der Flucht vor ihrem Mann mit ihrem Sohn Melicertes ins Meer. Bacchus entschädigte beide daraufhin für ihre Leiden und erhob sie zu Meergottheiten.17 Hier zeigt sich, dass der Gott ebenfalls in der Lage ist, treue Anhänger zu belohnen. Ino und Athamas begehen zwar einen vorsätzlichen Frevel gegen Iuno, dieser wird durch ihre Verdienste Bacchus gegenüber jedoch wieder aufgewogen. Allerdings erhält nur Ino als Ziehmutter des Gottes diese Belohnung, Athamas hingegen bleibt wie schon zuvor Agaue ein Spielstein im Machttreiben der Götter.TragödienOedipus18
Gänzlich ungnädig verhält sich Bacchus, als er von Piraten geraubt wurde, die er zur Strafe in Delphine verwandelte (449–466). In diesem Abschnitt wird einmal mehr die Gabe von Bacchus, Fruchtbarkeit zu schaffen, gezeichnet, als er mithilfe des Meergottes Nereus auf der Seeräuberfregatte eine blühende Tier- und Pflanzenwelt entstehen lässt.19 Die Häufung der Flora und Fauna beschreibenden Begriffe in wenigen Versen wirkt erdrückend, oft treten schmückende Epitheta hinzu, und die kraftstrotzenden Tiere haben mit dem dahinsiechenden Vieh in Theben nichts zu tun. Deutlich baut sich hier erneut der Kontrast zur todbringenden Dürre des Anfangs aus.
Es folgen die Siege des Gottes zu Land. Es werden Beispiele von Menschen genannt,20 die sich Bacchus widersetzt hatten und dessen Macht zu spüren bekamen: Midas (467–468), unterworfene Stämme wie die Geten (469) und die Massageten (470),21 Lykurg (471),TragödienOedipus22 verschiedene Nordvölker (472–477), die Gelonen (478) und schließlich die Amazonen (479–483), die nach ihrer Niederlage gegen den Gott zu Maenaden wurden und sich seinem Gefolge anschlossen. Der Chor wendet sich nun erneut dem Pentheusmord zu (484–485). Nur diese Episode kommt zweifach vor. Ausschlaggebend hierfür ist die Verbindung mit OedipusTragödienOedipus, auf die hier noch offensichtlicher angespielt wird. Der Berg Cithaeron (484), der erwähnt wird, ist nicht nur der Schauplatz des Mordes an Pentheus, sondern zugleich der Ort, an dem OedipusTragödienOedipus als Säugling ausgesetzt wurde.TragödienPhoenissae23 Den Zuschauern, die die Geschichte bereits kennen, muss sich aufgrund dieses Wissensvorsprungs folgende Assoziation aufdrängen: Dort, wo Pentheus für seinen Frevel bestraft wurde, nahm der des OedipusTragödienOedipus seinen Anfang. Indem er überlebte, muss er sein Schicksal unweigerlich erfüllen. Es folgt die Geschichte der Proetustöchter (486–487), die von Bacchus in den Wahnsinn getrieben wurden, da sie ihm den Dienst verweigert hatten.
Zum Abschluss des Liedes wird von einer Wohltat des Gottes berichtet, der Errettung der Ariadne (488–503), als diese von Theseus verlassen wurde. Die detaillierte Beschreibung der Hochzeitsfeier kontrastiert noch ein weiteres Mal scharf mit der Pestschilderung des ersten Chorliedes: Schließlich wird Ariadne vergöttlicht, Apoll (498), Cupido (500) und sogar Jupiter (502) stehen Spalier. Es erscheint so, als habe Bacchus den gesamten Götterhimmel fest im Griff. Das Lied endet in hymnischen Versen, in denen das thebanische Volk Bacchus ewige Treue schwört und um Hilfe bittet.
Das zweite Chorlied bietet einen Versuch, das geschilderte Leid des ersten Liedes zu begreifen, indem es die Rolle der Götter in den Blick nimmt. Es erwägt die Möglichkeit der Pest als einer gottgesandten Strafe für unrechtes Verhalten, die man durch die adäquate Reaktion wieder abwenden kann. Auffällig ist, dass sich die Personen in allen erwähnten Mythen bewusst gegen den Gott aufgelehnt und die Strafe in Kauf genommen haben.24 Hier ist somit auch der Tatbestand auf subjektiver Ebene erfüllt. Das Belohnungs- und Bestrafungssystem von Bacchus funktioniert nach dem vergilischenVergil Prinzip des parcere subiectis et debellare superbos. Wer sich seinen Gesetzen beugt, wird gerettet, wer sich widersetzt, wird vernichtet. Es liegt hierin also die Möglichkeit, das Leid zumindest rational begründen zu können. Dies entspricht dem Denkmuster des OedipusTragödienOedipus, der versuchte, mittels der Orakelbefragung über eine göttliche Instanz Antwort und Hilfe zu erlangen und so einen eventuellen Fehltritt wieder gut zu machen. Der dritte Akt geht dieser Vorstellung weiter auf den Grund.