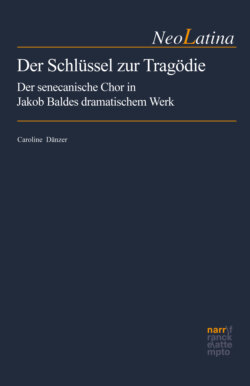Читать книгу Der Schlüssel zur Tragödie - Caroline Dänzer - Страница 14
2. Die verschiedenen Deutungen der Chorlieder
ОглавлениеTrotz manifester Probleme und ihrer noch immer strittigen Funktionsweise werden die Chorlieder in aktueller Forschungsliteratur oft einfach übergangen. So fehlen Untersuchungen zum Chor sowohl im aktuellen Brill’s Companion to Roman Tragedy1 als auch im Cambridge Companion to Seneca..2 Die wichtigsten Deutungsrichtungen seien an dieser Stelle exemplarisch umrissen. Leos Stigmatisierung der Lieder als Zwischenaktspiele3 und damit die Degradierung hin zu reinen ἐμβόλιμα wird inzwischen von der Forschung weitgehend abgelehnt. Ein Handlungsbezug wird vor allem auf der Ebene einer inhaltlich-thematischen Beziehung gesucht.4 Hierbei lassen sich verschiedene Kategorien klassifizieren, die Hand in Hand mit den Deutungsversuchen der Tragödien insgesamt gehen: Besonders häufig werden die Chorlieder als Ausdrucksmittel von philosophischen Haltungen gesehen.5 Ferner werden politische Elemente herausgearbeitet, um die Annahme zu stützen, die Tragödien seien dazu bestimmt, die „politische pravitas“6 aufzuzeigen. Neben diesen inhaltlichen Zuordnungen finden sich Interpreten, die im senecanischen Chor vor allem ein technisches Element sehen wollten, das beispielsweise Zeit für Kostümwechsel ermögliche7 oder der reinen Unterhaltung diene.8 Einige Analysen konzentrieren sich auf die Metrik, die jedoch sehr mechanisch und wenig auf ihre Bedeutung untersucht wird.9 Bisweilen werden die Chorpassagen als Redeteile gesehen und tragen somit der Meinung Rechnung, die Tragödien hätten vor allem rhetorischen Charakter.10
Dass politische und philosophische Ebenen in die Chorlieder eingebettet und nicht einfach voneinander zu trennen sind, ist inzwischen hinreichend erwiesen.11 Strittiger ist, in welchem konkreten Zusammenhang die Chorlieder zur Aussage der gesamten Tragödie stehen und nach welchem System sie funktionieren. Als problematisch wird hier vor allem die Tatsache bewertet, dass der Inhalt der Chorlieder oft widersprüchlich erscheint, sei es, dass einzelne Lieder konträre Positionen verträten oder dass sich diese nicht mit der dramatischen Handlung vereinbaren ließen. Zwierlein sieht diese Inkonsequenzen gar als Beweis für eine Nichtaufführbarkeit der TragödienTroadesStücke.12
Ein Erklärungsansatz hierfür beruht auf der Methode, die Lieder als selbstständige Einheit und losgelöst von der dramatischen Handlung zu betrachten. Töchterle nimmt die Konzeption der Chorlieder schon bei den griechischen Tragikern als „stock of songs“ an, also als thematischen Fundus, aus dem sich der Autor bedienen konnte, um passende Chorlieder später für die jeweilige Tragödie auszuwählen.13 Als losgelöst von der Handlung betrachtet auch Haywood die Chöre und klassifiziert sie als „individual pieces of lyric poetry.“14 Auch Cattin erwägt die Möglichkeit, die Chorlieder seien ganz ohne Bezug zu einem bestimmten Stück geschrieben worden.15 Cattin ordnet die Lieder bzw. sogar einzelne Verse verschiedenen thematischen Untergruppen zu („Les thèmes philosophiques, pathétiques, pittoresques“), wobei ein Mehrwert auf interpretativer Ebene jedoch nicht erreicht wird.16 Davis sieht einen engeren Bezug zwischen Chor und Handlung. Ein wichtiger Schritt in seiner Arbeit ist das Aufzeigen von Parallelen einzelner Junkturen in Chorliedern und Sprechpartien der jeweiligen Tragödie, was der „stock of songs“-These deutlich widerspricht. Er kommt zu dem Schluss, hervorzuheben sei die „significance of choral odes for interpretation of the plays.“17 Dabei müsse man jedoch scharf unterscheiden zwischen Seneca dem Philosophen und Seneca dem Dramatiker. Der philosophische Inhalt der Chorlieder sei lediglich zu dramaturgischen Zwecken gebraucht, um beispielsweise zu vertiefen, wie eine Figur denke oder fühle.18 Dies erscheint oberflächlich. Dass viele Lieder tiefgehenden philosophischen Gehalt haben, ist schwer von der Hand zu weisen. Deren sinnhafter Zusammenhang wird freilich zerstört, wenn man die Chorpartien, wie es in der Untersuchung von Davis geschieht, ebenfalls aus ihrem Kontext löst und nur die Bezüge zur Handlung zulässt, die in das Interpretationsschema passen. So klassifiziert Davis die Lieder in die Unterkategorien mythology, philosophy und prayer und nutzt somit die Ergebnisse, die er über die Verknüpfung von Akt und Chorlied gewonnen hatte, kaum. Auch Mazzoli stellt den Zusammenhang zur Handlung in der Zuordnung der Chorlieder zu verschiedenen Kategorien her, die in jeweils unterschiedlichem Beziehungsgrad zum Aktgeschehen stünden. So unterscheidet er Kategorie K (kairós) als realen Bezug zur dramatischen Handlung, G (gnomé) für allgemeine Sinnsprüche und M (mythos), für mythische Beispiele und Verweise.19 Zwar lassen sich die Lieder leicht nach diesem Schema klassifizieren, jedoch führt diese Zuteilung auf inhaltlich-interpretativer Ebene nicht weiter.
Die Ablösung der Chorlieder von der Handlung und deren Neuordnung nach Untergruppen trägt keinesfalls dem ursprünglichen Kompositionsprinzip Rechnung, da der Chor so aus dem dichten Geflecht gerissen wird, in dem er eigentlich geschaffen wurde. Dass die Chorpassagen offensichtlich als integraler Bestandteil eines bestimmten Theaterstückes konzipiert und nicht als separates Liederbuch komponiert worden sind, beweisen manifeste Bezüge und Einbettungen in den ganz spezifischen Kontext sowie in einen festgeschriebenen Gedankenverlauf.
Gil betrachtet zwar die Lieder noch als losgelöst von der restlichen Tragödie, hält den Chor jedoch immerhin für ein Hilfsmittel zum Verständnis der Stücke. Problematisch ist dabei seine Auffassung, der Chor gebe „Hinweise, die dem Leser genügen, um die Handlung stoisch zu beurteilen.“20 Dies lässt sich nur auf einige wenige Lieder anwenden, denn eine große Anzahl ist gerade nicht stoischen Inhalts und scheint eher Verwirrung als Klarheit zu stiften. Gil unterteilt deshalb in Lieder mit und ohne Handlungsbezug.21
Stevens kommt zu dem Schluss, der Chor sei ein „completely ignorant observer whose impressions create ambiguity and tempt the audience to misunderstand the action.“22 Dieser Ansatz sieht den tragischen Chor als Kontrastfolie zum Aktgeschehen. Der Chor sei ein „uninformed informer“, der naiv die Geschehnisse auf der Bühne interpretiere und die Entscheidung, welche seiner Sichtweisen zu übernehmen oder zu verwerfen seien, dem Urteil des Rezipienten überlasse.23 Diese scheinbare Naivität des Chores deutet Stevens als ironische Umkehrung des allwissenden griechischen Chores.24 Eng an diese Deutung schließt sich Fischer an, die im Chor einen Widerhall von „populärphilosophische[n] Meinungen“25 und damit keinen Vermittler von ernstzunehmenden Aussagen des Stückes sieht.26 Das Problem an Stevens und Fischers Auffassung des Chores ist, dass diese Erklärung nur für die Lieder Gültigkeit beanspruchen kann, in denen tatsächlich Widersprüche zur Handlung nachzuweisen sind. Oftmals entsprechen die Chorpartien jedoch dem senecanischen Weltbild.
Weiter greift der Ansatz von Kirichenko: Er nimmt zunächst an, dass der senecanische Chor „nur die Rolle eines klassischen tragischen Chors spielt.“27 Der Chor verfügt somit über eine gewisse Distanz und präsentiere sowohl Wahres als auch Falsches, erzeuge aber gerade durch die Vermengung zwischen Fiktion und Wahrheit eine emotionale Erschütterung beim Leser, die diesem den Weg zu einer intellektuellen Erkenntnis eröffne.28 Gerade in der Widersprüchlichkeit der Aussagen des Chores liege somit dessen Funktion als ‚lehrreiches Trugbild‘: „Die auf den ersten Blick zerrissene, sich selbst widersprechende Stimme des Chors erweist sich somit paradoxerweise als diejenige Instanz, die den disparaten, verwirrenden Sinneseindrücken, denen wir in Senecas Tragödien ausgesetzt sind, eine einheitliche Bedeutung verleihen kann. Es handelt sich dabei natürlich nicht um den – einzig richtigen – Sinn der jeweiligen Tragödie […], sondern um einen anhand des Bühnengeschehens erzielten Sinnesentwurf.“29 Kirichenko betont hier zurecht die Konzeption der senecanischen Tragödien als Pool von Möglichkeiten, die sich für die Interpretation eröffnen. Genauso wenig bleiben die Chorlieder auf eine einzige Deutungsrichtung beschränkt. Allerdings ist es wichtig festzuhalten, dass die Chorlieder nicht einfach willkürlich Übereinstimmungen oder Widersprüche in sich und zur Handlung aufweisen, sondern dass sie sich auf ein geordnetes System zurückführen lassen.
Bishops Arbeiten zum Chor betonen diese strukturierte Komposition der Chorlieder. Er nimmt an, dass sich die Tragödie in zwei Stränge unterteilen lasse, die dramatic line, also die Bühnenhandlung, und die odic line, die Handlung in den Chorliedern.30 Diese beiden Ebenen verliefen zwar parallel zueinander und seien vielfältig miteinander verzahnt, doch für sich genommen autark.31 Dennoch ergebe sich der volle Sinn der beiden Komponenten erst durch ihr Zusammenspiel: „The odic line is only an interesting series of poems unless the dramatic line is there to work out the tragedy; the dramatic line is only a series of savage, blunt-edged disasters without the catastrophe-building functions of the odes.“32 Bishop legt sodann einen schematischen Ablauf fest, nach dem die Oden funktionierten: Das erste Lied (directive ode) erläutere allgemeine Prinzipien, alle weiteren verstärkten Einzelaspekte oder fügten neue hinzu.33 Dieser Aufbau lässt sich jedoch nicht konsequent durchhalten. Gerade bei Liedern, die einander zu widersprechen scheinen, müssen Unstimmigkeiten mühsam weginterpretiert oder ignoriert werden, um das Konstrukt beizubehalten. Insgesamt fehlt Bishops Arbeit eine tiefergehende interpretative Anwendung seines Systems. Erst in der Conclusio wird eine politische Ebene in Betracht gezogen und werden fragwürdige direkte Zuschreibungen einzelner Tragödienfiguren zu Zeitgenossen Senecas vorgenommen. Wie genau die Chorlieder zu dieser politischen Deutung beitragen, bleibt letztlich vage.34 Dennoch bildet Bishops These in Zusammenschau mit den zuvor genannten Ansätzen eine hilfreiche Grundlage, um das senecanischen Chorkonzept zu beschreiben.
Das Problem der Widersprüchlichkeit der Chorlieder ist außerdem eng verzahnt mit der Frage nach der personalen Zuordnung des Chores. Gärtner fasst den senecanischen Chor nicht als homogene Gruppe auf, sondern unterteilt ihn in zwei Chorgruppen. So gebe es „zwei grundverschiedene Typen der Chorgestaltung […]: einerseits den unbeteiligt aus einer Position programmatisch gepriesener Mittelmäßigkeit heraus das Unglück der hochgestellten Helden beobachtenden und analysierenden Chor, andererseits die konträre Spielform eines selbst am Leiden der Großen beteiligten und in der Bewältigung dieses Leidens absorbierten Chors.“35 Auch Sutton trifft eine Unterscheidung in primary and secondary choruses.36 Strohs Darlegungen gehen in eine ähnliche, allerdings stärker auf die Dramaturgie konzentrierte Richtung, wenn er für die TroadesTragödienTroades unterschiedliche Chöre annimmt, die sich auf der Bühne abwechselten.37 Trotz seiner Variabilität ist es unwahrscheinlich, dass Seneca an den Einsatz unterschiedlicher Chöre in seinen Stücken gedacht hat. Vielmehr scheint der Chor als vielfältiges Medium konzipiert zu sein. Er verkörpert zwar zumeist eine bestimmte soziale Gruppe, doch diese Zuordnung wird nicht bis in die letzte Konsequenz verfolgt. Neben der Funktion, zwischen Lied und Aktgeschehen überzuleiten, sind die lyrischen Partien an sich in erster Linie Erklärinstanz der dramatischen Handlung. In seiner Rolle als Handlungsdeuter muss der Chor dabei nicht gesichtslos sein, sondern die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppierung, zumeist zu dem jeweiligen betroffenen Volk, erleichtert diese Aufgabe sogar. Indem der Chor durch die Handlung selbst betroffen wird, scheint seine Deutung unmittelbarer und glaubhafter als die eines außenstehenden Beobachters. Der Chor wird so auch zur Mittlerfigur zwischen Stück und Publikum. Dabei treibt er die Handlung nicht voran, sondern er vertieft ihre Deutung. In diesem Sinne dürfen die Chorlieder nicht als direkte Reaktion auf die Handlung, sondern als deren verknappte Zusammenfassung auf reflexiver Ebene gesehen werden. Dass sich hierbei Widersprüche ergeben, entspricht der natürlichen Abfolge einer Auseinandersetzung mit einem Problem, die verschiedene Argumente gegeneinander abzuwägen sucht. Kontroversen in der Gedankenführung sind hierbei nicht nur geduldet, sondern sogar erwünscht.
Folgendes ist festzuhalten: Die Chorlieder nehmen trotz ihrer Eigenständigkeit vielfach Bezug auf das Aktgeschehen und müssen deshalb mit ihm in Verbindung gesetzt werden. Das Verhältnis von Chorpartien und dramatischer Handlung muss also auf ein komplexeres System zurückgeführt werden. Zunächst ist es zwingend notwendig, bei der Analyse des Chores niemals aus den Augen zu verlieren, worauf er referiert, und die Lieder deshalb an eben der Position ernst zu nehmen, an der sie sich im Stück befinden. Ferner ist es unmöglich, die Chorlieder auf eine einzige Deutungsrichtung hin reduzieren zu wollen.38 Die Stücke sind maßgeblich geprägt von ihrem Verfasser, der die Person des Philosophen, Politikers, Rhetors und Erziehers in sich vereint.39 Diese Prämisse gilt nicht nur für die Chorlieder, sondern für die Deutung der Tragödien insgesamt. Gerade diese Vielschichtigkeit erschwert gleichwohl ihre Fassbarkeit. Hierdurch besteht die Gefahr, das Wesentliche aus dem Blick zu verlieren.40 Es ist somit wichtig, sich vor dem Hintergrund der Mehrdeutigkeit die Frage nach der Hauptintention der Stücke zu stellen. Diese ist im Kern stets philosophisch-theologischer Natur, wobei die eingangs skizzierte Theodizeeproblematik eine wichtige Rolle spielt. Dass zusätzlich weitere Ideen aus anderen Bereichen einfließen, ergibt sich zwangsläufig aus der Person des Schreibers selbst, dessen Erfahrungen und Sichtweisen den Tragödien eine politische und pädagogische Couleur geben.
Man muss also bei der Betrachtung von Senecas Tragödien nach der Leitidee suchen, die das Stück zusammenhält. Diese ist jedoch nicht nur implizit in die Handlung der Dramen eingewoben, sondern explizit formuliert in den jeweiligen Chorpartien: Die ‚odic line‘ ist nicht einfach nur erweiternde Parallelhandlung, sondern dient der Interpretation der ‚dramatic line‘. Allerdings darf nicht ein einzelnes Lied für sich als Interpretationsaussage gesehen werden, sondern die Gesamtheit aller Chorpartien in einer Tragödie. Der Chor fungiert gleichsam als Prozesshelfer, der den Rezipienten beim Verständnis der Tragödie unterstützt. Dabei bilden die einzelnen Lieder nacheinander den Verstehensprozess ab, der letztlich zur Erkenntnis der Stückaussage führt. Widersprüche und Kontraste sind deshalb erlaubt, da Fehlschlüsse und Rückschritte natürlicher Bestandteil dieses Vorgangs sind.