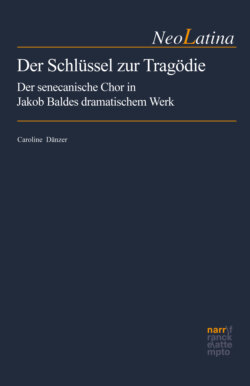Читать книгу Der Schlüssel zur Tragödie - Caroline Dänzer - Страница 20
4.1.4. Utopie: Selbstbestimmung des Menschen
ОглавлениеOedipusTragödienOedipus erscheint wie verwandelt. So befindet er sich beinahe in derselben Stimmung wie im Prolog, als er, von dunklen Ahnungen geplagt, der Wahrheit schon nahe war. Er hat wieder eine reflexive Grundhaltung eingenommen, hält zum ersten Mal seit seiner Anfangsrede wieder einen Monolog (764–775) und besinnt sich auf sich selbst zurück.1 Er erinnert sich, lange vor seinem Regierungsantritt einen Mann im Streit erschlagen zu haben (768–769). Allerdings sieht er weiterhin keine Parallele zu dem Mord an Laius, hatte der Kampf doch fernab von Theben stattgefunden. Um einen Zusammenhang endgültig auszuschließen, forscht OedipusTragödienOedipus bei Iocaste genauer über die Umstände des Todes nach. OedipusTragödienOedipus muss in diesem Dialog (773–783) jedoch erkennen, dass tatsächlich er selbst Laius getötet hat (782–783). Um die Erkenntnis zu vervollkommnen, berichtet ein Bote vom Tod des Polybus und im Zuge dessen auch von der damaligen Adoption (802). Der Hinweis auf die entstellten Füße des Säuglings (812) und die Heranziehung des Hirten Phorbas, der dem Königspaar das Kind damals übergeben hatte, lassen keinen Zweifel mehr daran, dass es sich um OedipusTragödienOedipus gehandelt haben muss. Phorbas enthüllt schließlich auch das schreckliche Geheimnis des Inzests (coniuge est genitus tua, 867). Der folgende Monolog des OedipusTragödienOedipus kreist um die Strafe, die er für sich selbst für angemessen hält: Den Tod, an den er zunächst denkt, sieht er als unverhältnismäßig milde für seine Taten an und fordert sich zu einer noch härteren Selbstbestrafung auf (aude sceleribus dignum tuis, 879). Nach diesem Entschluss eilt er zum Palast, um Iocaste zu informieren.
Der vierte Akt erklärt die Ursache der Pest: OedipusTragödienOedipus hat die Naturgesetze verletzt und somit seine ganze Stadt ins Unglück gestürzt. Die Tragik in der Figur des OedipusTragödienOedipus liegt darin, dass diese Missachtung der Natur nicht wissentlich geschieht, sondern gerade sein unbedingter Wille, die Prophezeiung zu vermeiden, ihn unerbittlich seinem Schicksal zuführt. OedipusTragödienOedipus hat versucht, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, ist damit jedoch gescheitert. Das vierte Lied (881–914) charakterisiert den Versuch einer freien Selbstbestimmung des Menschen als erstrebenswerte Utopie.
Die ersten Verse äußern den Wunsch, das Leben nach eigenem Ermessen gestalten zu können (fata si liceat mihi / fingere arbitrio meo, 882–883). Ausgehend von der Prämisse der Selbstbestimmung spinnt der Chor diesen Gedanken weiter und erörtert die Lebensführung, die er nach eigenem Willen wählen würde, nämlich den Lebensweg an der goldenen Mitte zu orientieren (tuta me media vehat / vita decurrens via, 890–891). Dieses Ideal wird durch Seefahrtsmetaphern verdeutlicht (883–889).Horazcarm.HorazTragödienOedipus2 Der Chor untermalt die These sodann anhand des Beispiels von Daedalus und Icarus (892–908). Icarus wird äußerst negativ gezeichnet. So haften ihm in der Schilderung des Chores die Attribute der Unüberlegtheit (demens, 893) und Selbstüberschätzung (nimis imperat, 896–897) an, seine Flugbahn zeuge außerdem von Tollkühnheit. Das Meer wird nicht nach Icarus benannt,Horazcarm.Horaz3 sondern Icarus nimmt dem Meer gewaltsam seine ursprüngliche Bezeichnung (nomen eripuit freto, 897). Icarus wird als Paradebeispiel für das Missachten der aurea mediocritas dargestellt. Der Chor resümiert diese Beispiele und Metaphern in einer allgemeinen Lebensregel: Alles, was das Maß übersteigt, habe keine stabile Grundlage (quidquid excessit modum / pendet instabili loco, 909–910). Hier ist erneut eine Zuschauerassoziation mit OedipusTragödienOedipus intendiert, der sich die Königsherrschaft angemaßt habe. OedipusTragödienOedipus hatte im Prolog selbst über die Gefahren dieser exponierten Position reflektiert.4
Der Chor wird an dieser Stelle jäh durch den Botenbericht eines Palastdieners unterbrochen. Es wirkt beinahe so, als hätte der Chor seinen Gedankengang noch nicht beendet, denn sein Bild des Lebens, das man nach freiem Willen und Maßgabe hehrer Ideale führen kann, verbleibt im Status einer Skizze, die noch schärferer Konturierung bedürfte. Doch die Weiterführung bleibt der Chor schuldig. Die Erklärung hierfür findet sich im letzten Chorlied. Auffällig im OedipusTragödienOedipus ist die Tatsache, dass es sich scheinbar um ein Stück mit sechs Akten und fünf Chorliedern handelt. Die letzten Akte sind jedoch eng miteinander verknüpft, was für die beiden letzten Chorlieder ebenso gilt. Das vierte Lied zeichnet die Utopie der Selbstbestimmung, das fünfte Lied beschreibt im direkten Anschluss daran die Realität des durch das fatum determinierten Menschen. Es handelt sich also vielmehr um eine Unterteilung der Lieder in 4a und 4b. Dasselbe gilt für die Schlussakte. Es würden sich für die letzten beiden Akte außergewöhnlich kurze Passagen ergeben. Auch inhaltlich ist der vermeintliche 6. Akt (998–1061) nicht mehr als ein kurzer Ausblick, um das Geschehen abzurunden, und hat somit den Status eines Epilogs. Es scheint plausibler, auch hier eine Unterteilung in 5a und 5b vorzunehmen.5