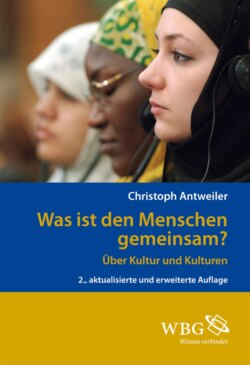Читать книгу Was ist den Menschen gemeinsam? - Christoph Antweiler - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.1 Universalistische Postulate allerorten
ОглавлениеAussagen über Universalien sind Feststellungen, die sich zwischen Allaussagen über Individuen und Allaussagen über ganze Gesellschaften bzw. Kulturen bewegen. Häufig werden sie pauschal auf den „Menschen an sich“, auf „die Menschheit“ (humanity, all humanity, humankind, mankind) bezogen, ohne zwischen Personen und Kulturen zu unterscheiden. Universalistische Aussagen finden sich quer durch mindestens die letzten 2000 Jahre der Geschichte. Plato etwa macht die universalistische Aussage, dass die ganze Menschheit, Griechen wie Nichtgriechen, an die Existenz von Göttern glaube. Auf dem Waschzettel eines kürzlich bei der WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) erschienenen Buchs lesen wir eine ähnlich weit reichende Feststellung: „Rituale ermöglichen die Bewältigung kritischer und sozialer Situationen. Sie treten in ausgefeiltester Weise in allen Kulturen und Epochen auf.“ (Ambos et al. 2005)
Es scheint selbst eine Universalie zu sein, dass Menschen sich für die „Natur des Menschen“ und spezifischer für das Spannungsfeld zwischen Universalität und Spezifik der Kulturen interessieren. In Zeiten kultureller Begegnung, Mischung und Hybridität verstärkt sich dieses Bedürfnis. In Interviews werden Wissenschaftlern gerne Fragen gestellt wie diese: „Was ist stärker ausgeprägt: die Verschiedenheit der Menschen oder ein gemeinsamer Nenner, der sie trotz unterschiedlicher kultureller Prägung miteinander verbindet?“ (Wiegand 1999:42) Besonders häufig findet man universalistische Aussagen bei Prominenten oder Wissenschaftlern in Interviews in den Massenmedien. Hier ein aktuelles Beispiel aus einem Interview mit einem Psychologen zum Thema Casting-Shows:
Frage: „Ist der Wunsch, berühmt zu werden, ein menschliches Grundbedürfnis? Antwort: „Nein. Man darf nicht vergessen, dass es Millionen Jugendliche gibt, die sich lieber eine Hand abhacken würden, als sich auch nur für eine Sekunde zum Affen zu machen. Der Wunsch nach Zuwendung und Aufmerksamkeit ist allerdings eine anthropologische Konstante.“ (Ernst & Ottenschläger 2003:142)
In wissenschaftlichen Texten liest man universalistische Aussagen selten so explizit wie in der folgenden Passage aus einem populärwissenschaftlichen Bestseller über Universalien auf der Ebene der Individuen: „Allen Indizien zufolge ist die Art, wie Menschen sehen, sprechen und über Gegenstände oder andere Menschen nachdenken, überall auf der Erde grundsätzlich die gleiche.“ (Pinker 1998:50) Annahmen über Kulturuniversalien finden sich vielfach in wissenschaftlichen Texten innerhalb und außerhalb der Ethnologie, wenngleich zumeist weniger markant. Noch relativ deutlich ist etwa Wolfgang Marschall, wenn er schreibt: „Identifikationsbemühung macht einen wichtigen Anteil menschlicher Aktivität aus“ (Marschall 1990:8). Weit häufiger finden sich universalistische Aussagen über das „Wesen“, die „Natur“ oder die „Merkmale“ des Menschen aber nur als implizite Vorverständnisse, etwa in Lehrbüchern, z.B. der Ethnologie, Psychologie oder etwa der Wirtschaftswissenschaften. Universale Aussagen zu ethnologischen Themen finden sich vielfach in der popularisierten Ethnologie, z.B. in ethnologischen Museen oder in Fernsehbeiträgen. Im Faltblatt zum Neubau des Rautenstrauch-Joest-Museums für Völkerkunde in Köln (aus dem Jahr 2005) findet sich etwa der Satz:
„Ausgangspunkt für das neue Haus am Neumarkt im Herzen der Stadt sind Themen, die Menschen überall auf der Welt bewegen, denen sie aber je nach regionaler und kultureller Prägung auf eigene Weise begegnen.“ (Gesellschaft für Völkerkunde zur Förderung des Rautenstrauch-Joest-Museums, o.J.:3)
Universalien können sehr allgemein oder sehr spezifisch sein. Die allgemeinen erscheinen leicht als offensichtlich und werden damit schnell als trivial oder banal abgetan. Spezifische Universalien dagegen sind überraschend; sie werden jedoch gern als „bloß spekulativ“ oder zweifelhaft eingeordnet. Dieses Spektrum zeigt sich schon bei den bekanntesten unter den vorgeschlagenen Universalien, dem schon angeführten Inzesttabu und dem Ödipuskomplex. Letzterer wurde von Sigmund Freud postuliert, wobei die Konstellation des männlichen Kindes zwischen Vater und Mutter als universal behauptet wurde. Die Universalität wurde in der Ethnologie von Bronislaw Kaspar Malinowski (1884-1942) bestritten, weil z.B. bei den matrilinearen Tobriandern der leibliche Vater für den Jungen weder Autoritätsperson noch sexueller Rivale im Kampf um die Mutter sei (Malinowski 1924:256ff., 1962, dagegen z.B. Spiro 1982). Der Ödipus-Komplex scheint nach heutigen Erkenntnissen zumindest fast universal zu sein (Bischof 1985, Riepl 1995, Johnson & Price-Williams 1996). Unter beiden Termini wurden sehr unterschiedlich spezifische Phänomene verstanden. Auseinandergehende Definitionen können aber für die Diagnose eines Phänomens als universal oder nicht universal entscheidend sein. Deshalb sind unklare oder implizit bleibende Definitionen ein notorisches Problem der Universalienforschung.
Universalien werden umso interessanter, je weiter sie sich von elementaren physiologischen Tatsachen, wie Stoffwechsel oder einfachen Sinnesleistungen, entfernen. Aber selbst bei dieser „gemeinsamen Biologie“ liegen die Dinge nicht so einfach (Schiefenhövel 1999:1). Fast jeder wird der Aussage zustimmen, dass Menschen überleben wollen und sexuelle Wünsche haben. Dennoch ist es in vielen Kulturen „normal“, dass einzelne Personen oder Teilgruppen ihr ganzes Leben sexuell enthaltsam sind. Weiterhin gab und gibt es immer wieder Menschen, die sich bewusst und freiwillig zu Tode hungern. Als offensichtlich erscheinen diejenigen Universalien, die aus dem Erfordernis längerfristigen Überlebens einer Spezies resultieren, welche auf ein Leben in hoch organisierten Sozialverbänden angewiesen ist, wie das beim Homo sapiens der Fall ist. Beispiele sind Werkzeuge, Körperschutz, Kommunikationsverfahren, Kooperation bei Nahrungsgewinnung und Erziehungsmethoden. Weniger offensichtlich sind Universalien, die nicht im unmittelbaren Sinne für Individuen überlebenswichtig sind. Dazu gehören Arbeitsteilung, das Verbot sexueller Beziehungen zwischen bestimmten Kategorien von Verwandten, organisierte Formen der Teilung von Nahrung und des Gütertauschs, der Glaube an übernatürliche Kräfte, Übergangsriten (rites de passage) oder etwa die Existenz von Sport (Peoples & Bailey 2003:37f., Herzog-Schröder 2001).
Wenn Menschen einander im Alltag als Individuen vergleichen, so fällt den meisten zunächst die außerordentliche Variabilität unter den Menschen auf, vor allem in den Gesichtern, weniger dagegen die Ähnlichkeiten. Auch wenn ganze Kulturen verglichen werden, stehen in der Wahrnehmung – und derzeit weltweit auch im öffentlichen Diskurs – Unterschiede im Vordergrund: Kultur als Differenz. Die Gemeinsamkeiten zwischen Kulturen werden oft erst dann betont, wenn zunächst ihre Differenz in den Mittelpunkt gestellt oder Gemeinsamkeiten vorerst sogar völlig geleugnet wurden. Die Sicht relativer Unterschiede hängt stark von der Vergleichsebene ab. Wenn Menschen sich und ihre Gesellschaften nicht mit anderen Menschen und Kulturen vergleichen, sondern mit Tieren bzw. Tierpopulationen, verschwinden die wahrgenommenen Unterschiede zwischen Menschengruppen hingegen fast ganz aus dem Blickfeld. Es werden dann in erster Linie Gemeinsamkeiten der biotischen Conditio Humana gesehen und demzufolge der Kontrast betont, der selbst zu den nächsten biologischen Verwandten, den höheren Primaten, besteht (Lewontin 1986:1f.). Die Conditio humana kann leicht auch zu einer naturalistischem Mystik werden. Der im Vorwort angesprochene Wunsch nach positiv besetzten Universalien scheint auf den ersten Blick harmlos zu sein. Er beinhaltet aber einige Probleme, wie ein Beispiel aus dem Bereich visueller Populärkultur zeigt.