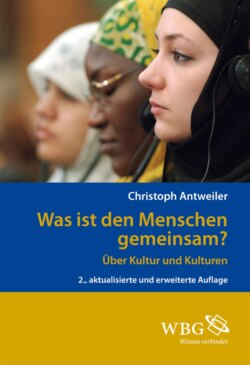Читать книгу Was ist den Menschen gemeinsam? - Christoph Antweiler - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2 Universalien sind ein wichtiges Thema: allgemeine und kulturwissenschaftliche Relevanz
ОглавлениеVon allgemeiner Bedeutung sind Universalien im Hinblick auf Menschenbilder, sei es im Alltagsdenken als geronnene Alltags- und Lebenserfahrung, in der Politik oder den Wissenschaften (Kuper 1994, Wolters 1999:96, Fahrenberg 2004). Für die Ethnologie als einem anthropologischen Fach sind sie im engeren Sinn wichtig vor allem in Bezug auf die Kulturtheorie. Darüber hinaus sind Universalien für sämtliche andere Human-, Kultur- und Geisteswissenschaften von Bedeutung, wie sie für die Grundlegung einer wissenschaftlichen Anthropologie bedeutsam sind. Universalien können ein mächtiges Instrument sein, um die komplizierten Interaktionen zwischen Bios und Kultur zu ermitteln. Sie können z.B. zur Frage beitragen, welche Faktoren menschlichen Charakter und menschliche Persönlichkeit in jeder Gesellschaft bestimmen (Schiefenhövel 1999:2). Universalien sind daneben auch für ein humanes Selbstverständnis relevant, das selbst einen Wirkungsfaktor für unsere Zukunftsgestaltung darstellt (Welsch 2004:64).
Klärung verbreiteter impliziter Annahmen
Im Alltag sind Annahmen über universale Eigenschaften menschlicher Kulturen weit verbreitet, ja vielleicht sogar selbst eine Universalie. Wenn man einmal darauf achtet, begegnen einem ständig solche Aussagen, z.B. über das Verhältnis von Mächtigen zu Untergebenen, Reichen zu Armen, Eltern zu Kindern und Frauen zu Männern. In Wissenschaften finden sich Universalien oft in Form von impliziten Annahmen, die hinter den Theorien stehen. So werden in der Psychoanalyse universale Aussagen auf der Basis von regional sehr begrenztem und historisch spezifisch situiertem Material gemacht. In den Wirtschaftswissenschaften werden universale Postulate über Akteure gemacht, z.B. in rational choice-Theorien, doch gleichermaßen auch in den Kritiken daran (Antweiler 2000: Kap. 2). Die große Mehrheit der Aussagen in Werken der Sozialpsychologie beruht nach wie vor auf Studien in westlichen Nationalkulturen, die sich durch hohen Individualismus und geringe Machtdistanz auszeichnen (Smith & Bond 1993:46). In Soziologiebüchern werden innerhalb der Sozialtheorie vermeintlich interkulturelle gültige Konzeptionen zur Struktur und Funktion menschlicher Gesellschaften gemacht, die von universalen Annahmen zu Menschen und Menschengruppen geleitet sind. In aller Regel bleiben die dahinter stehenden Annahmen unausgesprochen. Nur in seltenen Fällen wird ausdrücklich betont, dass Erkenntnisse über Universalien seitens der Ethnologie für das eigene Fach hilfreich seien (z.B. Berry et al. 2002:4).
Universalienforschung könnte auch mit denjenigen anthropologischen Grundannahmen in vielen Disziplinen aufräumen, die unrealistisch rigide oder allzu abstrakt sind (Opolka 1999:1). Dies gilt etwa für die Vorstellung einer fast grenzenlosen Form- und Erziehbarkeit des Menschen in der dominanten tabula-rasa-Pädagogik wie auch für die Annahme des stets gewinnmaximierenden bzw. sich zweckrational verhaltenden homo oeconomicus bei vielen Ökonomen. Wie wirklichkeitsfremd sie in ihrer Extremform sind, zeigen neuere Forschungen in den entsprechenden Fächern (z.B. Voland 2001, Henrich 2002:260-275, Gächter & Thöni 2004, Fehr & Renninger 2004).
Universale Aussagen zum Menschen haben eine eminent praktische Bedeutung. Dies wird z.B. in der Psychotherapie, der interkulturellen Beratung bzw. der interkulturellen Mediation und weitergehend bei allen politischen Bemühungen um interkulturelle Verständigung deutlich. Nur vergleichsweise wenige der praxisorientierten oder politisch motivierten Autoren machen sich jedoch ihr Menschenbild klar und legen es ihren Lesern offen. Ein seltenes Beispiel expliziter Aussagen dazu bietet das Buch von Andreas Bruck zu „Lebensfragen“, quasi ein Lebensratgeber auf anthropologischer Basis. Der Autor spricht schon im Untertitel von „anthropologischen Antworten“ (Bruck 1997) und benennt dann im Text ausführlich seine (kulturanthropologisch-funktionalistischen) Annahmen über den Menschen. In manchen neueren Anleitungen zur interkulturellen Mediation wird die Suche nach kulturellen Gemeinsamkeiten zwischen Konfliktparteien oder gemeinsamen Zielen als ausdrückliche Strategie verfolgt (Busch 2007:170f.). Franz König, katholischer Altkardinal in Wien, antwortet auf die Frage, wie ihm der Dialog mit anderen Religionen möglich sei: „Das ist ganz einfach: Ich beginne mit den Gemeinsamkeiten“ (nach Salat 2003:133). Interkulturelle Kommunikation und Konfliktbearbeitung sollen dadurch ermöglicht werden, dass universale Norm-, Wert- und Gerechtigkeitsvorstellungen aufgedeckt, bewusst gemacht und anerkannt werden. Nach dem Finden und der Akzeptanz können die Beteiligten versuchen, situationsangemessen weitere Universalismen zu bilden (Schramkowski 2001:92,113-115).
Eine Anthropologie des „ganzen Menschen” (Rössner 1986, ähnlich Wernhart 1987, 2004:21-25, Markl 2002:15, 2004:1066ff.) – ob rein wissenschaftlich oder praxisorientiert – bedarf eines empirischen Fundaments. Universalien, die in methodisch bewusstem Kulturvergleich gewonnen werden, können vor Utopismen soziologischer Theorie bewahren. Falls sie anthropologische Konstanten aufzeigen, weisen sie empirisch auf Grenzen der Selbstveränderungsfähigkeit (Messelken 2002b:287). Wer Menschenbilder empirisch fundieren will und so zu einem jenseits des Selbstverständnisses liegenden „Begriff des Menschen“ kommen will, braucht empirische Kenntnisse über Kulturuniversalien. Ansonsten bleiben die Aussagen solcher Menschenbilder nur auf dem Niveau von bloßen Setzungen über die menschliche Natur: „Gegen Menschenbilder hilft kein säkularisiertes Bilderverbot. Was nicht explizit gemacht wird, wird als implizite Vorannahme mitgeschleppt.“ (Bröckling 2004:172)
Wegen ihrer vermeintlichen Selbstverständlichkeit bleiben Menschenbilder aber meist implizit. Weil sie unbewusst bzw. unausdrücklich verwendet werden, bleiben sie unhinterfragt und vor allem empirisch ungeprüft (vgl. Sieferle 1989). Seit den frühen Evolutionisten wird eine „psychophysische Einheit des Menschen” (Mühlmann 1984: Kap.9, Stagl 1985:104, Shore 1996:15-41) postuliert. Dieses humanistische Prinzip entwickelte sich in der im Abendland bekannten Form aus stoisch-christlichen Wurzeln, hat aber Entsprechungen in anderen Kulturtraditionen. Diese Einheit begründet die grundlegende Möglichkeit interkulturellen Verstehens und auch existentieller transkultureller Erfahrungen, wie in der ethnologischen Feldforschung (Stagl 1985:104). Wenn eine solche Idee nicht nur Postulat bleiben soll, muss sie inhaltlich mit mehr als Spekulationen über Universales gefüllt werden.
Universalien sind weiterhin offensichtlich speziell für die Diskussion des Anlage-Umweltverhältnisses relevant. Seit Francis Galton (1822-1911) wurde nature vs. nurture in antithetischer Weise diskutiert. Langsam ist das einer Auffassung von Anlage und Umwelt bzw. der Idee einer acquisition von Fähigkeiten gewichen (Pinker 1998:47, 2003). Erst in letzter Zeit werden die entsprechenden Konkurrenz-, Proportions- oder Additionstheorien zugunsten der Vorstellung von einer dynamischen Verschränkung beider abgelöst, z.B. im Rahmen einer interdisziplinären Wissenschaft menschlicher Entwicklung (Voland 2000, Keller et al. 2002, Rogoff 2003, Petermann et al. 2004:64, 240, 255-261, Chasiotis 2007:180f.,203-207). Hierzu können Erkenntnisse zu Universalien beitragen, besonders dann, wenn sie erklärungsoffen definiert werden, statt sie einfach mit genetischer Ausstattung oder anthropologischen Konstanten gleichzusetzen.
Bedeutung für Kulturvergleich und Ethnozentrismuskritik
Kulturuniversalien sind besonders für Kulturvergleiche wichtig, wenn sie explizit nicht euro- oder aber ethnozentrisch gefärbt sein wollen (Kluckhohn 1961:101, Jensen 1999:60). Es darf nicht vergessen werden, dass die Ethnologie in einer Zeit entstand, als fremde Kulturen als Defizitmodelle gedacht wurden. Frühe Ethnologen stellten Theorien über kulturelle Unterschiede auf, indem sie Listen mit Merkmalen, die in anderen Kulturen fehlten, zusammentrugen (vgl. Greenwood & Stini 1977:313, Kuper 2005). Solche Annahmen existieren, wenn auch in verändertem Vokabular, bis heute, selbst in wissenschaftlicher Literatur. Einige der häufigen Behauptungen, die besonders in der imaginären Ethnographie des 19. Jahrhundert stark verbreitet waren, aber bis heute wirken, sind in Abb. 7 zusammengestellt.
Die Autoren vergleichen dabei andere Kulturen mit der Kultur bestimmter westlicher Länder, insbesondere Englands, Frankreichs und der USA, zu während der Industrialisierungsphase des mittleren und späten 19. Jahrhunderts. Diese Listen waren eurozentrisch bzw. okzidentalistisch, indem sie andere Kulturen mit westlichen in genau diesen Merkmalen verglichen, die in letzteren offensichtlich vorhanden waren. Die inhaltliche Bestimmung der Merkmale selbst, z.B. „Regierung“ und „Familie“, blieb zumeist implizit. De facto waren die Merkmale an spezifischen europäischen Ausformungen orientiert, etwa der politischen Institutionen wie Parlamente oder der Familie als bürgerlicher Familie. Demgegenüber enthielt die Betonung der Andersartigkeit anderer Kulturen auch eine Kritik am Eurozentrismus, nämlich seinen universalistischen Annahmen. Dies wurde aber kaum so wahrgenommen.
In der Konsequenz führten solche Merkmalsvergleiche dazu, andere Kulturen durch Negation, durch Fehlen von Merkmalen, durch Defekte bzw. Behinderung zu bestimmen. Solche Merkmalsvergleiche können rein beschreibend sein; de facto waren sie aber zumeist wertend. Die Bestimmung anderer Kulturen über Marginalisierung, Negation, Exklusion und Abwertung ist ein Kernmerkmal des Ethnozentrismus, wie historische (Rüsen 1998:16f.) und ethnologische Befunde (Müller 2003b, Antweiler 2004b, 2007b) zeigen. Die oben referierten Bestimmungen können als eurozentrisch in der Art der Vergleichsoperation und dazu ethnozentrisch in der Abwertung anderer Kulturen angesehen werden.. Auch der Terminus „Naturvölker“ beinhaltet – neben positiven Konnotationen – solche degradierende Bestimmungen. In der popularisierten Ethnologie werden derlei Termini oft ganz offen verwendet oder die dahinter stehenden Konzepte firmieren unter neuen Vokabeln, wie „ethnische Konflikte“ (vgl. Antweiler 2005a).
Gesellschaften ohne Schrift
Gesellschaften ohne Religion
Gesellschaften ohne Technologie
Gesellschaften ohne Wissenschaft
Gesellschaften ohne Einschränkungen der Sexualität
Gesellschaften ohne Herrschaft, ohne Macht, ohne Hierarchie
Gesellschaften ohne soziale Ungleichheit bzw. soziale Differenzierung
Gesellschaften ohne Staat, ohne Regierung
Gesellschaften ohne Gesetz
Gesellschaften ohne monogame Heirat
Gesellschaften ohne Ausbeutung
Gesellschaften ohne Patriarchat
Gesellschaften ohne Aggression, ohne Krieg
Gesellschaften ohne Geschichte 1: Kulturen ohne Wandel, statisch
Gesellschaften ohne Geschichte 2: Kulturen ohne Geschichtsbewusstsein
Gesellschaften ohne Geschichte 3: Kulturen ohne Geschichtsschreibung
Abb. 7: Defizitmodelle im 19. Jahrhundert: Charakterisierung nichtwestlicher Gesellschaften über vermeintlich fehlende Merkmale
Implizit lagen solchen Aufzählungen von Defiziten nichtwestlicher Kulturen jedoch auch Vorstellungen darüber, worin alle Kulturen übereinstimmen, zugrunde. Dies wird besonders dann deutlich, wenn die vermeintlich nur in westlichen Gesellschaften vorhandenen Merkmale aufgelistet werden, nämlich zumeist in binären Spezifizierungen. Die Aufzählung von z.B. industrieller Technologie, monotheistischer Religion, experimenteller Wissenschaft, monogamer Ehe, Regierung nach Gesetzen beinhaltet ja die Aussage, dass Technologie, Religion, Wissenschaft, Ehe und Regierung als solche ubiquitär seien. Ein zentraler Beitrag der Ethnologie liegt in der Breite ihres Vergleichsspektrums, die typologisch optimal bzw. optimal idealtypologisch ist:
„Zur Bestimmung des Basiskonzepts (Kultur als Sinn, Erg. CA) hätte die Ethnologie am meisten beizutragen, da sie die breiteste Vergleichsattitüde analytisch elementarer Gesellschafts- und Kulturtypen besitzt. Insofern könnte sie als Grundlagenwissenschaft der Humanwissenschaften gelten, aufruhend ihrerseits, wenn auch begrenzt, auf den universalen Verhaltensdispositionen ...“ (Müller 2003a:9; vgl. Müller 2003b:31)
Vergleiche setzen nicht a priori zwei oder mehrere verglichene Einheiten gleich, sondern erlauben die Feststellung von Gleichheit, Ähnlichkeit und Ungleichheit. Universalienforschung kann nicht nur kulturübergreifende Gemeinsamkeiten aufdecken. Sie kann auch vermeintlich universale Eigenschaften als tatsächlich nicht universal aufdecken (sog. negative Universalien)! Wenn diese weithin als universal angenommen werden, ist eine solche Korrektur ein wichtiger Erkenntnisbeitrag, der unter Umständen sogar politische Implikationen haben kann. So konnte eine Untersuchung zeigen, dass Homosexualität – entgegen verbreiteter anders lautender Meinung – im Kulturvergleich nicht allgemein als „unnatürlich“ gilt (Werner 1979, nach Ehrlich 2002:199). In einer der wenigen detaillierten Studien zum Thema Universalien schloss Hockett aus einer empirisch gewonnen Liste von Kandidaten für Universalien:
„... our one valid generalizing recommendation: people (in any culture) should struggle to avoid mistaking their own ways of life for basic laws of nature. Since the most readers of this book, like the writer, were nurtured in Western society, it is important in this connection to emphasize those characteristics of our own culture which are not universal despite our sometimes strong conviction that they are – or should be.“ (Hockett 1973:277, Hervh. i.O.)
Im Rahmen der modernen Politik, die mit kultureller Differenz und Kulturalisierung bzw. Ethnisierung arbeitet und Geschichte vielfach erfindet, ist das Problem des Ethnozentrismus ein Problem der interkulturellen Kommunikation. Es steht für eine unüberbrückbar erscheinende Kluft zwischen kulturellen Unterschieden und Partikularität einerseits und universalistischem Diskurs andererseits (Rüsen 1998:21). In diesem Rahmen kann die Klärung universeller Gemeinsamkeiten auch ein Beitrag zu Entwicklungszusammenarbeit und Humanismus in der Epoche der Globalisierung darstellen (Bielefeldt 1994, Kulturwissenschaftliches Institut Essen 2006:83). So hat Robbie Robertson angesichts der jetzigen dritten und intensivsten Welle globaler Vernetzung angeregt, ein „inclusive reading of history“ für eine gesamtmenschliche Anstrengung fruchtbar zu machen (Robertson 2003).
Ethnisierung des Kultur-Diskurses seit dem frühen 20. Jahrhundert und Relevanz für interkulturellen Umgang
Eine ethnologische Perspektive auf das Phänomen Universalität ist nicht nur wichtig, um empirisch fundierte Vergleiche auf breiter Basis zu gewinnen. Vielmehr hat sie auch einen engen Bezug dazu, wie heutzutage weltweit über Kultur und Kulturen gedacht und geredet wird. Seit den frühen Dekaden des 20. Jahrhunderts hat sich eine allgemeine „Ethnologisierung“ des Denkens in der modernen westlichen und ab dann zunehmend global verbreiteten Kultur ergeben. Etwa ab den 1920er Jahren verdrängte die Rede von dem „Anderen“ und von kultureller Vielfalt den bis dahin dominierenden Diskurs über „Zivilisation“, „Evolution“, „zeitlicher Vorrangigkeit“ und „Emanzipation“. Mit dem Umschwung von Evolutionskonzepten des 19. Jhs. zu Alteritätsvorstellungen des 20. Jhs. ging ein veränderter Umgang mit dem Spannungsfeld Individualität – Universalität einher.
In Zusammenhang damit hat sich auch eine Verschiebung der Zuordnung von Einheit und Vielfalt zu Biologie und Kultur vollzogen. Im 19. Jahrhundert und den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts bestand die Idee, dass Menschen prinzipiell ihre kulturellen Grenzen überwinden können, um eine universale Gesellschaft zu bilden. Seit dem zweiten Weltkrieg dominiert aber die Ansicht, Universales könne nur in der Biologie liegen. Die Einheit der Menschheit manifestiere sich nur in ihrer Biologie, während Kultur die Vielfalt bzw. Differenz ausdrücke. Diese Dichotomie vereint Universalisten mit Kulturalisten, die sich nur in der Gewichtung des Bios unterscheiden. Relativisten halten die Natur des Menschen für homogen, um universale Empathie zu ermöglichen, aber völlig veränderlich. Damit erscheint die biologische Einheit als inhaltsarm, während Universalisten das anders sehen. Was bei dieser von beiden Positionen geteilten Sicht aber verloren geht, ist die Möglichkeit, durch Bewusstsein und Handlungsmacht (agency) eine kulturell gebildete Einheit zu bilden (Malik 2008a:254f., vgl. Stagl 2000:28).
Eine zunehmende Fokussierung auf kulturelle Differenz und Vielfalt betraf als breite kulturelle Strömung nicht nur die Wissenschaften, sondern auch weite Bereiche des öffentlichen Lebens. Erstaunlicherweise wurden dieselben Vorstellungen über Kultur, Differenz, Alterität und Identität dabei sowohl von Kolonialherrschern und Orientalisten als auch von indigenen Künstlern und antikolonialistischen bzw. nationalistischen Intellektuellen geteilt. Das zeigt Joel Kahn detailliert anhand von Debatten im frühen 20. Jahrhundert zum Expressionismus in Industrieländern, zu Peasants (in größere Systeme integrierte Bauern) in armen Ländern und zum Multikulturalismus in USamerikanischen Städten (Kahn 1995:48ff.;109-122). Statt die Relation zwischen Universalität und Individualität im Rahmen des Verhältnisses von Individuen zu sehen, wird es weitgehend als Verhältnis von „Welten“, „Lebenswelten“ oder „Kulturen“ als umfassenden Weltauffassungen behandelt. Dies wird von Fuchs schön auf den Punkt gebracht: „Das zwanzigste Jahrhundert hat das Problem der Universalität in das des Verhältnisses von Kulturen gegossen“ (Fuchs 1997:142). Erst in den letzten Jahren wird über einen Multikulturalismus nachgedacht, der die Vielfalt der Individuen in den Mittelpunkt stellt und so ohne Kulturalisierung auskommt. Ein solcher „Multikulturalismus ohne Kultur“ könnte sich auch den Gemeinsamkeiten von Kulturen öffnen (Phillips 2007:11-41, bes. 33f., 67ff.). Das ist aber noch keine Position des Mainstreams.
Die Problematik der Kulturalisierung bzw. Ethnisierung betrifft auch normativ ausgerichtete Vorhaben in Bezug auf Kulturen, z.B. die interkulturelle Erziehung, vor allem, da Bildungsideen ja traditionell mit Universalismus verbunden sind. Sie folgen der Idee, die eigene kulturelle Befangenheit zu überwinden (Auernheimer 2003:68). Wenn man im pädagogischen Kontext zu einer Leitlinie einer humanistisch ausgerichteten Kulturwissenschaft kommen will, sind relativistische und universalistische Richtungen als zwei komplementäre Seiten aufzufassen (Schöfthaler 1983: 342ff., Schmidt 1987, Nieke 2000).
„Fragt man nach den Bedingungen der Möglichkeit interkultureller Sinnkonstitution, so wird man am Komplex Kulturrelativität versus Universalien kaum vorbeigehen können, kann doch die Divergenz sozial akzeptierter Deutungsmuster nur durch das vorgängig eingegrenzt werden, was ihnen gemeinsam vorgegeben ist.“ (Masson 1981:133; Herv. i.O.)
Universalismus und Kulturrelativismus benötigen jeweils die Ergänzung der anderen Seite. Dem Relativismus fehlen Außenkriterien, weshalb zur Beliebigkeit neigt. In politischer und pragmatischer Hinsicht führt das leicht zu Widersprüchen, Kritikunfähigkeit und Irrelevanz (Kolakowski 1980:275ff.). Dem Universalistmus wiederum fehlen Innenkriterien, weshalb Universaliszen dazu tendieren, kulturelle Spezifika vorschnell zu werten, z.B. als atavistisch oder dysfunktional abzuwerten. Nur beide Richtungen zusammen können nachhaltige Optionen interkulturellen Umgangs schaffen:
„Als zwei Seiten humanistisch orientierter Kulturwissenschaft können sie Konzepte einer Entfaltung menschlicher Möglichkeiten formulieren, in denen sowohl der Widerstand gegen Veränderer als auch die Veränderung gegen Bewahrer ihren Platz haben.“ (Schöfthaler 1983:345)
Im postkolonialen Zeitalter, das durch weltumspannende Kontakte und globale Vernetzungen, gleichzeitig aber von einer Betonung kultureller Differenz und Grenzen gekennzeichnet ist, liegt die wichtigste praktische Bedeutung des Themas Universalien in ihrer Rolle beim Umgang zwischen Menschen, die aus verschiedenen Kulturen stammen. Wenn es nämlich Reaktionsmuster, Verhaltensneigungen oder emotionale Grundbefindlichkeiten gibt, die bei allen Menschen gleich sind, besteht eine gute Chance der Verständigung. „Der Mensch ist in vielen Kulturen zu Hause“ (Nordenstam 2001:11f.). Kulturelle Übersetzungen sind dann zumindest prinzipiell möglich. Dann könnte Kultur nicht nur als Kontrast und Grenze wahrgenommen werden. Kultur würde nicht nur für Differenz stehen, sondern für Unterschiede in der Lebensweise und der Perspektive. Eine gegenseitige Anerkennung dieser Unterschiede wird im Kontext übergreifender Lebenslagen und Haltungen sowie geteilter Probleme erreichber: „Die wechselseitige Bereicherung ist nur unter einer bestimmten Bedingung möglich, die durch die universalistische Kategorie der Gleichheit zum Ausdruck gebracht wird.“ (Rüsen 1998:29)
Nachdem die Relevanz der Thematik abgesteckt ist, werden die zwei Kapitel des folgenden Teils den historischen Kontext der Suche nach Universalien darstellen. Kapitel 3 widmet sich der Geistes- und Forschungsgeschichte und zeigt die Vielfalt der Denker und Disziplinen, die sich, meist am Rande, mit dem Thema befassten. Darauf baut Kapitel 4 auf, in dem das innige wie problematische Verhältnis der Völkerkunde bzw. Ethnologie zu Universalien beleuchtet wird. Beide Kapitel des Teils II folgen weitgehend einer chronologischen Ordnung, während der folgende Teil III das Thema dann systematisch abhandelt.