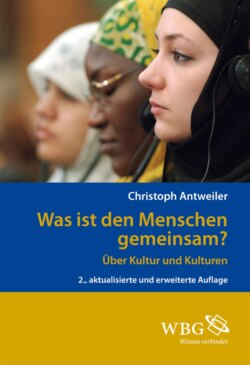Читать книгу Was ist den Menschen gemeinsam? - Christoph Antweiler - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.1 Universalien als Gegenstand: Begriff, Termini und Metaphern
ОглавлениеDefinition und Begriffsgehalt
Ich bespreche zunächst Definitionen und den begrifflichen Gehalt und komme erst danach zu den vielen in der Literatur verwendeten Termini. Universalien sind, in einfachster Formulierung gesagt, Charakteristika, die der ganzen Menschheit gemein sind. Genauer gesagt sind Universalien Merkmale oder Phänomene, die in allen Gesellschaften dieses Planeten vertreten sind. Die klassischen und deutlichsten Beispiele betreffen Verwandtschaft, Familie und Heirat (Greenwood & Stini 1977:314). Schon oben wurde als ein Beispiel Inzest genannt, auf das ich öfters zu sprechen komme. Inzestmeidung bzw. Inzestscheu ist vereinfacht gesagt das Vermeiden von Geschlechtsverkehr bzw. der Heirat oder der Fortpflanzung zwischen als verwandt angesehenen Personen. Hier zeigt die neuere Forschung, dass die Meidungstendenz als solche universal ist, während die spezifischen Regeln stark variieren (Munroe & Munroe 2001:227). Die Meidung geht oft über die Kernfamilie hinaus: „In all societies, people extend the incest taboo to some persons outside the primary or nuclear family“ (Ember & Ember 1997:127). Inzestmeidung ist aber sehr variabel darin, mit welchen Personen Sex als inzestuös gilt und auch darin, wie auf Inzest reagiert wird (Fox 1984, Héritier 1994a, 1994b, Turner & Maryanski 2005:27-52). Echt universal ist nur das Verbot der Fortpflanzung zwischen Mutter und Sohn, während das Inzestverbot in anderen Konstellationen (Bruder-Schwester, Vater-Tochter) nur fast universal ist.
Mit dem Vorkommen eines Phänomens in allen Kulturen ist ausdrücklich nicht gesagt, dass es bei allen Individuen sämtlicher Gesellschaften präsent sein muss (Opolka 1999:2). Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der besonders deshalb bedeutsam ist, weil Universalien oft auf Individuen bezogen gedacht werden.5 So finden wir z.B. Tanz in allen Kulturen. Zumeist ist er aber bestimmten sozialen Kategorien oder Gruppen vorbehalten, etwa Männern oder der Priesterschaft. Dahinter steckt oft ein typischer Fehlschluss (fallacy of division), den ich (nach Lett 1987:65) an einem Beispiel illustriere:
Religion ist ein kulturelles Universal.
Jedes Individuum der Welt gehört einer Kultur an.
Also hat jedes Individuum der Welt religiöse Überzeugungen.
Das ist offensichtlich falsch gefolgert, denn Gesellschaften haben (emergente) Merkmale, die nicht von ihren (bzw. allen) Bestandteilen geteilt werden. Es ist beispielsweise auch ein Unterschied zu sagen, dass der Mensch Kultur als Mitglied von Gesellschaft erwirbt („aquired by man as a member of society“, so in Tylors berühmter Definition von 1871) oder zu sagen, dass Menschen Kultur als Mitglied einer Gesellschaft, nämlich je einer bestimmten, annehmen („member of a society“, Klass 2003:24; Herv. i.O.). Ebenso besteht ein gewichtiger Unterschied zwischen dem Satz „Alle Menschen können sprechen bzw. haben eine Sprache“ und der Aussage „In sämtlichen Kulturen werden Sprachen gesprochen“. Kein Mensch spricht einfach nur Sprache, sondern Menschen sprechen bestimmte Sprachen. Die erste Aussage sagt etwas zur Kulturfähigkeit von Menschen als Individuen („Kultur im Singular“), die zweite ist eine Aussage über Universalien auf der Ebene verglichener sozietärer Kulturen („Kultur im Plural“).
Universalien im hier definierten Sinn sind also nicht mit Artmerkmalen gleichzusetzen! Speziescharakteristika gelten für alle Individuen einer Art, zumindest in einer bestimmten Lebensphase. Universalien sind also nicht mit der Natur des Menschen gleichzusetzen, selbst wenn sie Fragen danach implizieren (Schiefenhövel 1999:1; Bargatzky 2000:266). Ein einfaches Beispiel ist Homosexualität, die es mehr oder weniger manifest in allen bekannten Gesellschaften gibt, aber nicht bei allen Individuen.
Diese Unterscheidung von Universalität auf dem Niveau von Gesellschaften vs. der Ubiquität bei Individuen ist wichtig, denn etliche Autoren verwenden den Terminus im Sinne von „…allen Menschen aller Kulturen gleichermaßen inhärenten Gemeinsamkeiten …“ (Salat 2003:133) oder gar als „… anatomically based system of cultural and inividual thoughts …“ (Pope 2000:40). Wenn Universalien auf Individuen bezogen werden, müssen sie nicht in allen Lebensabschnitten zu finden sein (Konner 2003:440). In allen Kulturen etwa lernen Kinder Sprachen im Gegensatz zu Erwachsenen mühelos, weil das ein Charkteristikum des Menschen ist. Einige Autoren schränken Kulturuniversalien thematisch ein, entweder auf soziale Institutionen (König 1975:52) oder auf Verhaltensweisen (Barash 1981:42, Lutzebäck 2002:1). Letzteres gilt etwa, wenn Kulturuniversalien als „... fundamental behavioral characteristics ... of societies ...“ (Scupin & DeCorse 1998:213; ähnlich Sidky 2004:422) bestimmt werden. Dies gilt auch für einen Teil der folgenden Arbeitsdefinition, die innerhalb einer Forschergruppe „Transkulturelle Universalien“ am Hanse-Wissenschaftskolleg (HWK) zugrunde gelegt wurde:
„Eine menschliche Verhaltensweise (z.B. Schamverhalten) oder eine Institution (z.B. Familie) soll dann als universell oder transkulturell gelten, wenn sie in allen (oder den allermeisten) bisher bekannt gewordenen Gesellschaften regelmässig auftritt.“ (Opolka 1999:2; fast wortgleich Schiefenhövel 1999:1; Hervh. CA)
Universalien können aber eben auch außerhalb des sichtbaren Verhaltens vorkommen. Die Suche danach wird durch den holistischen Kulturbegriff der Ethnologie nahegelegt. Kulturuniversalien können in Lebensbedingungen, im Verhalten, Denken und Fühlen sowie in Institutionen und Gegenständen bestehen. Entsprechend können das sowohl (a) komplexe soziale Institutionen sein, wie die Heirat und Arbeitsteilung, oder (b) Handlungsweisen, wie Feuer- oder Drogengebrauch und reziproker Tausch, (c) Kognitionen oder (d) materielle Kulturgegenstände, wie Werkzeuge und Behausungen.
Mit der Wendung „... in allen … bisher bekannten gewordenen Gesellschaften ...“ sind sämtliche Gesellschaften („Ethnien“, „Kulturen“) gemeint, die bislang (z.B. von der Ethnologie, Volkskunde oder Geschichtswissenschaft) untersucht wurden. Entsprechend des ethnologischen Präsens sind Gesellschaften gemeint, die gegenwärtig existieren oder bis in die jüngere Vergangenheit existiert haben und dokumentiert sind. Unter „regelmäßig“ ist zu verstehen, dass das Phänomen in einer betrachteten Kultur nicht nur einmalig oder als seltene Ausnahme auftritt, sondern in der Regel immer wieder und transgenerational. Da die Abgrenzung von Gesellschaften und ethnischen Gruppen schwierig ist, kann man auch Subgruppen einschließen und Universalien vorsichtiger definieren als “… elements of culture that exist in all human groups or societies” (Peoples & Bailey 2003:397; Hervh. CA). Zentral ist jedoch der Bezug auf Gruppen als kollektiven Identitätseinheiten mit einer Kontinuität und einer Kohärenzfiktion:
„Da dies (Kultur als Sinnsystem, Erg. CA) den gemeinsamen Elementarbestand aller Gruppen mit stabilem Identitätsbewußtsein bildet, böte es den Boden zur Entwicklung einer Kernsystematik transkultureller Universalien, von der aus alle Besonderungen, Vereinzelungen und Ereignisbestimmungen als Folge lokaler Anpassungen, historischer Wechselwirkungen und innergesellschaftlicher Differenzierungsprozesse erschienen und deduktiv erklärt werden könnten.“ (Müller 2003a:9; Hervh. i.O.)
In einem anderen Verständnis sind Universalien Phänomene, die nicht nur in allen rezenten Kulturen vorkommen, sondern sämtlichen bekannten menschlichen Gesellschaften gemein sind. Solche Universalien kommen also in den Kulturen aller Räume und aller Zeiten vor (Abb.2). Ein solches Verständnis liegt vor, wenn Universalien als „... stringente, zeitüberdauernde Gemeinsamkeiten...“ bezeichnet werden (Lutzebäck 2002; ähnlich Hultkrantz 1960:283, During 2005:87). Schon das ethnographische Wissen über rezente menschliche Kulturen ist reichlich lückenhaft und unsere Kenntnisse über die Kulturen der Ur- und Frühgeschichte sind extrem bruchstückhaft. Also ist es schwierig, solcherart definierte Unversalien eindeutig zu bestimmen. Das hindert uns jedoch nicht daran, nach diachronen Universalien zu fragen, denn lückenhafte Empirie kann durch andere Methoden ergänzt werden, etwa durch Deduktion oder Retrodiktion. Diese Bestimmung von Universalien erinnert an Kroebers sehr weite Bestimmung der Anthropologie als gleichzeitig synchronem und diachronem Fach. Entsprechend definiert Donald Brown menschliche Universalien als transkulturell und auch transhistorisch:
„Human universals comprise those features of culture, society, language, behavior, and psyche for which there is no known exception to their existence in all ethnographically or historically recorded human societies.“ (Brown 1999a:382, Hervh. CA)
„Human universals – of which hundreds have been identified – consist of those features of culture, society, language, behavior, and mind that, so far as the record has been examined, are found among all peoples known to ethnography and history.” (Brown 2004:47, Hervh. CA)
Kulturuniversalien bestehen immer in einzelnen Eigenschaften von Kollektiven oder Gesellschaften, nicht in der Summe ihrer Merkmale. Die Behauptung einer Gleichheit von Gesellschaften in Bezug auf ein Merkmal a schließt in keiner Weise aus, dass in weiteren Charakteristika b, c, ..., ja evtl. sogar in sämtlichen anderen Merkmalen Unterschiede bestehen. Die Feststellung einer Universalie betrifft also in keiner Weise die Einzigartigkeit einzelner Gegenstände, Personen oder Gesellschaften. Sie bedeutet nur, dass ein betrachtetes Objekt nicht in jeder Hinsicht einzigartig ist. Anders gesagt: Jeder Mensch ist in manchen Aspekten wie jeder Mensch, wie einige Menschen, wie kein einziger anderer Mensch (Kluckhohn & Murray 1953:15). Auch moderne Arbeiten zur menschlichen physischen Vielfalt zeigen, platt gesagt: Alle sind gleich und jeder ist anders (Lewontin 1986, vgl. Grossmann & Grossmann 2007:249-254).
Die Definition von Universalien als quer durch alle menschlichen Gesellschaften vorkommende Charakteristika beinhaltet ausdrücklich nicht gleichzeitig die Aussage, dass diese Charakteristika nicht auch bei Populationen anderer Primaten vorkommen. Das muss betont werden, denn manche Autoren verstehen unter „Universalien“ Merkmale, die sämtliche Menschen als Individuen haben, aber kein Tier (Staal 1988:1, nach Saler 2000:155, ähnlich Pope 2000:291; anders dagegen Kohl 2008:549). Derartige Charakteristika werden in diesem Buch als „speziesspezifische Merkmale“ von Universalien abgesetzt und im Kapitel zur Natur des Menschen besprochen. Eines der Merkmale, das auch diese zusätzliche Bedingung erfüllt, ist die „heimliche Kopulation“. Nicht nur die Ovulation ist beim Menschen versteckt; auch der Geschlechtsverkehr findet in allen Kulturen nicht üblicherweise coram publico, sondern im Privaten statt (und ist mit Heimlichkeit und Scham assoziiert; Duerr 1988). Gleichzeitig ist dies bei allen restlichen Primaten anders (Schröder 2000:59; Ehrlich 2002:187f.).6
Abb. 2: Synchroner und diachroner Universalienbegriff
Ethologische Universalien vs. erklärungsoffene Definition
„Kulturuniversalien“ können von genetischen bzw. biologischen Universalien unterschieden werden (Eriksen 2001b:41; vgl. Abb. 3). Dies ist aber hier nur als terminologische und analytische Trennung zu verstehen. Wir wissen ja oft gar nicht, wie Anlagen, Umwelten und Kultur bei der Genese von Universalien genau zusammenwirken, weshalb in diesem Buch von „Universalien“ gesprochen wird und sie unten bewusst erklärungsoffen definiert werden. Das folgende Zitat eines Kritikers einseitig biologischer Konzepte menschlicher Natur zeigt, besonders anhand der von mir hervorgehobenen Aspekte, die Problematik dieser Unterscheidung:
“With regard to … causal factors biologically common to all nondefective humans, the interaction of these with unnumerable contextual factors makes it unlikely that such factors will in any interesting ways determine the details of human behaviour. And there is no reason to think that there are universal biological features of humans directed at the production of specific modes of behaviour. Rather, such universal features must be seen as more or less constant inputs into the complexely interactive processes by which human minds develop.” (Dupré 2003: 100; Hervh. CA)
Die biokulturelle Verschränkung lässt sich am Beispiel von mentalen Strukturen verdeutlichen. Neben der gängigen Erklärung durch Gene, z.B. die proximaten Erklärungsanteile in der Evolutionspsychologie, und der ebenso gängigen Alternativerklärung durch Umwelt bzw. Sozialisation, z.B. angenommene enorm leistungsfähige, aber inhaltlich unspezifische Lernkapazität im blank slate-Sozialkonstruktivismus, gibt es andere Möglichkeiten. Es ist nämlich denkbar, dass ubiquitäre und persistente Gehirn- bzw. Denkstrukturen nicht nur biotisch bedingt sind, sondern auch auf persistentem kulturellen Input beruhen: „… a brain constructed by a variety of more or less stable and reliable ressources including resources that are reliably produced by human cultures.” (Dupré 2003:31; Hervh. CA) Wenn Menschen nämlich aus ihrer Biologie heraus kulturbedürftige Wesen sind, dann stehen alle heute existierenden Menschen nicht nur am Ende einer Linie biotisch erfolgreicher Reproduktion, als Nachfahren, die unter Selektionsdruck erfolgreich waren. Sie stehen auch am Ende einer durchgehenden Linie von (überlebensnotwendiger) Kultur, bzw. von Sozialisationen. In dieser Linie überlebensnotwendiger Kulturinputs können einige Aspekte seit der Steinzeit bis heute gleich geblieben sein, andere dagegen heute radikal anders (Dupré 2003:31).
Entgegen verbreiteter Ansicht ist Universales nicht notwendigerweise biotisch bedingt und Variables kulturell bedingt. Aus der Ubiquität eines Merkmals bei Personen und Kulturen kann keinesfalls schon auf eine biotische Basis geschlossen werden (Dennett 1995:486f.), wie unten detailliert erläutert wird. Deshalb soll klargestellt werden, dass folgende Definition, wie sie von Humanethologen oder Soziobiologen verwendet wird, hier ausdrücklich nicht zur Anwendung kommt: „Universalien ... unter verschiedensten kulturellen Bedingungen in der gleichen Form und/oder Abfolge auftretende Verhaltensmuster, die man als genetisch fixierte, artspezifische Verhaltensweisen interpretiert (Lethmate 1992:72; Hervh. CA; fast wortgleich Sütterlin 1992:53; Simon 1990, vgl. aber Spindler 1984:14,18). Eine Verbindung der Reduktion des Begriffsumfangs auf Verhalten einerseits mit einer Verknüpfung mit Kausalannahmen (hier genetischen) andererseits kennzeichnet auch die Begriffsbestimmung im verhaltensbiologischen Wörterbuch von Heymer:
„Bei allen Menschen, ganz gleich welcher Rasse und Kultur, im gleichen Kontext vorkommende Verhaltensweisen, welche die gleichen Reaktionen auslösen, die gleiche Bedeutung haben, und gleich verstanden werden, bezeichnet man in der Ethologie als Universalien. Das Weinen, Lachen, Lächeln, Ausdruck des Mißtrauens, Ausdruck der Trauer, Schmerzgrimassen und Drohgesichter sind Beispiele hierfür und mit Sicherheit angeboren und nicht kulturbedingt.“ (Heymer 1977)
In ähnlicher Weise fasst Irenäus Eibl-Eibesfeldt (*1928) Universalien als angeborenes „Programm“ auf, welches allerdings ersetzbar oder unterdrückbar sei (Eibl-Eibesfeldt 2004:198,725; vgl. 1993 und Eibl-Eibesfeldt & Sütterlin 2007). Eine solche einengende Definition zeigt sich auch in der folgenden Begriffsbestimmung, die weniger gendeterministisch ist als die von Heymer, aber dennoch spezifische Kausalannahmen mit in die Definition hinein nimmt. Der Soziobiologe Edward Wilson (*1929) vertritt die Annahme, dass Kulturuniversalien durch die wirkmächtigen unter den epigenetischen Regeln zu erklären sind (während bei größerer Reaktionsnorm kulturelle Vielfalt entsteht). Er charakterisiert Kulturuniversalien entsprechend so: „Solche von der Kultur initiierten und von den epigenetischen Regeln beeinflußten Konventionen werden dann kulturelle Universalien genannt.“ (Wilson 1998:224)
In der vorliegenden Untersuchung wird der Universalienbegriff definitorisch hinsichtlich der Ursachen demgegenüber bewusst offen gehalten. Es findet also weder eine Eingrenzung auf Verhaltensweisen statt, noch wird irgendeine kausale Bestimmung in die Universaliendefinition hinein genommen. In der oben gegebenen einfachen Definition liegen mehrere Grundprobleme der Ethnologie, die uns in dieser Untersuchung ständig begleiten werden. Das eine Hauptproblem liegt im Begriff von Kultur (culture) und den mit jedem Kulturbegriff – sei es explizit oder, wie zumeist, implizit – einhergehenden Annahmen über die „Natur des Menschen“. Das zweite Problem besteht in der notorischen Schwierigkeit der Abgrenzung von Kultureinheiten (cultures), was allerdings kein unlösbares Problem darstellt. Aus den Überlegungen dieses Kapitels heraus verwende ich im Folgenden eine leicht abgewandelte Version der obigen im Projekt über „transkulturelle Universalien“ erarbeiteten Definition: Ein Merkmal bzw. Phänomen ist universal, wenn es in allen oder den allermeisten bisher bekannt gewordenen Gesellschaften regelmäßig auftritt bzw. in weit überzufällig vielen Gesellschaften zu finden ist. Ein solches Merkmal nenne ich „ein Universal“ bzw. „eine Universalie“.
Abb. 3: Zwei Grunddimensionen menschlicher Existenz in polarisierender Darstellung (nach Eriksen 2001b:41, leicht verändert)
Abgrenzungen: Was sind keine Universalien?
Was soll hier unter der Bezeichnung Universalien ausgeschlossen werden? Nicht einbezogen werden hier philosophisch gefasste Universalien im Sinne allgemeiner bzw. Gattungsbegriffe. Die Universaliendiskussion (vgl. Stegmüller 1974) um das Verhältnis von Allgemeinem (lat. universale) zu Einzeldingen (res) wird hier nicht diskutiert, auch wenn ich Einsichten aus ihr stellenweise zur Klärung nutze, z.B. im Methodenkapitel bei der Frage kulturunabhängiger Begriffe. Weiterhin sollen banale bzw. triviale Universalien ausgeklammert sein. Dazu gehört die Tatsache, dass alle Menschen sich ernähren müssen, zumeist auf zwei Beinen gehen, dass gesunde Menschen sprechen können oder dass jede Gesellschaft ihre Nachwuchsgeneration aufziehen muss. Die reine Existenz von Basisinstitutionen bzw. funktionalen Einrichtungen zur Bedürfnisbefriedigung von Gesellschaften, wie Nahrungszubereitung und Erziehung, sollen ausgeschlossen sein, nicht dagegen Gleichheiten in ihrer Ausgestaltung. Unter dem Terminus „Universalien“ sollen Phänomene ausgeschlossen sein, die
1 direkt funktional notwendig für kurz- oder langfristiges Überleben sind (vgl. Peoples & Bailey 2003:38) und
2 auf niedere Gehirnfunktionen beschränkt sind (Brown 1991:42) bzw.
3 offensichtlich in der Anatomie oder Physiologie der Individuen liegen.
Während die ersten beiden Punkte schon nicht immer eindeutig zu entscheiden sind, wird der letztgenannte Punkt sich an etlichen Punkten in diesem Buch als schwierig erweisen. Die Grenzen zwischen offensichtlichen Implikationen der Körperlichkeit und indirekten, nur theoretisch aus Organismuseigenschaften von Homo sapiens ableitbaren Universalien sind oft unklar (vgl. etwa die Liste der species universals in man, Crook 1985:156-186). Grundsätzlich ist die Abgrenzung zwischen Kultur und Bios ein notorisches theoretisches Problem. Problematisch bezüglich Universalien wird die Abgrenzung durch die „Doppelstruktur von gleichem Bedürfnis und unterschiedlicher Problemlösung“ (Welsch 2006:143; „Bedürfnisuniversalien“). Biologische Erfordernisse und Grundbedürfnisse können nicht von einer ganzen Gesellschaft völlig und dauerhaft ungestraft missachtet werden. Sie sind aber auf Individuen bezogen und gelten nicht immer, durchgehend und für alle Mitglieder. Biologische Fitness ist also eher eine „Begrenzungslinie“ für menschliches Verhalten als eine spezifisches Verhalten erklärende „Leitlinie“ (Markl 1986:76). Ausgeschlossen sind demnach auch Phänomene, die direkt als Antwort auf Grundbedürfnisse von Menschen als Organismen entstehen (basic needs, Malinowski 1975:39-41; precultural needs bzw. universal species realities, Dissanayake 1992:215). Für die Befriedigung dieser muss eine jede Gesellschaft fundamentale Bestandserfordernisse erfüllen. Jede Gesellschaft muss, in Malinowskis Diktion, ihre jeweilige Variante „universeller Institutionstypen“, allgemeiner gesagt, eine systemische Lösung finden, z.B. durch:
Nahrungsversorgungssystem
Verwandtschaftssystem
System sozialer Kontrolle
Kommunikationssystem
Systeme der vorgestellten übernatürlichen Kräfte zur Erklärung von Unerklärbarem (Ferraro 2001a:33).
Nicht ausgeschlossen sind selbstverständlich die jeweiligen Ausbildungen und einzelnen Merkmale dieser Systeme, „... the ways in which diverse human cultural practices are the means of satisfying universal human needs“ (Dissanayake 1992:75). Vor allem können diese Weisen der Bedürfnisbefriedigung ja selbst universale Muster zeigen. Einen Grenzfall bilden universale Bedürfnisse, die in biotischen Bedürfnissen begründet sind und sich in allen Gesellschaften primär über die Bedürfnisse der Individuen manifestieren, jedoch nicht in jedem Individuum in jeder Situation. Ein Beispiel ist Larry Arnharts konservatives und politikorientiertes Konzept der 20 „natürlichen Bedürfnisse“, z.B: Familienbindung und Besitz (Arnhart 1998:31-36, 2005:33).
Auch das „universale Muster“ (universal pattern) im Sinne von Marvin Harris deckt sich nicht mit Universalien. Harris versteht unter dem universalen Muster das Inventar von Komponenten, die aus kulturmaterialistischer Sicht in allen kulturellen Systemen wiederkehren. Er unterscheidet darin drei Ebenen: Infrastruktur (Produktionsweise, Reproduktionsform), Struktur (Haushaltsökonomie, Politische Ökonomie) und Superstruktur (Verhaltens- und Denkweisen). Harris versteht dies als heuristisches Mittel, zum einen, um Kulturen vergleichen zu können, zum anderen, um Daten zu systematisieren (1995:17-19). In seinen neueren Arbeiten unterscheidet er in jeder der drei Ebenen je eine etische bzw. verhaltensbezogene (etic behavioural) und eine emische bzw. mentale (emic mental) Dimension (Harris 1999:141-152, vgl. dazu auch Sanderson 2001). Zu dieser ordnenden Trias tritt bei Harris eine spezifische Kausalannahme. Aus seiner technodeterministischen Perspektive sind die Infrastruktur und jeweils die etischen Aspekte der Struktur und Superstruktur kausal die primären Kräfte (infrastructural determinism). Damit sind „universale Muster“ im Sinn des Kulturmaterialismus auf allgemeinerer Ebene angesiedelt als der Begriff der Universalien, wie er hier verwendet wird. Harris´ Definition der universalen Muster enthält zudem – anders als es hier vorgeschlagen wird – eine Erklärung, wie die eben angeführten Definitionen von Wilson und Eibl-Eibesfeldt, wenn auch inhaltlich eine dezidiert andere.
Termini und Begriffe: ein breites Spektrum
Universalien werden in der Literatur unter verschiedenen Bezeichnungen untersucht. Nur in manchen der Termini taucht das Wort „universal“ als Wortbestandteil auf (Abb. 4). In den deutschsprachigen Beiträgen zum Thema wird zumeist von „Universalien”, „Kulturuniversalien“ oder „kulturellen Universalien“ gesprochen. Der Terminus „Kulturuniversalien“ weist auf die Betrachtungsebene und darauf hin, dass sie in allen Gesellschaften („Kulturen“) vorkommen. Damit kann gut dem Missverständnis begegnet werden, es seien Eigenschaften aller Individuen. Der Wortbestandteil „Kultur“ kann aber leicht so verstanden werden, als sei damit gleichzeitig auf eine kulturelle Ursache der Universalien mit verwiesen. Da ich meine, dass eine Definition beschreibend sein, also keine Kausalannahmen beinhalten soll, habe ich mich dafür entschieden, das in der Arbeitsdefinition benannte Phänomen als „Universalien“ zu bezeichnen.
Universalien werden auch unter den Termini „universale Muster“ (Meyer 1990:133), „pankulturelle Faktoren“, „pankulturelle Kulturmuster“, „pankulturelle Wahrheiten“ (Osgood et al. 1975:160f., Geertz 1996:258) oder „ubiquitäre Kulturmerkmale“ behandelt. Seltener wird gesprochen von „kulturalen Universalien“ (Marschall:1990:8) oder „transkulturellen Universalien“ (Leininger 1991, Hanse Wissenschaftskolleg Delmenhorst 1993, Bargatzky 2000:266, Müller 2003a:8, 2003b:27, Chevron & Wernhart 2000/2001, Wernhart 2004:154, Brown 2005:1) und „anthropologischen Universalien“ (Kohl 2008:849). Vereinzelt liest man auch von „Universalität“ (Wernhart 1986:648), „interkultureller Universalität“ (Meyer 2002:26), „transkultureller Universalität“ (Rüsen 1998:21), „transkulturellen Gemeinsamkeiten”, „fundamentalen Gemeinsamkeiten“ (beides Gingrich 1999:276, 277), „kulturellen Gemeinsamkeiten“ (Chasiotis 2007:204) ,„interkulturellen Gemeinsamkeiten“ (Holenstein 1997:61), „universalen Kulturcharakteristika“ (Meyer 1990: 133) oder „überkulturellen Elementen“ (Ekman 1981:183). Eine seltene Redeweise ist die von „gattungsspezifischen Sachverhalten“, dem „Gattungsspezifischen“ (Cramer & Mollenhauer 1998:120; Hansen 2003:280), oder von „gleich bleibenden Grunderfahrungen“ (Opolka 1999:2) bzw. „elementaren Gattungserfahrungen“ (Renn 2002:57). Die letztgenannten Formulierungen ergeben einen Übergang zum Thema der „Natur des Menschen“, das weiter unten diskutiert wird.
Außerhalb der Sozialwissenschaften befassen sich im deutschen Sprachraum am ehesten Philosophen phänomenologischer Richtung oder Vertreter der interkulturellen Philosophie mit dem Thema. Universalien firmieren dort als „kulturinvariante“ Phänomene (Holenstein 1981:198). Genauer können sie als „interkulturelle Entsprechungen“ bestimmt werden, als Kulturerscheinungen, die über Kultur- bzw. Zivilisationsgrenzen hinweg typologisch ähnlich sind. Hierfür ist die Erkenntnis wichtig, dass kulturinterne Unterschiede von interkulturellen zu unterscheiden sind. Beispiele solcher typologischer Ähnlichkeiten bieten partikuläre Gruppierungen, die Gemeinsamkeiten in den Werten oder Weltvorstellungen mit ähnlichen Gruppen in anderen Kulturen haben – und sich stark von anderen in der eigenen Kultur unterscheiden –, etwa „Leute vom Land“ (vs. Städter) in Ostasien und Westeuropa (Holenstein 1997:51, vgl. 64).
In angloamerikanischen Untersuchungen wird zumeist von universals oder human universals gesprochen. Daneben gibt es die Bezeichnung cultural universals, im Französischen universeaux culturels. Seltener findet man den Terminus universality, z.B. in der kulturvergleichenden Psychologie („an essential universality“, Lonner 1980, ähnlich Triandis 1978:1. Smith & Bond 1993:55, Smith et al. 2006:25), der Umweltpsychologie (Gardner & Stern 1995:188) oder der Philosophie (Roughley 2000, Stagl 2000). Manche Autoren betonen den kulturübergreifenden bzw. kulturelle Grenzen „brechenden“ Aspekt, wie in den verbreiteten Termini cross-cultural universals (Fox 2005:11) und cross-cultural patterns. Seltener liest man von cross-cultural uniformity7 (Tooby & Cosmides 1992:88), the cross-cultural (Klass 1995:27), panhuman patterns (Alverson 1994), the panhuman (Klass 1995:27), general pancultural principles (Dissanayake 1992:68), universal cultural predisposition (Dissanayake 1992:16), universal human tendency bzw. commonality (Adams 1998:184, Dupré 2003:101, Sterelny 2003:192), common design (Keesing & Keesing 1971:119), universal culture elements (Wright 1996:76), consistencies across cultures (Hauser 2007:300) oder einfach von cultural elements (Peoples & Bailey 2003:37f.).
Daneben existieren im deutschen wie im englischen Schrifttum Termini, welche die räumliche Ubiquität oder die zeitliche Stabilität betonen. Hierzu zählen die Bezeichnungen als „Konstanten“ bzw. „Invarianzen“ (cultural constant, cultural invariants; transcultural invariants oder intercultural invariants; Simon 1990, Morin & Piatelli-Palmarini 19748, Schiefenhövel 1999:14, Opolka 1999:2, Messelken 2002b, Müller 2003b:28), „universale Konstanten“ (Mühlmann 1966:19f.) oder „universal konstante Antzendenzbedingungen“ (Müller 2003b:34). Auch die Redewendung „universell gegeben“ (Lautmann 2002:474) verweist auf ein Verständnis von Universalien als konstante Größen. Einige wenige Autoren fassen interkulturelle Gleichheiten einerseits und Kulturinhalte, die sämtliche Individuen einer Gesellschaft teilen, zusammen, so z.B. Ralph Linton (1883-1953) unter dem Terminus universals of culture (Linton 1936, vgl. Wilk 1985:396).
Eine ungewöhnliche Verwendung des Terminus sind die „Universalia humana“ bei Paul Spindler (1984) und Karl Wernhart. Sie verstehen darunter universale Körpermerkmale bzw. biotische Prädispositionen des Menschen, etwa die weltweit gleiche Grundstruktur unseres Gehirns (ähnlich Fox´ “biological universals“, 1971:281f.). Davon unterscheidet Wernhart in seiner Konzeption der Doppelnatur des Menschen die „Universalia cultura“ (im Singular Universalium culturicum). Sie sind Ausfluss des Lernprozesses durch Tradierung seit Beginn der Menschheitsgeschichte und dem diesem innewohnenden Entwicklungspotential (Wernhart 1986, 1987, 2001:47, 2004:24f., 38, Chevron & Wernhart 2000/2001:21). Wernhart geht davon aus, dass beide heute empirisch nicht (mehr) trennbar sind (dazu Plachetka 1997:116ff.). In ähnliche Richtung geht der Terminus species universals in man, den Crook für artspezifische Einschränkungen des Spielraums (constraints) vor allem im Sozialverhalten verwendet (Crook 1985:156).
Abb. 4: Termini mit dem Wortbestandteil „Universalien“ in gängigen Wörter- und Lehrbüchern der Ethnologie und Kulturanthropologie sowie ausgewählten weiteren Werken
Einige Forscher benutzen Umschreibungen, die entweder die Abstraktheit, die Allgemeinheit oder die Spezifität herausheben sollen. Dazu gehören abschwächende Termini, wie universal categories of culture (Kluckhohn 1953), verstärkende, wie genuine uniformities in culture content (Kluckhohn 1953:103) und genuine cultural universals (Leach 1982:111), sowie uniformities bzw. generic human traits (Brown 1991:3). Cohen umschreibt sie als Inhalte und Strukturen, die von verschiedenen Kulturen geteilt werden (shared content and structure, Cohen 1998:74). Eriksen umschreibt Universalien als „… shared cultivated, social dimensions of humanity“, was die Frage der Unterscheidung genetischer von kulturellen Universalien aufwirft bzw. bewusst offen lässt (vgl. Eriksen 2001b:41f., vgl. Abb. 3). Psychologen und Philosophen sprechen gelegentlich auch von universal humanity, panculturalism (Rolston 1999:156; 220), pancultural human psychological characteristics (Hinde 1999:14), pan-cultural pattern, metaculture (Sperber 1989, Tooby & Cosmides 1992:53; metacultural universals, Runciman 2000:213, Hinde 2003:15). Etliche der in der Literatur verwendeten Termini finden sich auch im Internet, dort jedoch in sehr unterschiedlicher Häufigkeit (Abb. 5).
Vielfach werden unklare oder metaphorische Begriffe verwendet, was ich mit Abb. 6 anhand eines Autors illustriere. Das gilt zunächst für die sehr verbreitete Rede von „anthropologischen Konstanten“ (z.B. Wehler 1990:232; Wright 1996:380, Straub 2003:139, Mittelstraß 2004:23f., Groh 2005:213). Mit diesem Terminus, der eigentlich „anthropische Konstanten“ lauten müsste, werden zumeist konstitutive Bestandteile oder Eigenschaften des Menschseins bzw. tiefer liegende Strukturen verstanden. Es sind nicht hintergehbare universale Voraussetzungen von historisch und lokal spezifischer Vielfalt (Mittelstraß 2004:24), z.B. Aspekte der Kultur(fähigkeit). Seltener liest man von „transkulturellen Konstanten“ (z.B. bei Mühlmann:1962, 1966:19; vgl. „constants across cultures“, Ekman & Friesen 1971:124f.). Recht unbestimmt bleiben auch Formulierungen wie „gemeinsames Erbe“ (Eibl-Eibesfeldt 1976:241ff., 1993 bzw. common heritage, „universales Regelsystem“ bzw. „Tiefenstruktur (Eibl-Eibesfeldt 1986:89f.). Die Formulierung „verbindendes Erbe“ (Eibl-Eibesfeldt & Sütterlin 2007:491) betont eine Brücke zwischen Menschen verschiedener Kulturen.
Ein Beispiel für schillernde Termini bietet der Religionswissenschaftler und Gräzist Walter Burkert. Er untersucht kulturübergreifende Ähnlichkeiten (ebenfalls mit ethologischen Grundannahmen). Er benennt sie mal als „weltweite Ähnlichkeiten“, dann als „recurrences in time and space“ bzw. „widely distributed recurrences“ (Burkert 1996:42) oder als „jenseits individueller Zivilisationen“ bestehend, als „a general class transcending single cultural systems“ (Burkert 1996:4). Er charakterisiert diese transkulturellen Muster als „eindrucksvolle“ Ähnlichkeiten“ (Burkert 1996:2), manche gar als „interkulturelle „unbezweifelbare Familienähnlichkeiten“ (Burkert 1996:4,17). An einigen Stellen spricht Burkert auch von „anthropologischen Universalien“ (1996:1,4), was sie in die Nähe anthropologischer Konstanten bringt.
Insbesondere der Begriff der „Natur des Menschen“ (human nature, conditio humana) wird sehr unterschiedlich gefüllt, weshalb ich die Problematik des Konzepts der Natur des Menschen weiter unten detailliert behandle. Die Schwierigkeiten bei der analytischen Trennung von Speziesmerkmalen des Menschen, die jeder Mensch als Organismus trägt einerseits, und Universalien als ubiquitäre Merkmale von Gesellschaften andererseits, erscheint beispielhaft in folgendem Zitat: „... one set of the universals that unify our species namely that set of capacities that allows us to create cultural diversity” (Carrithers 1992:5; Hervh. CA).
Abb. 5: Verbreitung des Themas Universalien im Internet 2002 und 2007 (NR = nicht recherchiert; Recherche für 2007: Dario Antweiler)
In der Literatur findet sich eine Fülle von Formulierungen, die mit unterschiedlicher Deutlichkeit universale Charakteristika von Kulturen benennen, oft ohne das Wort universal zu verwenden oder nicht zu sagen, was sie unter „universal“ oder „universell“ verstehen. Ich will dafür einige Beispiele geben: „sich praktisch in allen Kulturen nachweisen lassen“ (Mühlmann 1966:19), „bei allen bekannten Gesellschaften“ (König 1975:52), „Alle Personen und Sozietäten teilen ...“ (Bruck 1985:128), „universally salient“ (Dissanayake 1992:231), „found in every human society” (Dissanayake 1992:48), “for almost all cultures” (Dissanayake 1992:71), „believed to exist in all human societies“ (Wilk 1996: 396), „common major features“ (Wilson 1998:157; Runciman 2002:11), „universell gegeben“ (Lautmann 2002:474), „underlying commonalities between all human cultures” (Dupré 2003:101), „the large stable core“ (vs. variation in frequency and context, Konner 2003:440), „überall vorhandenen aber unterschiedlich beschaffenen Elementen“ (Haller 2005:29). In Abb. 6 habe ich unterschiedliche Formulierungen aus einem einzigen populärwissenschaftlichen Werk zusammengestellt, um zu zeigen, dass auch innerhalb eines Texts unterschiedlich präzise Aussagen vorkommen. Diese sind teilweise sicher auf den Wunsch nach sprachlicher Abwechslung zurückzuführen. Daneben reflektieren die Formulierungen auch inhaltliche Vorsicht bzw. empirische Unsicherheiten, die dem Thema inhärent sind und die in diesem Buch an etlichen Stellen behandelt werden.
Ähnlichkeiten und Familienähnlichkeiten
Manche Autoren sprechen bei der Behandlung von transkulturellen Mustern vorsichtiger von „universalen menschlichen Tendenzen“ (Peacock 2001:97). Andere nennen sie Ähnlichkeiten (cultural similarities, cross-cultural similarities bzw. similarities across cultures, basic similarities oder widespread similarities (Boas 1938:165, Kluckhohn 1953:512; Moghaddam 1998:11,274, Myers 2002:173, Ehrlich 2002:12, Ellen 2003.47, Ochs 2004:86). Diese Termini sind vorsichtiger gewählt als Murdocks „Gleichförmigkeiten und Übereinstimmungen“, indem sie schwächere Gemeinsamkeiten andeuten. Für Murdock sind es Gemeinsamkeiten zwischen bestimmten einzelnen Kulturen, die im Meer der kulturellen Vielfalt auffallen (1945:123). Solche begrenzte Ähnlichkeiten sind zwar nicht mit Universalien gleichzusetzen, aber sie sind für die Universaliensuche wichtig, wie ich im Methodenkapitel zeigen werde.
Ähnlichkeiten zwischen einigen oder auch vielen Kulturen werden in der Ethnologie zwar auch weit weniger untersucht als einzelne Kulturen, doch sehr viel häufiger als Universalien im engeren Sinn. Die relevanten Arbeiten hierzu stammen aus der Forschungsrichtung des (systematischen) interkulturellen Vergleichs, im internationalen Schrifttum als cross-cultural comparison, intercultural comparison benannt, seltener als holocultural oder transcultural bzw. sampled/complete-universe statistical comparison bezeichnet. Bei der Verwendung des Terminus „Ähnlichkeiten“ ergibt sich zusätzlich das Problem, dass manche Autoren Universalien als „strukturelle Ähnlichkeiten des Verhaltens“ bezeichnen (z.B. Meyer 1990:133, 1998; ähnlich Alland 1970:152). Benson Saler charakterisiert kulturelle Universalien als „… resemblances in form that are claimed to be found in every culture“ (Saler 2000:150; vgl. 156). Damit werden Universalien erstens auf die reine Form beschränkt und zweitens explizit als Postulate gesehen. Drittens bringt Saler Universalien mit dem Wort „resemblance“ in die Nähe der „Familienähnlichkeiten“ nach Ludwig Wittgenstein (1859-1951), statt sie als monolithische Universalien zu sehen.
Es gibt Begriffe, die inhaltlich dem Konzept der Universalien nahe stehen. So verwendet Ruth Groh den Begriff „anthropologische Fundamentalien“ in Absetzung von anthropologischen Konstanten (Groh 2004: 321f., SFB 511 2005:45f.). Dies ist eine Unterscheidung, auf die ich ebenfalls weiter unten genauer eingehe. Damit sind grundlegende Verfasstheiten und Vermögen des Menschen, wie die sprachliche und geschlechtliche Verfasstheit und seine Imaginationsfähigkeit, gemeint. Diese Fundamentalien (etwa das Vermögen zu Freude und Trauer) fasst Groh als nicht beobachtbare Konstrukte auf, weshalb sie indirekt über ihre jeweiligen Aktualisierungen (hier: Lachen und Weinen) erschlossen werden müssen.
Wie im Kapitel zur Rolle universalistischer Argumente in aktuellen gesellschaftlichen Debatten gezeigt wurde, sind Annahmen und Befunde zu Universalien für die Wissenschaften und auch für praktische Belange von eminenter Bedeutung. Im folgenden Kapitel bespreche ich die allgemeine Bedeutung, während die besondere Bedeutung für die Ethnologie in Kap. 3.4 behandelt wird.
Abb. 6: Formulierungen unterschiedlicher Präzisierung zur Allgegenwart von Eigenschaften bei Menschen und/oder Gesellschaften in einem populärwissenschaftlichen Buch