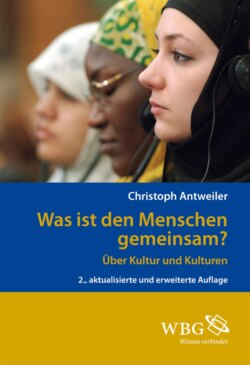Читать книгу Was ist den Menschen gemeinsam? - Christoph Antweiler - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einführung
ОглавлениеMenschen sind vielschichtige Naturwesen in vielschichtigen Sozialgefügen.
Christian Thies, 2004
Zusammenfassung „in a nutshell“
Journalisten bitten Autoren oft, ihr Buch in einem Satz zusammenzufassen. Angesichts dieses umfangreichen Buchs gönne ich mir drei Sätze: Es existiert eine enorme Vielfalt zwischen und innerhalb der Kulturen der Menschen, aber es gibt dennoch viele Phänomene, die in allen Gesellschaften regelmäßig vorkommen. Diese Gemeinsamkeiten gründen teilweise in der Natur des Menschen; teils haben sie aber auch andere, soziale, kulturelle und systemische Ursachen. Wir brauchen Kenntnisse über die Universalien der Kulturen für eine empirisch fundierte Humanwissenschaft und dieses Wissen ist auch politisch relevant für realistische Lösungen menschlichen Zusammenlebens.
Universalien und Vielfalt
Universalien sind nicht einfach das Gegenstück zur Vielfalt der menschlichen Gesellschaften. Wirklich interessant werden Universalien erst, wenn man sie als Muster vor dem Hintergrund der Diversität menschlicher Daseinsgestaltung sieht. Die Erforschung von Universalien bietet eine besonders fruchtbare Perspektive auf die so genannte Natur des Menschen. Sie bietet einen Zugang, der den Mittelweg zwischen spekulativen Ansätzen und Wunschdenken einerseits und theorielosem Aufsammeln von vermeintlichen Ähnlichkeiten andererseits sucht. Mich interessiert ein nichtmetaphysischer Zugang zur Frage nach dem Menschen. Das leitende Credo ist, dass man erstens den Menschen weder auf Natur noch auf Kultur reduzieren kann und dass zweitens Kultur nicht auf Geistiges begrenzt werden kann, sondern etwas inhärent Soziales ist. Das Buch soll als Beitrag zu einer Anthropologie dienen, die einen kleinsten gemeinsamer Nenner für das Gespräch zwischen denjenigen Wissenschaften abgeben kann, die sich mit Menschen befassen. Anthropologie fasse ich auf als „… Frage nach den Möglichkeiten des Menschen – und nach seinen Grenzen im Menschenmöglichen.“ (Hauschild 2005b:61) So verstanden bietet Universalienforschung einen Beitrag zu einer Humanwissenschaft im umfassenden Sinn, zu einer empirisch orientierten, dabei aber theoriegeleiteten Anthropologie als Wissenschaft vom „ganzen Menschen“.
Ich glaube, dass die Faszination durch die Vielfalt der kulturellen Varianten dazu verführt, die Gemeinsamkeiten zwischen Kulturen auszublenden. Dies geht mir selbst so: Ich befasse mich hier mit menschlichen Universalien, aber mich beeindruckt nach wie vor zunächst die Vielfalt – sowohl die Vielschichtigkeit zwischen Personen und innerhalb der Individuen als auch das Kaleidoskop der Kulturen. Dieses Buch ist ein Plädoyer dafür, Menschenbilder explizit zu machen, sie empirisch zu untermauern und dafür Ansätze der Universalienforschung aus ganz verschiedenen Fächern zu nutzen. Das bedeutet nicht, sich selbst, andere Menschen oder Kulturen nur noch als Vertreter eines Allgemeinen zu sehen. Ich meine aber, dass die gegenwärtigen Geistes- und Kulturwissenschaften recht einseitig auf die Besonderheiten einzelner Kulturen oder Subkulturen konzentriert sind. Kulturelle Unterschiede, die oft einfach feststellbar sind, können blind machen für weniger offensichtliche Ähnlichkeiten, eine Gefahr, die Robin Fox treffend als „ethnographic dazzle“ bezeichnete (Fox 1980, nach Fox 2005:2,11). Eine ultrarelativistische Fokussierung auf kulturelle Unterschiede verabschiedet sich allzu leichtfertig vom Universalmenschlichen.
Universalien und kosmopolitischer Humanismus
Wissenschaftler erforschen bestimmte Phänomene nicht nur aus dem Motiv, etwas wissen zu wollen, sondern ihre Erkenntnisinteressen gehen weiter. Daher gibt es auch außerwissenschaftliche Motive, die einen Autor in Fallen tappen lassen können; und davon hält das Thema Universalien einige bereit. Wenn man Gleichheiten oder Familienähnlichkeiten zwischen Kulturen findet, besteht die Möglichkeit, auf dieser Basis gezielt weitere Gemeinsamkeiten auszubilden (Welsch 2006:122). Eine Gefahr liegt hier aber darin, bestimmte Universalien herbeizuwünschen statt sie nachzuweisen. Für politische Institutionen kann die Idee, die Menschheit als kosmopolitische Interessensgemeinschaft zu begreifen, verführerisch sein. Ein Beispiel hierfür ist das gerade in der deutschen Entwicklungspolitik so gängige Motiv der „Einen Welt“, das als humanistische Version einer Ethik der planetaren Verantwortung durchaus als Handlungsanweisung wirksam wird. Angesichts der Sorge vor kultureller Zersplitterung und der Problematik einer galoppierenden Globalisierung ist die Suche nach Universalien, die Argumente gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus liefern, nur zu verständlich. Wenn weltweit eine Ideologie des Individualismus und der Konkurrenz verbreitet wird, besteht bei Kritikern die Tendenz, gegenläufige Normen oder Motive universell unbedingt nachweisen zu wollen. Gesucht wird dabei vor allem nach positiv bewerteten Eigenschaften des Menschen oder aller Kulturen, wie Sozialität und Altruismus.
Universalien und Ethnologie
Als Fach entstand die Völkerkunde um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Wissenschaftsgeschichtlich geht sie vor allem zurück auf die seit der Aufklärung virulent gewordene Frage, wie man die Vielfalt der Kulturen auf nichttheologische Weise erklären kann. Auch im Mittelpunkt der heutigen Ethnologie als moderner Völkerkunde steht zunächst die Vielfalt menschlicher Kulturen. Nach wie vor ist das Fach primär mit kulturellen Besonderheiten und kultureller Diversität befasst. Angesichts der in vielen Fächern und Medien verbreiteten Spekulationen über Universalien kann die Ethnologie demzufolge eine kritische und empirische Perspektive auf das Thema bieten und Behauptungen über Universalien mit kulturvergleichend geschulter Brille prüfen.
Im deutschen Sprachraum widmeten sich im 19. Jahrhundert und noch bis zum Zweiten Weltkrieg etliche Größen der Ethnologie dem Thema Universalien, z.B. Adolf Bastian (1826-1905) und Wilhelm E. Mühlmann (1904-1988). Heutzutage gibt es dagegen nur sehr wenige deutsche Ethnologinnen und Ethnologen, die sich mit Universalien befassen oder befassten, etwa Andreas Bruck, Thomas Hauschild, Hans-Jürgen Hildebrandt, Jürgen Jensen, Klaus E. Müller, Joachim W. Raum, Wolfgang Rudolph, Justin Stagl und Peter Tschohl. Die wenigen neueren Studien befassen sich mit Universalien zumeist im Zusammenhang mit einer Kritik an allzu konsequenten bzw. extremen Formen des Kulturrelativismus. Das einzige mir bekannte größere Forschungsprojekt zu Universalien in der Ethnologie in Europa war ein zweijähriges österreichisches Projekt „Menschliche Universalien und Kulturgeschichte“, das von Karl R. Wernhart geleitet und von Marie-France Chevron bearbeitet wurde (Chevron & Wernhart 2000/2001, Chevron 2004: bes. 398-422).
Eine Fokussierung auf kulturelle Besonderheiten und methodisch auf Fallstudien, eine Essentialisierung von Differenz, ist für die klassische Ethnologie kennzeichnend. Die Präponderanz kultureller Unterschiede gilt nicht nur für die deutschsprachige Ethnologie, sondern kennzeichnet das internationale Erscheinungsbild des Fachs. Diese Haltung erschwert innerhalb der Ethnologie eine so breit angelegte Studie. Völkerkundler haben immer wieder universalistische Interessen gezeigt und der Kulturvergleich, der sich für das Aufspüren von Universalien hervorragend eignet, war von Anbeginn eine Säule der Disziplin. Im Alltagsgeschäft ist das Fach aber auf partikularistische Fragestellungen konzentriert, die mit einem „mikroskopischen“ Methodenansatz untersucht werden. Die partikularistische Sicht enthält aber uneingestanden selbst schon die Suche nach allgemeinen Mustern, da Ethnologen primär nicht an Details als solchen, sondern an Mustern und Regelhaftigkeiten interessiert sind, wenn auch auf der Ebene einzelner Gesellschaften (Fox 2005:9ff.). Selbst Beschreibungen einzelner Kulturen sind implizit komparativ und beschäftigen sich damit indirekt mit Universalien, indem sie Lebensweisen in bestimmten (fremden) Kulturen den Mitgliedern anderer, meist westlicher, Kulturen erklären (Peacock 2001:96).
Die Fixierung auf Partikuläres und auf kulturelle Unterschiede prägt auch die Wahrnehmung des Fachs in der Öffentlichkeit. In Medien und Populärkultur steht die Ethnologie fast ausschließlich für Fremdes, Befremdendes und Exotik (Antweiler 2005a:4652, Schönhuth 2005:83-88). Das gilt genauso für ihre Wahrnehmung durch Vertreter anderer Geistes- und Kulturwissenschaften. Theorien und Befunde des Fachs werden in Wirtschaft, Medien und Politik aufgegriffen und benutzt, aber dabei geht es fast unisono um die Betonung kultureller Unterschiede. Dahinter steht ein inzwischen weltweites Verständnis von Kulturen als wechselseitig voneinander abgegrenzten „Containern“. Obwohl in den Kulturwissenschaften schon weitgehend überwunden, ist kulturelle Differenz gegenwärtig die globale Leitwährung des Denkens über Kultur. Aus Angst vor einer Homogenisierung der Weltgesellschaft und dem Verschwinden von Vielfalt hat sich der suchende Blick der Wissenschaftler, Politiker und Medien wieder den Grenzen und Unterschieden zugewendet. Das mittlerweile weltweit gängige Wort „interkulturell“ markiert mit der implizierten Annahme einer Beziehung zwischen klar abgegrenzten Einheiten schon die Problematik eines wieder erstarkten Denkens von Kulturen als Kugeln, Monaden oder Containern. Dies ist auch in den Kulturwissenschaften nur teilweise überwunden, ja sie florieren teilweise auf der Basis extremisierten Differenzdenkens (dazu kritisch van der Walt 2006, Welsch 2006:123, dagegen Griese 2008).
Universalien und Interdisziplinarität
Beim Thema Universalien ist Interdisziplinarität kein Postulat, sondern schiere Notwendigkeit. Disziplinär gesehen reicht es nicht, ethnologische Untersuchungen zum Thema heranzuziehen. Für eine Synopse musste ich mich in unterschiedlichste Wissenschaften und Denkweisen einarbeiten, was dauert. Weiterhin habe ich auch ältere und vor allem abgelegene Publikationen ausfindig machen müssen. Neben anderen Projekten habe ich an diesem Buch zehn Jahre gearbeitet. Für diese Untersuchung verwende ich Beiträge aus sehr vielen Disziplinen, sowohl aus den so genannten Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften als auch aus den Naturwissenschaften. Dies zeigt schon ein kurzer Blick in die lange Bibliographie. Viele der Autoren außerhalb der Ethnologie, die ich für besonders wichtig halte oder die mich besonders inspirierten, kommen aus sehr unterschiedlichen Fächern, z.B. Scott Atran (Psychologie), Pascal Boyer (Religionsphilosophie), Wolfgang Welsch (Philosophie), Carl Degler und Jörn Rüsen (Geschichtswissenschaften), Ellen Dissanayake (Ur- und Frühgeschichte), Elmar Holenstein (Linguistik, Philosophie), Bruno Latour (Soziologie), Peter J. Richerson (Ökologie) und Frans de Waal (Primatologie). Entsprechend der Reichweite des Themas ist es unvermeidbar, dass ich in vielen Bereichen dilettieren muss. Ich bin Ethnologe (Völkerkundler), habe aber daneben einen naturhistorischen Hintergrund.1 Diesen Erfahrungen zufolge nutze ich innerhalb eines breiten Spektrums an Disziplinen schwerpunktmäßig Erkenntnisse aus den Sozial- und Kulturwissenschaften, sowie diverse Ansätze darwinistisch inspirierter Humanwissenschaft.
Zielsetzung
Ich gehe davon aus, dass Universalien nicht einfach durch eine Art „Meinungsumfrage bei allen Völkern der Welt“ zutage gefördert werden können (Geertz 1992:65). Nur eine umsichtige Synthese empirischer Erkenntnisse mit einem konsistenten theoretischen Rahmen wird hier weiter bringen. Ich will in diesem Buch einen systematischen Überblick zum Thema Kulturuniversalien geben. Außerhalb der Linguistik gibt es zum Thema Universalien kaum monographische Arbeiten. Einschlägig ist ein Buch von Donald Edward Brown, welches die einzige neuere Monographie darstellt (Brown 1991). International gibt es einige wenige Sammelbände, im deutschsprachigen Raum widmen sich dem Thema außer einigen Aufsätzen explizit nur die von Neil Roughley (2000, dazu vgl. Antweiler 2004a) und Peter Hejl (2001) herausgegebenen Bände.
Einen besonderen Beitrag der Ethnologie zum Thema sehe ich in der prinzipiell vorsichtigen Haltung gegenüber Universalien. Ethnologen sind durch die Schule des Kulturrelativismus gegangen und haben eine grundsätzlich kontextualistische und vergleichende Perspektive. Universalienpostulate werden bei Ethnologen also immer erst einmal auf Vorbehalte stoßen. In einem Buch über Universalien kann diese Haltung dazu beitragen, allzu vorschnellen Postulaten von Universalien mit einer kritischen Vorsicht zu begegnen. Ich bringe Universalität und Vielfalt zusammen, statt sie gegeneinander auszuspielen. Hierfür nutze ich u. a. Erkenntnisse aus der Universalienforschung in der Linguistik seit den 1960er Jahren, die in der Ethnologie und anderen Kulturwissenschaften nur am Rande zur Kenntnis genommen wurden. Ein radikales, aber diskussionswürdiges Argument dieser Forschungen geht dahin, dass Unterschiede innerhalb von Gesellschaften und Diversität zwischen Gesellschaften in Art, Grad, Funktion und Auswirkungen gleich sind (Holenstein 1998d:326; Cappai 2005:96). Die intrakulturelle Vielfalt in einer Kultur wäre demnach der interkulturellen Variabilität der Menschheit analog. Damit könnte die Universalienforschung auch einen Beitrag zur Frage der Abgrenzung von Kulturen und zu Modellen kultureller Vielfalt leisten.
Im Hinblick auf die Kulturwissenschaften und hier besonders die Ethnologie möchte ich die Universalienforschung rehabilitieren. Dazu soll dieses Buch zum einen die Monographie von Brown um eine systematische Darstellung ergänzen und aktualisieren. Ferner sollen bei der Diskussion der Ursachen von Universalien die tendenziell evolutionspsychologische Argumentation bei Brown durch die Diskussion anderer Ursachen ergänzt werden. Dazu nutze ich vor allem neueres deutsch- und englischsprachiges Schrifttum, während ältere Arbeiten und französischsprachige Beiträge weniger Berücksichtigung finden. Weiterhin will ich die Kritiken an der Universalienforschung konstruktiv aufnehmen. Fundamentale Kritiken, etwa Positionen, welche die Existenz von Universalien verneinen bzw. der Ansicht sind, dass Universalien trivial oder nur durch pure Gleichsetzung gleich seien, sollen berücksichtigt werden. Auch Autoren und Autorinnen, die verallgemeinernde Wissenschaft und besonders die Rede von einer Natur des Menschen strikt ablehnen, kommen zu Wort. Dies sind etwa Kritiken, die aus postmodernistischen, poststrukturalistischen oder postkolonialistischen Richtungen kommen. Drittens sollen die neueren und leider sehr verstreuten Resultate der Universalienforschung seit den 1990er Jahren in einen Zusammenhang gebracht werden.
Ich versuche in diesem Buch, die folgenden Fragen nicht nur zu stellen und sie zu problematisieren, sondern auch Antworten auf sie zu geben:
Wie lässt sich der Satz „Alle Kulturen sind gleich“ verstehen, ohne in logische oder empirische Widersprüche zu geraten?
Wie lassen sich Universalien präzise bestimmen, ohne unbemerkt in die euro- oder ethnozentrische Falle zu tappen?
Welche Universalien werden – jenseits trivialer Gemeinsamkeiten – postuliert?
Wie lassen sich pankulturelle Muster empirisch nachweisen und welche der postulierten Universalien halten empirischer Evidenz stand?
Wie kann man Universalien erklären? Welche der unterschiedlichen Erklärungen stehen in Konkurrenz, welche ergänzen einander?
Warum kommen manche Phänomene zwar vor, sind aber als kulturell übliches Verhalten sehr selten (Vegetarismus, polyandrische Heirat, öffentlicher Geschlechtsverkehr), während andere überraschend weit verbreitet sind (Nahrungsverbote, Tieropfer)?
Welche Beziehung besteht zwischen Universalität und kultureller Vielfalt?
Welchen methodischen Wert haben Universalien für die Erklärung von intrakulturellem und interkulturellem Kulturwandel?
Worin besteht die Relevanz von Universalien für die Humanwissenschaften?
Welchen spezifischen Forschungsbeitrag leistet die theoriegeleitete empirische Ethnologie im Konzert der vielen Disziplinen, die bei der Erforschung von Universalien relevant sind?
Leserschaft und interdisziplinäre Brücken
Das Buch wendet sich zum einen an Wissenschaftler verschiedenster Fächer, die sich eine interdisziplinäre Perspektive zum Thema Universalien erarbeiten wollen. Zweitens habe ich als Leserinnen und Leser wissenschaftlich interessierte Laien und öffentliche Entscheidungsträger im Blick, die sich einen Überblick zum Thema verschaffen wollen. Um das Verständnis des Themas für Leser mit unterschiedlichen Kenntnissen und Interessen zu erleichtern, habe ich ein ungewöhnlich umfangreiches Glossar erstellt. Ich möchte in diesem Buch nämlich eine Brücke zwischen verschiedenen Wissenschaften bauen, die für ein Verständnis des Themas wichtig sind, die sich aber in sehr verschiedenen Sprachen ausdrücken. Ein Verständnis der jeweiligen Termini eines Fachs ist eine notwendige Voraussetzung, um Argumente und Befunde nachzuvollziehen und mit denen anderer Disziplinen zu verknüpfen. Angesichts der verschiedenen Adressaten habe ich bewusst nur wenige Fußnoten verwendet und die Angaben zu zitierter und benutzter Literatur sämtlich ins Literaturverzeichnis verbannt. Die dementsprechend umfangreiche Bibliographie führt ganz bewusst bei vielen Themen sowohl Originalarbeiten als auch zusammenfassende Werke und in Einzelfällen auch populär gehaltene Darstellungen an.
Fahrplan
Dieses Buch ist in drei Teile gegliedert. Dem in das Thema einführenden ersten Teil folgt eine historische Einordnung des Denkens über Universalien im zweiten Teil. Diese beiden Teile bilden die Grundlage für den längeren dritten Teil, der eine systematische Abhandlung des Themas bietet. Wer sich mehr für den wissenschaftlichen Hintergrund des Themas interessiert, könnte nur die ersten beiden Teile lesen. Wenn Sie sich dagegen eher konkret für Gleichheiten der Kulturen interessieren und sich fragen, wie man darüber etwas empirisch herausfinden kann, empfehle ich Ihnen, von Teil I direkt zu Teil III überzugehen.
Teil I gibt eine Einführung in das Thema und seine öffentliche Behandlung. Kap. 1 erläutert anhand des historischen Diskurses und aktueller Debatten, warum Gleichheiten zwischen Kulturen ein interessantes, aber auch umstrittenes Thema sind. Das 2. Kap. erläutert die wichtigsten Termini, zeigt, wie polysem das Wort „Universalien“ ist, führt in die zentralen Begriffe ein und verdeutlicht, warum das Thema besonders für die Kulturwissenschaften von Bedeutung ist. Eine der Hauptpunkte der Argumentation besagt, dass die Suche nach Gemeinsamkeiten menschlicher Kulturen und das Studium von Einzelgesellschaften einander wechselseitig erfordern, statt einander auszuschließen.
Teil II bietet eine geistes- und wissenschaftsgeschichtliche Einordnung des Themas. Kap. 3 gibt dazu eine geraffte Übersicht der vielen Strömungen des Denkens über Universalien und zeigt das breite Spektrum an Wissenschaften, die heute für das Thema relevant sind. Es zeigt sich hier, dass die einzelnen Fächer sich sehr unterschiedlich intensiv mit dem Thema befasst haben. So wird deutlich, dass Unversalien nicht nur ein aktuelles Thema sind, sondern uralte Fragen zu Menschen und ihren Kulturen betreffen. Dieses Kapitel beinhaltet auch eine gesonderte Darstellung der Behandlung des Themas in der Ethnologie. Kap. 4 legt meine Grundannahmen offen und leitet aus einer Kritik am eigenen Fach eine Programmatik der Ethnologie als einer modernen Kulturanthropologie ab. Dieses Kapitel wird in erster Linie Ethnologen und an Kulturwissenschaften Interessierte ansprechen.
Teil III stellt eine systematische Abhandlung zu Theorie und Methodik der Universalienforschung dar. Er bildet den Kern des Buchs und macht etwa die Hälfte des Textes aus. Kap. 5 bringt als theoretische Basis zunächst eine Darstellung des Verhältnisses zwischen Kulturen und der sog. Natur des Menschen. Weiterhin wird die Frage einer Sonderstellung des Menschen aufgrund neuerer theoretischer Einsichten und empirischer Befunde dargelegt. Eine zentrale Aussage dieses Kapitels ist, dass Universalien – entgegen weit verbreiteten Annahmen – nicht deckungsgleich mit Artmerkmalen des Menschen sind. Während sich die Natur des Menschen in jedem Individuum spiegelt, beziehen sich Universalien auf Kulturen als kollektive Einheiten. Kap. 6 gibt einen Überblick ausgewählter einzelner Universalien anhand einzelner Themenbereiche. Dort werden schon die methodischen Herausforderungen deutlich. Kap. 7 widmet sich darauf aufbauend den Methoden im Detail. Hier werden die Verfahren besprochen, mit denen man Universalien postuliert, erkennt und im Kulturvergleich überprüft. Ich diskutiere die Möglichkeit kulturunabhängiger Begriffe und die Problematik von Universalienlisten, einer klassischen Form, Universalien darzustellen. Kap. 8 erläutert die Vielfalt der Typen und Varianten von Universalien. Kap. 9 zeigt die Versuche, Erklärungen für Universalien zu finden. Dabei wird deutlich, dass es einige wenige Grunderklärungen gibt und dass die Bionatur des Menschen nur eine unter anderen Erklärungen darstellt. Kap. 10 gibt eine Übersicht über moderate und auch fundamentale Kritiken der Universalienforschung. Kap. 11 fasst die wichtigsten Aussagen zusammen. Der Anhang führt Beispiele von Auflistungen von Universalien auf, die im Text diskutiert werden und schon als solche zum kritischen Vergleich einladen.