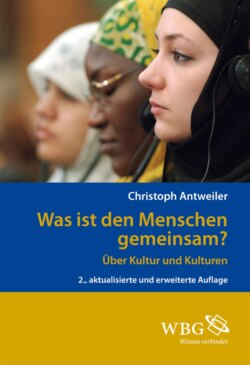Читать книгу Was ist den Menschen gemeinsam? - Christoph Antweiler - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление[Menü]
Vorwort zur 1. Auflage (Auszüge)
„Ich höre, du schreibst ein Buch über Universalien?“ fragen mich Kolleginnen und Kollegen. Dann folgt zunächst ein „Ach“, ein staunendes Schweigen, ein leises anerkennendes Pfeifen oder ein nachdenkliches „Mmmm“. Pascal Boyer berichtet als Religionsethnologe über ähnliche Reaktionen seiner französischen Kollegen. Die Aussage, er arbeite an einer allgemeinen Theorie von Religion, die mit universalen kognitiven Prozessen argumentiere, rief bei Geistes- und Kulturwissenschaftlern ein herzhaftes Lachen hervor, wie nach einem nicht allzu geistreichen Witz (Boyer 1994:xv). Auch ich musste eine gewisse Skepsis von Kollegen gegenüber diesem Vorhaben feststellen – warum dies so ist, ist bereits Teil der wissenschaftlichen aber auch öffentlichen Debatte um Universalien.
In diesem Buch geht es um Charakteristika, in denen sich alle Kulturen gleichen oder in denen alle bekannten Gesellschaften einander zumindest sehr ähnlich sind. Ich gehe der Frage nach, welche Phänomene sich regelmäßig in allen Gesellschaften finden. Das können soziale oder psychische Merkmale sein, ebenso wie Verhaltensweisen oder materielle Produkte. Die Universalität dieser Charakteristika gilt auf der Ebene von Kulturen (Gesellschaften, Sozietäten), weshalb sie oft „Kulturuniversalien“ genannt werden. Sie kommen in allen Kulturen vor, nicht aber notwendigerweise auch bei allen Individuen. Wir suchen nach kulturübergreifenden Kongruenzen, die über Triviales, wie die Tatsache, dass es in allen Kulturen Wirtschaft, Erziehung und Sexualität gibt, hinaus gehen. Schon weniger banal ist die Tatsache, dass Sexualität überall bestimmten Mustern folgt und kulturell geregelt ist. Eine der bekanntesten postulierten Universalien betrifft sehr spezifische Regeln zur Sexualität. Es ist die Inzestmeidung bzw. Inzestscheu, also das Vermeiden von Geschlechtsverkehr (bzw. der Heirat oder der Fortpflanzung) zwischen als verwandt angesehenen Personen. Diese populär als „Inzesttabu“ diskutierte Universalie hat nicht nur das Interesse Sigmund Freuds (1856-1939; 1956:7-24) geweckt, der dafür sorgte, dass die Diskussion um dieses Tabu auch in die öffentliche Debatte Eingang fand. Die Inzestmeidung und die damit verknüpften Normen, Verbote und Sanktionen haben eine enorme Faszination auf Klassiker der Ethnologie und Soziologie, wie John McLennan, Émile Durkheim, Lewis Henry Morgan, Johann Jacob Bachofen, Edvard Alexander Westermarck und Claude Lévi-Strauss, ausgeübt:
"If ten anthropologists were asked to designate one universal institution, nine would likely name the incest prohibition; some have expressly named it as the only universal one." (Kroeber 1939:46)
Eine Zusammenschau der neueren interdisziplinären Wiederauflage der Debatte zum Inzest und seiner Meidung (Turner & Maryansky 2005) beinhaltet neben 200 Seiten Text eine 46 Seiten lange dicht gesetzte Bibliographie! Das Inzestmeidungsgebot ist aber nur eines von zahlreichen Beispielen für das, worin menschliche Kulturen sich gleichen – und worüber Wissenschaftler hitzig debattieren. Im Unterschied zum Inzesttabu und wenigen anderen weithin bekannten Universalien, wie dem Ödipus-Komplex, wurde bislang über menschliche Universalien deutlich mehr spekuliert als theorieorientiert diskutiert und empirisch geforscht. Robin Fox gibt eine launig formulierte Auflistung, die die Bandbreite postulierter Universalien aufzeigt:
„Regeln über Besitz, Regeln über Inzest und Heirat, Tabu- und Meidungssitten, Methoden der Konfliktregelung mit einem Minimum an Blutvergießen, Glaube an Übernatürliches und darauf bezogene Praktiken, System des Sozialstatus und Methoden zur Anzeige dessen, Initiationszeremonien für junge Männer, Liebeswerbungspraktiken mit Bewunderung von Frauen, Systeme der Körperschmückung, männliche Aktivitäten, von denen Frauen ausgeschlossen sind, Wettspiele, Herstellung von Gegenständen und Waffen, Mythen und Legenden, Tanz, Vergewaltigung und in unterschiedlicher Dosis Mord, Selbstmord, Homosexualität, Schizophrenie, Psychosen, und Neurosen und verschiedene Praktiker, die daraus Vorteil ziehen oder es behandeln, je nachdem, wie sie gesehen werden.“ (Fox 1980:13f., Übers. CA)
Unter vielen Kolleginnen und Kollegen, die mein Denken über das Thema befruchtet haben, danke ich besonders Peter Hejl (Siegen) und Matthias Uhl (Bielefeld), die sich beide als darwinistisch inspirierte und zugleich sozialwissenschaftlich versierte Medienwissenschaftler mit Universalien befassen. Mit ihnen habe ich oft über das Thema diskutiert, u. a. im Rahmen gemeinsamer Vorhaben. Don Brown (Santa Barbara), dem Nestor der modernen Universalienforschung, danke ich für persönlichen Austausch und dafür, dass er mir Arbeiten schon vor ihrem Erscheinen zugänglich machte. Jerry Barkow (Halifax, Nova Scotia) und Pete Richerson (Davis, California) halfen durch offenen Austausch bei verschiedenen Gelegenheiten diesseits und jenseits des Atlantiks. Meinem Freund Philipp Gonon (Zürich) danke ich für viele bereichernde Gespräche über humanwissenschaftliche Themen.
Eine Hilfe waren und sind die organisierten Debatten in einer von der VW-Stiftung geförderten internationalen Tagungsreihe zu „Transcultural Universals“, die seit 2005 am Hanse-Wissenschaftskolleg in Delmenhorst bei Bremen (HWK; www.h-w-k.de) läuft und von mir mitorganisiert wird. Dies steht im Kontext eines langfristigen, von Gerhard Roth initiierten Forschungsprojekts zu „Determinanten menschlichen Verhaltens“. Hier wird der Brückenschlag zwischen Natur- und Geisteswissenschaften versucht. Dabei treffen nicht nur Wissenschaftler aus sehr unterschiedlichen Fächern, sondern auch aus verschiedenen nationalen Wissenschafts-„Kulturen“ zusammen. Der Dank geht hier vor allem an Uwe Opolka am HWK, der dieses Projekt vorantreibt. Dank gebührt auch den Betreibern des Internetforums „Menschliches Verhalten aus evolutionärer Perspektive“ (MVE-Liste; www.mve.de). Die hier angezettelten Debatten gehören im deutschen Sprachraum zu den seltenen Initiativen, das Für und Wider darwinistischer Argumente im Bereich der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften konstruktiv zu beleuchten, statt ihnen unkritisch zu huldigen oder sie in ignoranter Weise abzuwatschen.
Mein Dank gebührt aber auch Kolleginnen und Kollegen, die Vorhaben wie diesem äußerst kritisch bis ablehnend gegenüber stehen. Das gilt für die meisten Mitglieder und Stipendiaten des DFG-Graduiertenkollegs „Identität und Differenz. Geschlechterkonstruktion und Interkulturalität (18.-20. Jahrhundert)“, an dem ich als Mitglied mitwirkte und das von 2000 bis 2006 an der Universität Trier lief. Hier wurde ich in anregender Weise mit ultrarelativistischen Positionen aus der Genderforschung, den Cultural Studies und den Postcolonial Studies konfrontiert, die Versuche, allgemeine Aussagen über Menschen und Kulturen zu machen, mit gehöriger Skepsis sehen.
Ich danke meiner Frau Maria Blechmann-Antweiler und meinen Söhnen Dario und Craig dafür, dass sie es tolerierten, dass ich in der Endphase des Schreibens an diesem Buch nicht immer so zugänglich war wie gewohnt. Mein Dank geht auch an Kollegen an meinem Institut in Trier. Corinne Neudorfer gab viele inhaltliche Tipps und verbesserte vor allem viele meiner allzu kruden Formulierungen. Mit meinem Freund und Kollegen Michael Schönhuth führe ich seit Jahren immer wieder Gespräche, die mich weiterbringen und meine Arbeit befruchten. Bei diesem Buch war er eine unschätzbare Hilfe, weil er sich intensiv mit dem ganzen Manuskript auseinandersetzte und mir durch viele Hinweise und kreative Vorschläge half, die Argumentation in eine deutlich klarere Struktur zu bringen. Danke! Myriam Demuth war in der Endphase dieses Projektes eine sehr große Hilfe. Ich danke Simone Christ und Raphaela Wolberg für die Mühen mit Hunderten von Fernleihen, für exzessive Kopierarbeiten und für etliche Verbesserungsideen. Bezüglich der Beschaffung verstreuter Literatur und z. T. abgelegenen Titeln geht mein Dank auch an die effizienten Kräfte in der Bibliothek der Universität Trier.
Trier, Neujahr 2007
Christoph Antweiler