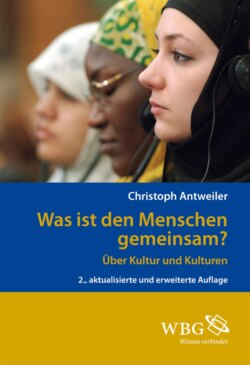Читать книгу Was ist den Menschen gemeinsam? - Christoph Antweiler - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление[Menü]
Vorwort zur 2. Auflage
Die erste Auflage dieses Buchs (2007) war erfreulich schnell ausverkauft. Obwohl es sich um ein wissenschaftliches Buch handelt, gab es auch sehr viel Interesse seitens der Medien. Mehr und mehr Menschen scheinen unzufrieden damit zu sein, Kultur immer nur als Differenz zu sehen und Identität nur noch im Plural zu buchstabieren. Auch durch die Globalisierungsdebatte besteht in der Öffentlichkeit eine Nachfrage nach wissenschaftlichen Beiträgen, die empirisch nach der Einheit der Menschheit fragen. Grundlegende Aussagen zum Menschen kommen heute besonders aus den Lebenswissenschaften. Andererseits besteht eine breite Kritik an ausschließlich biologischen Ansätzen. Insofern sind Beiträge gefragt, die eine ganzheitliche – tatsächlich biokulturelle – Sicht auf die Kulturen der Menschheit werfen. Hierzu gibt es im Fachbuchbereich und auch bei Sachbüchern nur wenige Beiträge, wenn man von weltanschaulich geprägter Literatur absieht. Auch wenn es das Ziel dieses Buchs bleibt, einen wissenschaftlichern Beitrag zu liefern, sind demnach politische Fragen mit zu bedenken. Bildlich gesprochen, geht es um die Frage, wie man die Welt als Ganze behandeln kann und sie dabei weniger als Globus betrachtet, womit Differenzen betont werden, sondern als Planeten, was den Blick auch für Gemeinsames öffnet (Sicks 2008).
Diese Auflage ist durchgehend überarbeitet worden. Für die Neuauflage habe ich bislang erschienene Rezensionen (Lacour 2007, Ponse, 2007, Chevron 2008, Ehlers 2008b, Griese 2008, Kather 2008a, Reiter, 2008, Wahlefeld 2008) genutzt. Die Besprechungen waren weitestgehend positiv. Dennoch enthielten sie Kritiken und Vorschläge, denen ich in dieser Überarbeitung nachgekommen bin, soweit es meine Kompetenz erlaubt. Weiterhin haben mir die Kommentare auf Rückmeldebogen geholfen, deren Versendung freundlicherweise die Stiftung Apfelbaum in Köln finanzierte. Hilfreich waren auch die Diskussionen nach den vielen Vorträgen, zu denen ich aufgrund des Buchs eingeladen wurde. Um dieses Vorwort nicht aufzublähen, möchte ich pauschal den Rezensenten und Kollegen sowie mehreren Forschungsgruppen und Sonderforschungsbereichen der DFG danken. Mein Dank gilt auch etlichen Journalisten, die mit mir im Radio und im Internet öffentlich diskutiert haben. Gerade bei einem Thema mit so vielen Facetten sind Reaktionen einer Vielfalt von Menschen mit unterschiedlichsten Erkenntnisinteressen und Anwendungsmotiven wichtig.
In dieser Auflage habe ich vor allem die Argumentation noch deutlicher strukturiert sowie neue theoretische Erkenntnisse und empirische Befunde eingearbeitet. Einige Grundaussagen wurden noch deutlicher konturiert. Erstens habe ich die Suche nach Universalien im Meer kultureller Vielfalt stärker von einem absolutistischen Universalismus abgesetzt. Wenn es um kulturelle Vielfalt und Einheit geht, lassen sich logisch immer Gemeinsamkeiten und Unterschiede behaupten. Um zu zeigen, dass dies aber nicht nur eine Frage der jeweils eingenommenen Perspektive ist, zeige ich zweitens noch deutlicher, warum und in welcher Hinsicht die Gemeinsamkeiten zwischen den Kulturen grundlegender als Differenzen sind. Drittens habe ich den Unterschied zwischen Universalien auf der Ebene von Gesellschaften bzw. Kulturen (pan-kulturelle Muster) und Eigenschaften, die alle menschlichen Individuen teilen (pan-humane Charakteristika), noch klarer herausgearbeitet.
Gegenüber der Erstauflage wurden in mehreren Kapiteln grundlegende Änderungen gemacht: Das Kap. 6, in dem einzelne Universalien besprochen werden, ist jetzt systematischer angelegt und erheblich erweitert. Aus diesem Grund sind die ausgewählten Universalien jetzt auch im Inhaltsverzeichnis in thematische Komplexe gegliedert. Das 7. Kap. zu Methoden habe ich so umgebaut, dass das notorische Problem kulturunabhängiger Begriffe jetzt vor die Besprechung der Universalieninventare und die Methoden des Vergleichs gestellt ist. Das Kap. 9 zu Erklärungen wurde dahingehend verändert, dass die „Fallstricke“ logischer angeordnet und außerdem als Fragen formuliert sind, weil das produktiver erscheint. Dem berechtigten Einwand, dass ältere Arbeiten zur Wissenschaftsgeschichte und französischsprachige Beiträge zu wenig genutzt werden, konnte ich in dieser Neuauflage auch angesichts der Mehrbelastungen durch die Studienreform kaum nachkommen. Die verarbeitete Literatur ist umfangreich, bleibt aber vorwiegend auf deutsch- und englischsprachige Werke ab der Mitte des 20. Jahrhunderts konzentriert. Durchgehend wurden Druck- und Formulierungsfehler korrigiert. Ich danke Simone Christ wieder für Korrekturen und auch für sehr gute Formulierungsvorschläge. In der Abschlussphase stellten sich plötzlich unlösbar erscheinende Probleme mit der Textverarbeitung. Meine Frau Maria-Blechmann behielt einen klaren Kopf und löste sie. Danke!
Eine Übersetzung dieses Buchs ins Englische ist in Arbeit. Dies wird ermöglicht durch die Volkswagenstiftung, die im Rahmen der Initiative Deutsch plus – Wissenschaft ist mehrsprachig die „Übersetzung herausragender deutschsprachiger wissenschaftlicher Arbeiten in eine andere Weltsprache“ finanziert (http://www.volkswagenstiftung.de/service/presse.html? datum=20080731). Das ehrt mich und ich danke der Volkswagenstiftung sehr, denn in den englischsprachigen Ländern werden die Themen dieses Buchs besonders intensiv diskutiert, wie das Literaturverzeichnis zeigt.
Köln, im Frühling 2009
Christoph Antweiler