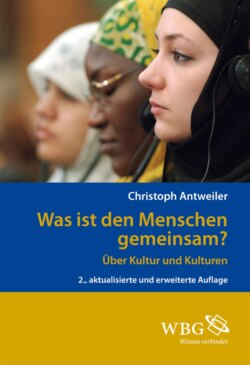Читать книгу Was ist den Menschen gemeinsam? - Christoph Antweiler - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2 Populärer Universalismus in visuellen Medien: The Family of Man
ОглавлениеIn den letzten Jahren häufen sich Projekte zur visuellen Dokumentation der weltweiten Vielfalt der Lebensformen der Menschheit (z.B. Ommer 2000, Lonely Planet 2004, 2005, Anonymus 2004, Winston 2005, Komatsu & Komatsu 2006). Diese Bücher zeigen auf den ersten Blick die Vielfalt der Menschen und die Diversität in ihren Lebensweisen. Unterschwellig wird aber auf universale Themen der Menschheit und kulturenübergreifene Probleme verwiesen. Ähnliche Projekte wollen Universalien in pädagogischer Absicht nahe bringen (Cleveland et al. 1979) und finden sich seit einiger Zeit auch im Internet (Payne & Gay 1997). Schon vor über 10 Jahren erlaubte ein von der UNESCO gefördertes „GeoSphere Project“, auf einer CD-ROM Einblicke in Daten und Fragebogenantworten von 30 „zufällig ausgewählten“ Familien aus der ganzen Welt (vgl. Wenker 2001, Menzel & Aluisio 2004, Menzel & Aluisio 2005).
Der klassische Vorläufer solcher Projekte war die extrem erfolgreiche Fotoausstellung The Family of Man, die Edward Steichen (1879-1973) für das Museum of Modern Art (MoMA) in New York als Kurator konzipierte. Anknüpfend an die Formulierung der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ von 1948 wurden 503 Schwarzweißaufnahmen von 273 Amateur- und Berufsphotographen aus 68 Ländern der Welt gezeigt. Mit dem Mittel der Photographie als Weltsprache zeigte die Schau in 24 Bildthemen, dass es überall allgemeine Menschheitsthemen und ähnliche Probleme, wie etwa Spiel, Arbeit, Geburt, Krankheit, Alter und Tod gibt. Steichen wollte damit einen „Spiegel der grundlegenden Übereinstimmung der menschlichen Gattung“ schaffen (Steichen 1955). Angereichert sind die Photos mit zeitlos wirkenden Zitaten, z.B. Sprichwörtern oder Sprüchen aus dem Alten Testament zu jeder Abteilung (zu Details Philipp 1987, Schmidt 1996). The Family of Man tourte als Wanderausstellung in Form von travelling editions zwischen 1955 und 1961 durch 67 Länder und war ein sensationeller Erfolg. In Zeiten des Kalten Kriegs vermittelte die Ausstellung die Idee der Menschheit als Einheit. Die vielfachen Teilungen der Menschheit erscheinen als Oberfläche, als Zufallsprodukt, unter dem eine identische Substanz liegt. Die Verquickung von Vielfalt der Menschen und Einheit ihres Handelns und ihrer Emotionen faszinierte ein Millionenpublikum. Das galt auch noch, als die Ausstellung in restaurierter Form ab 1993 in vielen Ländern der Welt, u. a. in Japan, erneut gezeigt wurde. In einer Zeit kultureller Umbrüche trägt diese Faszination, kombiniert mit humanistischen Utopien, sicher auch jüngere ähnliche Ausstellungen und Bücher.
Hinter solchen Projekten lauern manches Mal aber auch Wunschdenken, Sentimentalität, implizite politische Programmatik oder verkappte religiöse Ideale. In Berlin hieß die Ausstellung „Wir alle“ und in Paris „La Grande Famille des Hommes“, also „Die große Familie der Menschen“. Angesichts des Pariser Gastspiels kritisierte Roland Barthes die Ausstellung in seinen „Mythen des Alltags“ schon früh als moralisierend, sentimentalistisch und pseudoreligiös. Er sagt, dass die Bilder die Verschiedenheit der Menschen mittels Hautfarben und Gebräuchen erst einmal steigern, „babelisieren“, um aus diesem Pluralismus dann in magischer Weise die Menschheit als Einheit zu gewinnen:
„… der Mensch wird geboren, arbeitet und lacht und stirbt überall auf die gleiche Weise, und wenn in diesen Akten noch irgendeine ethnische Besonderheit steckt, so gibt man zumindest zu verstehen, dass hinter ihnen eine identische ´Natur´ liege und dass Verschiedenheit nur formalen Charakters sei und der Existenz einer gemeinsamen Materie nicht widerspreche. Das läuft natürlich darauf hinaus, eine menschliche Essenz zu postulieren, und schon ist Gott bei unserer Ausstellung wieder eingeführt ….“ (Barthes 1974:16)
Im Jahr 1994 hat die Ausstellung, die dem Herzogtum Luxemburg von der amerikanischen Regierung schon 1964 geschenkt worden war, im Schloss Clerveaux in Luxemburg in restaurierter Form ihre ständige Heimat gefunden. Während die Beiträge in der aus diesem Anlass erschienenen Jubiläumspublikation (Back & Bauret 1994) noch mit wenigen Ausnahmen (Segalen 1994) eine Hommage an Steichen darstellen, kam es in der Folge zu intensiven Diskussionen, in denen vor allem die Argumente Barthes vertieft wurden (Schmidt 1996, Back & Schmidt-Linsenhoff 2004; vgl. Kissler 2000). An der Ausstellung wurde sowohl die unfreiwillige Betonung der physischen Differenzen einerseits als auch die universalisierende Aussage bemängelt. Die monumentale Verbrüderung verleugne diktatorisch jede soziale Differenz. Letzteres wurde als Instrument des amerikanischen Imperialismus im Kalten Krieg gesehen. Die Ausstellung blende nicht nur soziale Ungleichheiten und Probleme aus, sondern insbesondere die jüdische Shoa. Manche kritisierten den unterschwelligen patriarchalen Touch der „Menschenfamilie“; das verkappte Ideal der Schau sei die amerikanische Normalfamilie. Andere warfen ihr eine dröhnende Didaktik vor. Die Ausstellung sei in ihrer Form eine Vorform von konsumorientierten Themenparks und der „United Colours“-Kampagne von Benetton.
In vielem ähnelt die Ausstellung tatsächlich dem tranational propagierten „We are all one“-Gefühl (During 2005:86), wie es im Rahmen der Olympischen Spiele, der Fußballweltcups, globaler Wohltätigkeitsevents und etwa von Firmen, wie Benneton verbreitet wird. Aber schon eine genaue Sicht der verschiedenen Benetton-Kampagnen würde zeigen, dass dort ganz unterschiedliche Konzepte zu kultureller Vielfalt umgesetzt werden. Wenn man die Ausstellung Family of Man ansieht, erscheint vieles an den oben genannten Kritiken als berechtigt; manches ist aber auch überzogen. Vor allem wird aber vergessen, dass der Begriff der „Family of Man“ neben aller Problematik ein ernsthaftes Potenzial in sich birgt, wie Gernot Böhme ausführt. Die Metapher der Familie muss nämlich nicht christlich, jüdisch oder patriarchal verstanden werden und sie muss nicht tröstend oder sentimentalistisch daherkommen. Diese Metapher kann auch historisch bzw. phylogenetisch gelesen werden. Die Zugehörigkeit des Einzelnen zur Menschheit wird mit dem Begriff „Familie“, mit dem Verwandtschaft, Verbundenheit und Einheit assoziiert werden, in besonderer Weise hergestellt. „Man ist Mensch, weil man von Menschen abstammt“ (Böhme 1999: 26). So könnte man die Menschheit über Zusammenhänge bestimmen, also extensional konzipieren und somit Vielfalt zulassen. Eine Menschheitsdefinition dagegen, die die Zugehörigkeit zur Menschheit an bestimmte Eigenschaften knüpft (intensional), erlaubt das kaum. Ein durch die Familienmetapher angeregtes, extensionales Verständnis von Menschheit könnte auch anschlussfähig für die neuere Debatte um universale Dimensionen der weltweiten kulturellen Vielfalt sein, womit wir bei einem Aspekt vieler universalistischer Ansätze sind, dem Streben nach Universalem.