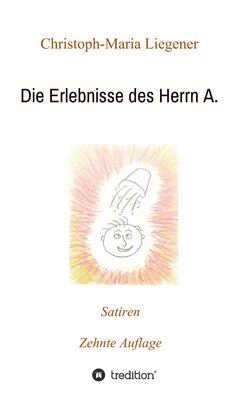Читать книгу Die Erlebnisse des Herrn A. - Christoph-Maria Liegener - Страница 18
ОглавлениеVor dem Fernseher
Gern machten es sich Herr und Frau A. abends vor dem Fernseher gemütlich. Sie sahen sich Filme an, die sie im Lauf der vorangegangenen Tage mit dem Festplattenrecorder aufgezeichnet hatten. Das hatte nicht nur den Vorteil, dass man nach Belieben Toilettenpausen einlegen konnte, sondern auch, dass man zurückspulen konnte, wenn man eingeschlafen war.
Außerdem konnte man sich besonders saftige Szenen noch einmal in Zeitlupe anschauen.
Allerdings gab es erste Anzeichen, dass sie zu viel fernsahen. Zum Beispiel erkannten sie mittlerweile die meisten Darsteller der Hauptrollen sofort. Es sind nur ein paar Schauspieler, die immer wieder in den verschiedensten Filmen auftauchen. So hat ein markanter Typ gestern noch den Kommissar gespielt, heute ist er der Bösewicht. Da muss man schon abstrahieren können.
Das hat leider dazu geführt, dass Herr und Frau A. eine Gesetzmäßigkeit bei Krimis erkannt haben, die ihnen von Anfang an die Spannung nahm:
Die Rolle des Bösewichts ist eine der wichtigsten im Film und wird immer einem namhaften Schauspieler bzw. einer namhaften Schauspielerin zugeschanzt. Wenn also bei den Ermittlungen des Fernsehkommissars ein bekanntes Gesicht auftaucht, weiß man sofort, dass er oder sie der Täter oder die Täterin ist.
Es gibt eine Ausnahme: eine Verstrickung, die zum dramatischen Leiden einer weiteren Person führt. Leiden schlägt Verbrechen. In solch einem Fall wird der Star das leidende Opfer repräsentieren, vorausgesetzt, das Leiden zieht sich in die Länge.
Tückisch ist dabei die Variante, dass der berühmte Schauspieler eine falsche Fährte legt. Es gibt sie selten, aber es gibt sie. Herr A. fällt auf so etwas immer herein. Er sagt gleich am Anfang:
„Klarer Fall. Den Schauspieler kenne ich. Das muss der Mörder sein.“
Umso überraschter ist er am Schluss, wenn es doch ein anderer war.
Besonders deutsche Krimis sind, wenn sie dieser Gesetzmäßigkeit folgen, auf die Weise leicht zu durchschauen. Die englischen neigen zwar zum gleichen Schema; jedoch kennt man hierzulande die englischen Schauspieler nicht so gut wie die deutschen und kommt nicht sofort auf die Lösung.
Die Spannung bleibt bei den englischen Filmen auch dadurch erhalten, dass alle, die nicht die englische Sprache mit der Muttermilch aufgesogen haben, sich die englischen Namen schlechter merken können als die ihrer Muttersprache. Man vergisst, wer denn wer war und kommt sich immer ein bisschen dumm vor, zumal die Engländer gern extrem komplizierte Familiengeschichten konstruieren, welche auf Verwandtschaftsverhältnissen beruhen, die ein normaler Mensch kaum noch durchschauen kann, es sei denn, er fertigte eine Skizze des Stammbaumes der Protagonisten an. Wenn dann der Kommissar am Schluss in einem Monolog die Lösung präsentiert, versteht man nur die Hälfte. Aber man weiß, dass der Gerechtigkeit wieder einmal Genüge getan worden ist. Das muss reichen.
So jedenfalls erlebte Herr A. die englischen Krimis. Aber sah er das richtig oder war es nur seine subjektive Meinung? Er musste seine Frau fragen. Beim nächsten Mal, als er Schwierigkeiten mit dem Verständnis eines solchen Filmes hatte, beklagte er sich bei ihr über die undurchschaubare Handlung des Filmes, worauf sie antwortete:
„Ich weiß gar nicht, was du hast. War doch alles klar.“
Und sie erklärte ihm den Film. Herr A. ging in sich. Hieß das, dass er dement war? Er prüfte sich gewissenhaft, machte sogar einen Test. Ganz so schlimm war es dann doch nicht. Er war wohl nur nicht recht bei der Sache gewesen. Seine Gedanken waren abgeschweift wie früher in der Schule, wo er als Träumer galt. Damals wie heute konnte Abhilfe geschaffen werden! Er beschloss, sich besser auf die Filme zu konzentrieren, wollte sich kein einziges Wort mehr entgehen lassen.
Bei dem Genuschel mancher Sprecher traf er allerdings auf neue Schwierigkeiten: Er verstand manches akustisch nicht genau. Als Pedant, der er nun einmal war, spulte er dann jedes Mal zurück, um es noch einmal zu hören. Das wiederum nervte seine Frau. Half auch das nichts, fragte er bei ihr nach. Das nervte noch mehr. Er bekam zu hören:
„Ich habe es auch nicht verstanden. Nun halte dich doch nicht mit diesen Kleinigkeiten auf! Das Gequatsche ist doch völlig unwichtig.“
Manchmal konnte sie ihm aber tatsächlich weiterhelfen, was dazu führte, dass er immer öfter nachfragte, bis sie ihm vorschlug, doch einmal zum Ohrenarzt zu gehen. Danach hat er es aufgegeben, alle Filme verstehen zu wollen.
Am meisten beeinflussten Herrn und Frau A. die amerikanischen Filme. Sie nahmen die beiden einfach zu sehr mit. Ein Beispiel: Wes Cravens „Scream“. Nach diesem Film verließen Herr und Frau A. nur noch schweigend das Fernsehzimmer, wenn sie mal kurz hinausmussten, weil sie gelernt hatten, dass man nie sagen darf: „Ich komme gleich wieder“; sonst kommt man eben nicht wieder!
Es gab noch einen weiteren Grund, amerikanische Filme nicht zu mögen, der allerdings nur Herrn A. betraf, nämlich den, dass seine Frau fast jedes Mal Feuer und Flamme für den männlichen Hauptdarsteller war. In einem Fall hatte es sie besonders schlimm erwischt. Das war, als Harry Foresome in der Schnulze auftrat, die ihn so berühmt gemacht hat … man weiß schon, welche. Frau A. konnte sich gar nicht beruhigen. Herr A. schwieg dazu.
Aber als er am nächsten Tag die Post hereinholte, tat er überrascht und verkündete seiner Frau:
„Eine Fotopostkarte von Harry Foresome an dich. Er schreibt, du sollst deinen idiotischen Ehemann verlassen und stattdessen ihn heiraten.“
Lachend entgegnete Frau A.:
„Sag ihm, ich würde meinen fantastischen Ehemann nicht für hundert von seiner Sorte verlassen.“
Dann – nach einem Augenblick – gab sie ihm einen leichten Knuff in die Seite und flüsterte:
„Du weißt schon, dass ich in Wirklichkeit sofort mit ihm gehen würde, nicht wahr?“