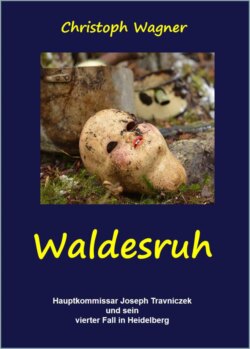Читать книгу Waldesruh - Christoph Wagner - Страница 23
16
ОглавлениеEs wurde drei und es wurde vier, aber Travniczek konnte keinen Schlaf finden. Dass er mit einem Mal wieder Vater von drei Kindern war, überflutete ihn mit einem lange nicht mehr gekannten Glücksgefühl und löste eine Kaskade von Erinnerungen aus: der Sandstrand von Sylt, wo er mit den Kindern eine riesige Sandburg baute; drei neugierige Augenpaare, die an seinen Lippen hingen, wenn er aus „Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer“ vorlas; die Geburt seines Ersten, als er Marion so sehr darum beneidete, dass sie neues Leben schaffen konnte; der sechsjährige Bernhard, der weinend sein totes Meerschweinchen im Arm hielt und streichelte, während er ihm erklären musste, was Tod bedeutete; der tiefe Frieden, den er empfand, wenn er spät abends müde nach Hause kam und die entspannten Gesichter seiner schlafenden Kinder sah.
Jetzt schliefen im Nebenzimmer Bernhard und Christian, im Wohnzimmer auf der Couch Julia. Alle waren beisammen, die er liebte. Marion vermisste er nicht. Und doch stieg in ihm die Angst auf, wieder zu versagen, der Situation wieder nicht gewachsen zu sein. Oder wollte er in Wahrheit gar nicht mit jemandem zusammenleben?
Da hörte er in sich den Anfang der großen Schubertsonate und fragte sich wie schon so oft: Zu wem spricht Schubert hier eigentlich? Spricht er überhaupt zu jemandem? Bei vielen anderen Komponisten ist das klarer. Wenn Bach eine Fuge schreibt, hält er Zwiesprache mit Gott. Beethoven war der Komponist, der den Menschen, allen Menschen, am meisten zu sagen hatte. „Volksreden an die Menschheit“ nannte ein Philosoph1 des letzten Jahrhunderts seine Sinfonien. Und Schubert?
Aus der großen Klaviersonate kam ihm eine spezielle Passage in den Sinn, die ihn jedes Mal, wenn er sie spielte, neu in ihren Bann zog. Eine Melodie mit Abschied nehmendem Charakter zerbröckelt gleichsam und mündet in eine starre Fragegeste, kalt wie Eis. Statt einer Antwort wird die Melodie wiederholt und mündet wieder in dieselbe Frage, die jetzt über immer lauter werdende Akkordballungen ins harmonische Nirgendwo führt. Dann bleibt nur noch diese Fragegeste übrig, mehrfach wiederholt in wachsender Intensität – Akkordfolgen von äußerster Brutalität – und dann die Antwort: Der tiefe Triller, der am Anfang des Satzes ganz leise fernes Unheil ankündigt, jetzt so laut wie möglich zu spielen. Das ist das Unheil selbst! Das Unheil, dem niemand ausweichen kann, das alle Schönheit dieser Welt vernichtet. …
Lange Pause – und als ob nichts geschehen wäre, beginnt die Musik wieder von vorne, der ganze lange erste Abschnitt wird wiederholt.
Und das komponierte ein Mensch wenige Wochen vor seinem viel zu frühen Tod.
An wen richtete sich diese Musik eigentlich? Wer war hier angesprochen?
Wahrscheinlich niemand. Hier sprach eine tief verwundete Seele mit sich selbst. Eine Seele, die zu groß war für diese Welt, die es aber nicht ertrug, von dieser Welt nicht verstanden zu werden, und sich dennoch ständig äußern musste in einer schier unfassbaren Zahl verschiedenster Kompositionen2, sich darin selbst verzehrte und den Körper, dem sie innewohnte, so zerstörte, dass er sein einunddreißigstes Jahr nicht überleben konnte.
Warum hatte ihn diese Musik schon immer so fasziniert? Es war eine Musik des Todes, so viel hatte er begriffen. Und er war Kriminalist geworden, seit Jahren in der Mordkommission, stand also ständig mit dem Tod auf du und du, und zwar mit dem Tod in seiner brutalsten Form.
Nicht mehr weiterdenken jetzt.
Er sprang aus dem Bett und legte seine Schlaf-CD ein. Sie begann mit der Einleitungssinfonia der Bachkantate „Ich hatte viel Bekümmernis“. Auch das eine tieftraurige Musik. Aber eine Traurigkeit, in der er den Keim der überschäumenden Freude schon hören zu können glaubte, zu der diese Kantate schließlich führen würde. Seine tiefen inneren Spannungen lösten sich und er fühlte sich wie auf Wogen davongetragen. Noch ehe die Sinfonia verklungen war, war er eingeschlafen.
Tagebuch - 20.2.
Vielleicht laufe ich einfach weg, weit weg, wo Vater mich nicht finden kann. Aber ich weiß nicht wohin. Oma hat gesagt, ich soll mal zum Herrn Pfarrer gehen und ihm alles erzählen. Der wird mir bestimmt helfen. Aber der Herr Pfarrer war schon böse, weil ich überhaupt zu ihm gekommen bin. Dann habe ich angefangen zu erzählen. Aber er wollte gar nicht zuhören. Er fing sofort vom vierten Gebot an. Ich mußte es aufsagen. „Der liebe Gott will, daß Kinder immer ihren Eltern gehorchen“, hat er gesagt.Will der liebe Gott auch, daß Vater mich dauernd schlägt?