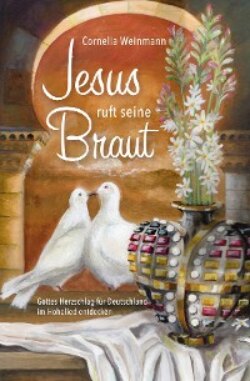Читать книгу Jesus ruft seine Braut - Cornelia Weinmann - Страница 23
8. Die Berufung des Friedenskönigs Jesus für seine Braut in Deutschland und weltweit
ОглавлениеDurch diesen „Tanz des Glaubens“ hindurch fließt in jeder Strophe die Berufung des Friedenskönigs Jesus für seine Braut in jeweils vier Tanzschritten in den laufenden Text ein. Der nationale und damit auch familiäre und persönliche Hintergrund des deutschen Teils der Braut Christi wird wesentlich in den Fußnoten dargestellt, selbst wenn auch das nur holzschnittartig geschieht. So soll zum einen die himmlische Berufung den irdischen Kontext jedes Einzelnen berühren können; doch zum andern kommt in den Tanzschritten zum Ausdruck, dass wir in diesem irdischen, vielleicht traumatisch erlebten Hintergrund nicht stehen bleiben oder gar versinken müssen; auch dann nicht, wenn es in der deutschen Geschichte immer wieder Rückschritte gegeben hat, wie es auch in einem Tanz geschieht. Doch Jesus will jeden Einzelnen seiner Braut, selbst mit „braunem Hintergrund“, für den Bund seiner Liebe und Regentschaft gewinnen und für seine wahre Bestimmung befreien. Das hat mich überwältigt und motiviert, den Glaubensweg durch dieses scheinbar kleine Liebeslied zu wagen und mich in den Ruf des Heiligen Geistes und der Braut einzureihen;36 denn es ist gerade dieser Ruf, der der Wiederkunft des Bräutigams vom Himmel vorausgeht. Das Ziel dieses Rufes ist erreicht, wenn wir selbst aufs Neue hören und zu dem kommen, der unser Leben, unser Land und unsere Welt heilen, wiederherstellen und erneuern kann.
Eine Antwort mit Herz und Mund zu geben, sind wir in diesem Lied der größten Liebe unseres Lebens eingeladen. Was durch die positive Antwort jedes Einzelnen dann auch in und durch Deutschland möglich wird, sind heilvolle Auswirkungen weit über Deutschland und sogar über Europa hinaus. Dafür ist allein der Himmel die Grenze. Wer Jesus, dem wahren Friedenskönig, in diesem geistlichen Durchgang durch das Hohelied begegnet, gewinnt dann vielleicht die Sicht, die am Lebensende eines Mannes stand, der schon einmal Europa beherrschen und unter sich selbst vereinen wollte. So sagte Kaiser Napoleon vor genau zweihundert Jahren im Jahr 1821 in einem seiner letzten Gespräche zu General Bertram auf Helena, wo er in der Verbannung war: „Zwischen dem Christenglauben und welcher Religion auch immer liegt die Kluft der Unendlichkeit. Alexander, Caesar und ich haben Reiche gegründet. Aber worauf beruhten die Schöpfungen unseres Genies? Auf Gewalt. Jesus Christus gründete sein Reich auf Liebe. Und zu dieser Stunde würden Millionen für ihn sterben. Ich habe mit all meinen Armeen und Generälen nicht ein Vierteljahrhundert lang auch nur einen Kontinent mir unterwerfen können. Und dieser Jesus siegt ohne Waffengewalt über die Jahrtausende, über die Völker und Kulturen.“ Dass diese Herrschaft der Liebe Gottes jeden Menschen erhebt und nicht erniedrigt, wird im Lied der Lieder besungen wie in keinem anderen Buch der Heiligen Schrift. Es mitzusingen und im Glauben in Bewegung zu kommen, dazu lädt es ein.
Auftakt: Der Weg der Braut bis zur Wiederkunft des Bräutigams Jesus Christus
Der Ruf von Jesus nach seiner Braut erklingt in dieser Zeit lauter und zugleich werbender als je zuvor.37 Denn auch der Tag seiner Wiederkunft ist näher denn je. In diesem Bild geht es wie in keinem anderen darum, sich in der Identität einer Braut als von ihm geliebt, begehrt und bestätigt zu erkennen. Wer sich danach sehnt, zum ersten Mal oder wieder neu mit Jesus in eine innerste Vertrautheit und Innigkeit des Herzens zu kommen, ist eingeladen, sich mit der Braut im Hohelied auf den Weg zu machen und seiner Liebe zu begegnen. Auf diesem Weg werden wir mit der Braut in die Entscheidung gestellt, die Liebe und Güte des Bräutigams zu glauben. Dann müssen wir trotz aller erlittenen Härten im Leben nicht hart bleiben, sondern können seine Hand ergreifen, wenn Jesus wie ein Bräutigam „um unsere Hand anhält“. Geben wir ihm wie eine Braut unser „Ja“, werden wir in den Bund einer Liebe gestellt, die sich niemals von uns scheiden lässt. Dieses Leben in Gemeinschaft mit Jesus hat dann die Macht, selbst die tiefsten Wunden zu heilen, die schwersten Traumata aufzulösen und uns zur Liebe zu befreien. Denn am Ende ist es der Ruf einer Liebenden, auf die er hört, wenn sie andere einlädt und zuletzt ihn selbst mit Sehnsucht bittet: „Amen, ja, komm, Herr Jesus!“38
Im Hohelied wird der Weg der Braut von ihrer (geistlichen) Geburt bis zu einer Reife beschrieben, in der sie das Werben des Bräutigams, mit ihr den Bund der Ehe zu schließen, verstehen und beantworten kann. Mit ihrer positiven Entscheidung in der Mitte des Liedes beginnt ab Kapitel 4,7 darum das Leben im Bund mit dem König und damit das schrittweise Identifiziertwerden mit dem Bräutigam und seinem Leben. Gerade dadurch erschließt sich ihr die alles überwindende Liebe Gottes zu ihr und zu seiner ganzen Welt.39 Das Bild von Bräutigam und Braut, das die Freiwilligkeit und Intensität seiner Liebe beschreibt und zugleich ihre Freiheit, darauf zu antworten, ist nicht neu.40 Doch gerade in der letzten Zeit vor seinem zweiten Kommen wird es mehr denn je offenbar, dass nur die Quelle dieser Liebe, der Heilige Geist selbst, den Hass der Welt überwinden kann. Darum ist der Ruf des Bräutigams gerade in Deutschland mehr denn je ein Ruf, sich dem Heiligen Geist zu öffnen wie nie zuvor.
1 Diese beiden Namen für Gott werden in den ersten beiden Kapiteln in der hebräischen Ursprache der Bibel gebraucht. Dabei beschreibt der Name Elohim in 1. Mo. 1,1 seine Souveränität, d. h. sein Königtum über seine gesamte Schöpfung. Zum andern wird der Name Jahwe zum ersten Mal im Bericht über die Erschaffung des ersten Menschen in 1. Mo. 2,4.7 gebraucht, der die Beziehung zu ihm ausdrückt. Die Kombination dieser beiden Namen für Gott, die dort gebraucht wird, zeigt gerade dadurch, dass der Mensch, der mit ihm in eine Beziehung tritt, den Herrn aller Welt an seiner Seite weiß.
2 Vgl. 1. Mo. 1,2. Das Konzept der Berührung Gottes durch den Heiligen Geist, damit ein Mensch für das Leben in der Liebe Gottes offen werden und in ihr reifen kann, durchzieht die ganze Bibel. Dafür sind die Buße von den toten Werken, der Glaube, die Lehre vom Taufen, vom Händeauflegen, von der Auferstehung der Toten und vom ewigen Gericht nach Hebr. 6,1.2 nur die Grundlage des Glaubens. Das Bild von Bräutigam und Braut betont aber darüber hinaus das Reifwerden in der Liebe zu ihm. Und um mit Jesus ein Geist zu werden, braucht es das Berührtwerden im Heiligen Geist (1. Kor. 6,17.19). In diesem geistlichen Durchgang durch das Hohelied geht es besonders um dieses Reifwerden durch und für die Liebe Gottes in einer Zeit, in der sie in vielen erkaltet. Das wird im Folgenden auf der persönlichen, gemeindlichen und nationalen Ebene entfaltet.
3 Diese Bildsprache wird an späterer Stelle weiter sprachlich begründet und entfaltet.
4 Dieselbe Absicht verfolgen in den Evangelien auch die Gleichnisse, die Jesus erzählt.
5 So z. B. in Hes. 16,1-14; Hos. 2,18-25; Jes. 54,2-5; 62,4.5 u.a.; Eph. 5,32. In allen Stellen kommt zum Ausdruck, dass Gott wie ein Bräutigam um sein Volk, das sich aus der Menschheit herausrufen lässt, wirbt.
6 D. h. die Herausgerufenen aus allen religiösen und ideologischen Systemen dieser Welt, die seit dem sogenannten Sündenfall entstanden sind. Die Bedeutung dieser Trennung von Gott wird im Folgenden besonders für den deutschen Teil der Brautgemeinde skizziert und entfaltet.
7 Vgl. 1. Kor. 15,45-47: „Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Aber das Geistliche ist nicht das erste, sondern das Natürliche; danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch; der zweite Mensch ist der Herr vom Himmel.“
8 Vgl. 2. Kor. 11,2. Dazu ist eine Haltung erforderlich, dass sie als Teil der Braut Christi gerade darin vorangehen, ihren Geist als Empfangsstelle für den Heiligen Geist zu öffnen, um wie der erste Adam das Leben gleichsam bräutlich zu empfangen. Diese Empfängnis des menschlichen Geistes durch den Heiligen Geist lässt die Gemeinde aus allen Völkern die Braut Christi werden. Das ist wiederum nur möglich, wenn sie erfährt, dass sie gereinigt ist durch das vergossene Blut Christi, der sein Leben für sie gegeben hat. Das sagte Paulus gerade dieser Gemeinde, was in seinem ersten Brief in 1. Kor. 6,9-11 ausgedrückt ist.
9 Vgl. 1. Mo. 6.
10 Es ist bedeutsam, dass der Name „Nimrod“ von Nered abgeleitet ist, was Rebell bedeutet.
11 Darum bedeutet der Name „Babylon“ auch Verwirrung. Vgl. 1. Mo. 10,6-10; 11,1-9.
12 1. Mo. 12,1-3; 15,6; Röm. 1,16.17; 4,1-25. Zu Abrahams Berufung in Mesopotamien vgl. Apg. 7,1-3.
13 Mt. 1,1; Joh. 1,29; 3,16; 10,4; vgl. Röm. 5,8-10.
14 Vgl. die Geschichte dieser Namensgebung in 1. Mo. 32,25-29. Der Name Israel bedeutet demnach: „Der, der gegen Gott und für den Gott kämpft.“ Zu dieser Übersetzung siehe Werner Penkazki, Israel – der dritte Weltkrieg – und wir, Ein Beitrag zu aktuellen Fragen, Verlag für Reformatorische Erneuerung, 5. Aufl., Wuppertal 2002, S. 25. Im Folgenden zitiert als Penkazki, Israel und wir.
15 Ewald Keck schreibt in Internetquelle: Keck, Ewald: Das Buch Hohelied, in: „Route 66 – Quer durch die Bibel“. Online abrufbar unter:
http://www.bibelwissen.ch/images/d/d7/Hohelied.pdf. [Zuletzt: 05.07.2021]:
„Das Hohelied ist in der deutschen Bibel das letzte der poetischen Bücher (Hiob, Psalmen, Sprüche, Prediger, Hoheslied). Im hebräischen Alten Testament ist es das erste der fünf Bücher der „Megilloth“ (Festrollen). Das Hohelied wurde am achten Tag des Passahfestes vorgelesen.“ Im Hebräischen ist es das Lied der Lieder, also das schönste aller Lieder. Seit Martin Luther wird es als das Hohelied bezeichnet.
16 Vgl. Mt. 16,16-19. Der römische Hauptmann Kornelius, der im besetzten Israel in Cäsarea stationiert war, wurde der erste Mann der römischen Besatzungsmacht, der aus der Religion der Vielgötterei zu seinem wahren Vater im Himmel zurückkam (vgl. Apg. 10,1-48). Der jüdischen Gemeinde in Jerusalem berichtete Petrus davon in Apg. 11,1-18.
17 Joh. 4,22.
18 So in Penkazki, a.a.O., S. 25. Vgl. „Juda“, online abrufbar unter:
https://www.geistlicher-felsen.de/der-stamm-juda.
19 So angekündigt in Jer. 31,31 und dann in Joel 3,1-5, was sich an Pfingsten zum ersten Mal erfüllt hat (vgl. Apg. 2,1-3.14-21). Um dieser Wahl Israels willen, das der Ausgangspunkt für das Heil aller Völker war, hat Gott sein Volk auch nicht verworfen (vgl. Röm. 9-11).
20 Angekündigt vor Karfreitag in Joh. 14,7-15 und nach seiner Auferstehung wiederholt in Apg. 1,4-8. Durch das Kommen des Heiligen Geistes konnten Menschen in fremden Sprachen Gottes rettende Taten loben. Unter denen, die sich für den Heiligen Geist öffneten und ihn willkommen hießen, war damit die Sprachbarriere aus 1. Mose 11 ohne Mühe überwunden; vielmehr wurden diese Menschen durch ihre Offenheit für ihn in die Anbetung des dreieinigen Gottes geführt. Das kam dann bald auch in Bekenntnissen und Liedern zum Ausdruck wie im Nicänischen Glaubensbekenntnis. In Abgrenzung zu Lehren, die seine Göttlichkeit bestreiten, heißt es darin: „Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten, und die eine, heilige, christliche und apostolische Kirche…“ Zitiert am Pfingstfest 2021 zu den Bibelworten aus Sach. 4,6 und dem Lehrtext in Tit. 3,6.7 in: Evangelische Brüder-Unität (hrsg.), Die Losungen der Herrnhuter Brüdergemeinde für das Jahr 2021, Friedrich Reinhardt Verlag, 291. Ausgabe, Lörrach/Basel 2020.
21 Joh. 3,8; 7,38f; Apg. 2,2f; Mk. 1,10; 2. Mo. 40,34f; Sach. 4,1-6; 1. Sam. 16,13; Eph. 1,13f.; 4,30-32.
22 Jes. 66,13. Dazu sehr hilfreich die sprachlichen und inhaltlichen Ausführungen von Helge Keil: Ruach – die weibliche Seite Gottes (wieder) entdecken. Online abrufbar unter: https://www.ankernetz.de/inspiratives/dateien/134-ruach-dieweiblicheseitegotteswiederentdecken.pdf [zuletzt: 05.07.2021]. Im Folgenden zitiert als Keil, Ruach, die weibliche Seite Gottes. Gerade im Blick auf die Erschaffung des Menschen nach seinem Ebenbild führt er aus: „Wir lesen schon zu Beginn der Schöpfungsgeschichte: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster über der Tiefe; und die Ruach Gottes schwebte auf [oder: brütete über] dem Wasser.“ A.a.O.: „Für die biblischen Sprachen ist klar, dass die Ruach weiblich ist und in Gott beides da ist – das Männliche und das Weibliche …: Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn; als Mann und Frau schuf er sie. Wichtig ist hier der Wechsel von Singular und Plural. Gott schuf den Menschen – Singular – nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn – wieder Singular -; als Mann und Frau schuf er sie – Plural. Mann und Frau sind zusammen der eine Mensch und das eine Bild Gottes. Das heißt dann aber auch, dass das Urbild von Mann und Frau in Gott selbst ist. Das eine Bild Gottes besteht aus Mann und Frau. Ein Mann alleine ist nur ein Teil des Bildes Gottes, eine Frau alleine genauso. Erst die beiden zusammen sind Bild Gottes.“ A.a.O. Gerade weil in Gott beides da ist, das Männliche und das Weibliche, kann er auch sagen: „Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“ (Jes. 66,13). Im Blick auf das NT führt Helge Keil weiter aus: „Wenn Jesus vom Heiligen Geist gesprochen hat, dann hat er von der Heiligen Ruach gesprochen. Für Jesus und seine Jünger war das selbstverständlich.“ Auch wenn das in einer Übersetzung verloren ging, hören sich die Schriftstellen nach dem ursprünglichen Sprachlaut so an: „Jesus verheißt uns: Denn nicht ihr seid die Redenden, sondern die Ruach eures Vaters, die in euch redet. (Mt. 10,20). Johannes der Täufer sagt von Jesus: Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiliger Ruach taufen. (Mk. 1,8). … Bei Jesu erstem Auftreten sagt er selbst: Die Ruach des Herrn ist auf mir. (Lk. 4,18).“ So ist es nicht verwunderlich, dass die Kirchenväter bis ins 4. Jahrhundert vom Heiligen Geist als von der Trösterin und Mutter sprachen. Vgl. Internetquelle Katharina Seifert (1997): Die weibliche Seite Gottes, Wissen der Bibel und der ersten christlichen Theologen wiederentdeckt. Online abrufbar unter: https://archiv.tag-des-herrn.de/archiv_1996_bis_2007/artikel/3816.php. [Zuletzt: 03.08.2021]. Dieser Beitrag wurde veröffentlicht in Ausgabe 19 des 47. Jahrgangs (im Jahr 1997). Im Folgenden zitiert als Seifert, „Die weibliche Seite Gottes“.
23 Vgl. Joh. 14,7. Denn er ist es, der den Glauben weckt und zum Gebetsruf befreit: „Abba, lieber Vater!“ Röm. 8,15.16.
24 Vgl. Luk. 15,11-24.
25 Diese Abwertung und der Ausschluss des Heiligen Geistes aus der pietistischen Gemeinschaftsbewegung und aus der Landeskirche in Deutschland sind, wie in Prolog: Wie alles begann, Punkt 2 bereits gesagt, mit der Berliner Erklärung im Jahr 1909 verbunden. In Internetquelle: Berliner Erklärung. Vgl. auch Jürgen Bühler, der dort zitiert ist: Die Berliner Erklärung und der Holocaust. Er vertritt ebenfalls die Überzeugung, dass die Berliner Erklärung maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass der Holocaust in Deutschland möglich war. Der Inhalt dieser Resolution und die Folgen, aber auch die Überwindung dieser Erklärung werden an späterer Stelle im Einzelnen aufgenommen und bedacht.
26 Mir ist bewusst, dass vieles auf vielen Ebenen schon geschehen ist und geschieht. Doch angesichts eines wachsenden Antisemitismus und Rassismus aus verschiedenen Quellen gehe ich in dieser Botschaft wesentlich der Frage nach, wo die Quelle des Lebens im Heiligen Geist in der Gemeinde Jesu noch nicht entdeckt, „frei gelegt“ und willkommen geheißen wurde und wird.
27 Vgl. Jes. 61,10 und 2. Kor. 5,21, wo diese Bildsprache des Kleides ebenfalls aufgenommen ist.
28 Im Gegensatz zum Braun, das entsteht, je mehr Farben man mischt, sodass eine Einheitsfarbe entsteht, die die Originalität verneint und Gleichschaltung bedeutet. Doch das widerspricht der bunten Vielfalt der Farben wie auch den vielfältigen Funktionen von Zellen und Organen eines menschlichen Körpers, die sich gerade durch ihre Unterschiedlichkeit ergänzen und darum alle gleich wichtig sind.
29 Da die Kapitelangaben im ursprünglichen Bibeltext nachträglich eingefügt wurden, überschneiden sich die acht Botschaften bzw. Strophen mit den Kapitelangaben, weichen jedoch an manchen Stellen auch von ihnen ab.
30 Das kommt auch in der ersten Strophe der Nationalhymne zum Ausdruck, die in den Schluss mündet: „Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt.“ Was nach der Zersplitterung seit 1848 als Sehnsucht nach einer neuen deutschen Einheit gemeint war, wurde im Nazideutschland umgedeutet, um seine Dominanz über andere Völker und Mächte zu proklamieren. Darum wurde in dieser Zeit auch nur diese erste Strophe gesungen. Die dritte Strophe, die heute als einzige für die deutsche Nationalhymne steht, wurde ausgelassen: „Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland! Danach lasst uns alle streben brüderlich mit Herz und Hand! Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blüh im Glanze dieses Glückes, blühe, deutsches Vaterland.“ In Internetquelle: Die deutsche Nationalhymne – alle 3 Strophen. Online abrufbar unter: http://www.liederundtexte.com/die-deutsche-nationalhymne/ [Zuletzt: 05.07.2021]. Im Folgenden zitiert als Die deutsche Nationalhymne.
31 Vgl. Offb. 22,17.
32 Vgl. Bickle, Hohelied, Band 1, S. 36–45. Denn gerade dieses Lied beschreibe die Vorzüglichkeit Jesu als Herrn der Herren, der darin zur Begegnung mit ihm einlade.
33 2. Chr. 32,7; vgl. 2. Chr. 20,15.20-22; Apg. 16,23-26. Auch das Lied von Philipp Friedrich Hiller ist dafür ein Beispiel: „Jesus Christus herrscht als König“. In EG, Nr. 123.
34 Seelische Wunden, die durch schwere Erlebnisse (wie in einem Krieg mit allen Folgen oder durch Naturkatastrophen) u.v.m. entstehen, die nicht verarbeitet werden können, werden in der Fachwelt mit dem Fremdwort Traumata ausgedrückt. Diese Erlebnisse werden im Menschen nicht in der linken Gehirnhälfte gespeichert, wo die Zeitorientierung, das logische Denken und das Sprachzentrum ist, sodass man einfach darüber sprechen könnte, sondern in der rechten, wo Bilder und Filme, Geschichten, Gefühle, Gerüche und Geräusche, sowie Bewegung und Musik verortet sind. Hilfen zur Überwindung dieser Bilder und Gefühle, die wiederum Körperreaktionen wie Bluthochdruck, Schreckhaftigkeit, Reizbarkeit, Schlaflosigkeit u.v.m. auslösen, sind darum gerade symbolische Erzählungen oder andere narrative Bearbeitungen traumatischer Prägungen und Erlebnisse. Maike Schult benennt den immensen Nutzen von Erzählungen oder narrativer Bearbeitung von traumatisierenden Ereignissen, wenn sie sagt: „Mit der Traumaerzählung stellt die Literatur ein Erzählmodell bereit, das es den Menschen überhaupt erst ermöglicht, das Unfassliche zu fassen und in Form zu bringen.“ In: Maike Schult, Ein Hauch von Ordnung. Traumaerzählung und seelsorgliche Arbeit. Habilitationsschrift im Fach Praktische Theologie, vorgelegt bei der Theologischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 2017b, 30. Zitiert in Klotz, Traumata, S. 217. Dabei erzählt der Betroffene das eigene Leben wie eine Geschichte. Es geht explizit nicht darum, die Realität und Vergangenheit inklusive der schädlichen Entwicklungen oder Erfahrungen möglichst konkret und exakt zu rekonstruieren. Sondern die Erzählung kann durchaus fiktiv werden, indem die erinnerte Vergangenheit durch positive Elemente und Darstellungen ergänzt oder ausgetauscht wird. Denn im Fokus ist nicht die Traumakonfrontation oder die möglichst realistische Dokumentation der Ereignisse, sondern es geht um das Erlebnis des heilsamen Erzählens. Monika Klotz zitiert Kristina Augst, die erläutert: „Erzählen wird dadurch heilsam, dass sich der/die ErzählerIn darin neu entwerfen und das eigene Beziehungsgefüge anders beschreiben und deuten kann. Durch das Erzählen bekommt er/sie Macht über die Ohnmachtserfahrung.“ In: Kristina Augst, Auf dem Weg zu einer traumagerechten Theologie. Religiöse Aspekte in der Traumatherapie – Elemente heilsamer religiöser Praxis. Praktische Theologie heute, Band 121, Kohlhammer, Stuttgart 2012, 194. Im Folgenden zitiert als Augst, Traumagerechte Theologie, zitiert in Klotz, a.a.O., 217. Andere Möglichkeiten, um über das eigene Leben sprechen zu lernen, sind unter dem Begriff My Life Storyboard auf S. 224ff dargestellt, wo es darum geht, das eigene Leben auf Ressourcen hin zu befragen und damit auch das Traumatische darin nicht nur rückwärts, sondern zugleich nach vorn gerichtet zu betrachten, auszuwerten und damit neue Kraft zum Leben zu gewinnen.
35 Mt. 6,9.10.
36 In Hld. 1,5.6 sagt das Mädchen, um das der König wirbt, nach HFA: „Schaut nicht auf mich herab … weil meine Haut so dunkel ist, braun wie die Zelte der Nomaden. Ich bin dennoch schön …“ In der Dimension der deutschen Geschichte hat mich gerade diese Formulierung überwältigt, dass es möglich ist, zu diesem Hintergrund zu stehen, ihn anzunehmen und nicht zu verschweigen. Denn in der Begegnung mit Jesus wird dieser Hintergrund entmachtet und durch Jesu erneuernde Liebe verwandelt. So kann das Mädchen eine ganz neue Zukunft gewinnen, die nicht länger von ihrer Vergangenheit bestimmt wird, sondern von der Gegenwart ihres himmlischen Bräutigams.
37 Im Hohelied wird deutlich, dass dieser Ruf nicht zuerst an eine Armee ergeht, ein Heer von Arbeitern oder an eine Herde, auch wenn es um ganz individuelles Hören und Antworten auf diesen Ruf ankommt. Es ist der Ruf des Bräutigams nach seiner Braut. Und jeder, der antwortet, tut es mit der Identität einer Braut. Wir brauchen mehr denn je die Klarheit, dass nicht in erster Linie Soldaten und Arbeiter gesucht werden, die möglichst wenig fragen und viel im Gehorsam leisten. Vielmehr geht es darum, wie wir schon jetzt mit ihm leben und ihm dienen – nämlich mit dem liebenden Herzen einer Braut.
38 Offb. 22,20.
39 Diese Antwort der Braut teilt das Lied sozusagen in zwei Teile. Dabei gleicht der erste Teil dem Ruf und Werben des himmlischen Königs, sich wie Adam an den ersten Kuss und damit an die erste Berührung Gottes zu erinnern, die aus Liebe geschah und ihm Leben, Würde und Bedeutung gab. Jeder Mensch ist eingeladen, auch nach vielen Abgründen der Trennung von Gott, jedes Wort von ihm wie einen Kuss Gottes zu empfangen, der ihn an sein Herz ziehen und ihn damit an seine eigentliche Bestimmung erinnern will: bei ihm zu sein. Darum ist jeder Einzelne gerufen, sich wie die Braut im Hohelied der Liebe Gottes neu zu öffnen und in ihr zu wachsen.
40 Wie bereits gezeigt, durchzieht es die ganze Heilige Schrift im Alten wie im Neuen Bund. Es ist der Ruf Jesu, zur ersten Liebe zurückzukommen und im Geist dieser Liebe mit ihm zu leben, zu lieben, zu leiden und zu lachen. Denn dieser Bräutigam ist zugleich der König aller Könige, der sie letztlich nicht nur in die Gemeinschaft, sondern auch in die Regentschaft mit ihm zusammen ruft, bis er sichtbar und siegreich wiederkommt.