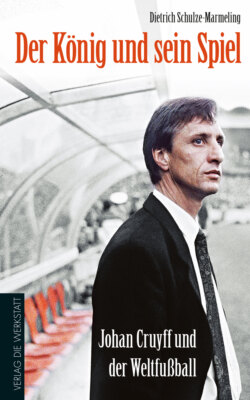Читать книгу Der König und sein Spiel - Dietrich Schulze-Marmeling - Страница 13
Jochen Hieber und der „Rolling Stone des Fußballs“
ОглавлениеJochen Hiebers erste Begegnung mit Johan Cruyff war, wie er selbst sagt, „leidvoll“, aber das sollte sich bald ändern. Hieber (Jahrgang 1951) ist seit 1983 Redakteur im Feuilleton der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Als Kulturbeauftragter für die WM in Deutschland ging er vor 2006 drei Jahre lang mit André Hellers Fußballglobus auf Tour. Die 15 Meter hohe, nachts blau leuchtende Weltkugel war das Herzstück des Kunst- und Kulturprogramms der Bundesregierung zur WM 2006. Der „Stern“ schrieb: „Das Duo Heller und Hieber verbindet Kreativität mit Nachdenklichkeit.“
„1968 bis 1974 sind die Jahre, in denen ich mich mit Cruyff besonders viel beschäftigt habe“, erzählt Hieber. Das hing damit zusammen, dass er in jungen Jahren mit dem 1. FC Nürnberg fieberte, der 1968 unter dem Trainer Max Merkel überraschend Deutscher Meister geworden war. In der Saison 1968/69 trafen der „Club“ und Cruyffs Ajax im Europapokal der Landesmeister aufeinander. In Nürnberg trennte man sich unentschieden, in Amsterdam behielt Ajax klar mit 4:0 die Oberhand. Hieber: „Da kam jemand von außen, da kam dieser schmächtige Mensch mit Namen Cruyff und zerlegte meine Mannschaft. Das war demütigend, nötigte mir aber auch Hochachtung ab.“
Das Ganze wiederholte sich einige Jahre später. „Im März 1973 wurde der FC Bayern im Europapokal von Ajax mit dem gleichen Ergebnis überfahren. Aber da war ich schon längst auf der Seite der Holländer. Es war ein Sieg, den ich als persönlichen Triumph erlebte.“ Diese Identifikation verband sich vor allem mit Cruyff, dessen Spielweise Hieber so beschreibt: „Wie Libuda spielte er die Gegner schwindlig, er konnte so unbeschreibliche und unmögliche Tore machen wie Gerd Müller – und wie Netzer gebot er über die Tiefe des Raums. Es war die Synthese aus Schönheit, Übersicht und Effizienz. Was mich ungemein faszinierte, war die Leichtigkeit, mit der er über das Spielfeld marschierte. Cruyff war überall und agierte nach dem Motto: ,Der Platz gehört mir.’“
Zwar wollte Hieber damals Cruyff ganz bewusst nicht idolisieren: „Diese Über-Identifizierung mit Stars machte man als Post-Achtundsechziger ja nicht mit.“ Aber seine Begeisterung galt auch keineswegs nur dem Fußballer: „In den Jahren 1968 bis 1974 sah ich mich mit Cruyff auf einer Wellenlänge. Cruyff war mit der Weltanschauung, die ich mir bildete, absolut kompatibel.“ Pelé sei dagegen eher „eine fiktive Figur aus exotischer Ferne, ein Märchenprinz aus dem Wunderland Brasilien“ gewesen. „Wir aber lebten rebellische und unpatriotische Jahre, in denen sich junge Leute zum Nachbarn Niederlande hingezogen fühlten, einem kleinen Land, das aus unserer Sicht besser war, freier, unspießiger. Cruyff und Co. waren der Inbegriff des Antiautoritären. Und Cruyff war der Oberindianer der Antiautoritären.“
Damit fungierte der Niederländer als Gegenfigur zu Franz Beckenbauer, den Hieber erst sehr viel später, im Vorfeld der WM 2006, wirklich kennen und schätzen lernte. In den 1970er Jahren aber galt: „Franz Beckenbauer stand für etwas, gegen das wir ganz entschieden waren: das Establishment. So fiel die Sympathie-Wahl logischerweise auf Netzer und Cruyff. Netzer repräsentierte eher die weiche Variante der Unangepasstheit, er war ein Pop-Phänomen, ein ,Easy Rider’ auf dem Highway des Zeitgeistes. Johan Cruyff hingegen: Das war Rock ’n’ Roll auf dem Rasen. Für mich war er der Rolling Stone des Fußballs. Er passte perfekt in mein damaliges Weltbild. Zwar hatte ich keinen direkten Bezug zu Amsterdam, aber die Stadt war die Metropole meiner Epoche, meiner Jugend. Man las und hörte viel über das freie Leben dort. Auf dem Fußballfeld wurde dieses Rebellische von Ajax repräsentiert. Die Galionsfigur dieser Stadt und dieser Mannschaft war Johan Cruyff. Er schien die Lebenswelt Amsterdams zu verkörpern. Cruyff stand für mich im Kontext mit Amsterdam an der Spitze des Fortschritts und damit auch der politischen Rebellion. Er war das Gegenstück zum angepassten Ambiente des FC Bayern, das sich auch noch mit Schickimicki paarte. Deshalb kam ich auch nie auf die Idee, für den FC Bayern zu sein. Es ging immer auch um den atmosphärischen Mehrwert, den ein Verein ausstrahlt. Und der FC Bayern strahlte CSU und Franz-Josef Strauß aus. Natürlich habe ich in Cruyff etwas hineinprojiziert, was er so wahrscheinlich gar nicht war. Aber Projektionen sind ja auch nicht dazu da, um etwas objektiv Wahres über eine Person oder einen Zustand auszudrücken. Sie dienen vielmehr dem Herausbilden und der Stärkung des eigenen Ichs. Und Cruyff gehörte ganz manifest zu jenen Figuren, an denen sich mein Ich stärkte.“
Als die deutsche Nationalelf 1972 in begeisternder Manier Europameister wurde, konnten sich auch „unpatriotische“ Liberale und Linke für das Team erwärmen. Hieber: „Aber dann ging Netzer zu Real Madrid und war fortan seiner zentralen Rolle in dieser genialen 72er-Mannschaft entledigt. Deshalb war meine Position vor der WM 1974: Wenn Bundestrainer Schön Netzer zugunsten eines Overath an den Rand drängt, optiere ich für Cruyff und die Holländer.“
Das Finale zwischen den Niederlanden und Deutschland wurde dann für Hieber auch zum Schlusspunkt seiner intensiven Beschäftigung mit Cruyff. Der zum besten Spieler des Turniers gekürte Cruyff war im Endspiel schwach, die Niederländer unterlagen mit 1:2. Hieber: „Da ist mit Cruyff etwas passiert, was ich nie mit ihm verbunden hatte: Er ist nach fulminantem Beginn regelrecht abgetaucht. Mein Cruyff-Enthusiasmus wich aufgrund des Finales einer gewissen Ernüchterung. Ich dachte: Gut, als Fußballer ist er ein Genie, aber eben ein romantisches, deshalb auch ein unvollendetes Genie. Zu wahrhaft klassischer Größe aufgestiegen wäre er nur, wenn er sein Werk auch mit dem Gewinn des Titels gekrönt hätte. So aber blieb eben der Eindruck des Unvollendeten. Mein Cruyff-Verhältnis wird nach dem Finale von 1974 ziemlich distanziert. Seit Herbst 1973 spielte er ja auch schon nicht mehr für Ajax, sondern beim FC Barcelona. Und die spanische Meisterschaft war damals noch etwas sehr Fernes, wir lebten im Vergleich zu heute eben noch in der medialen Steinzeit.“