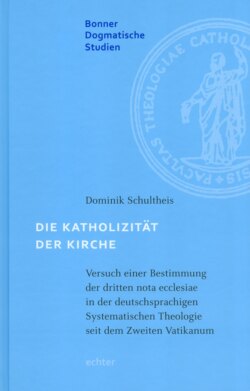Читать книгу Die Katholizität der Kirche - Dominik Schultheis - Страница 33
4.4Katholizität in der nachtridentinischen Kontroverstheologie
ОглавлениеWährend das Konzil von Trient (1545–1563) keine nennenswerten ekklesiologischen Themen diskutiert, versucht die nachtridentinische katholische Kontroverstheologie mittels des Katholizitätsbegriffs auf die sich ausbreitende Reformation zu reagieren. Dabei verwendet sie den Begriff „katholisch“ fast ausschließlich polemisch.173
Bemüht man anfangs noch Aussagen der Bibel sowie die Lehren des Vinzenz von Lérins und des Augustinus, um nachzuweisen, dass die vier Wesensmerkmale in der (römisch-)katholischen Kirche voll verwirklicht sind, so führt man zunehmend die weltweite Verbreitung der Kirche, also deren rein quantitative Katholizität als alleiniges Argument an, um die „ecclesia Romana“ als die wahre Kirche Jesu Christi herauszustellen.174
Kardinal Robert Bellarmin (1542–1621), der wohl bedeutendste und noch das I. Vatikanische Konzil sowie die Enzyklika „Mystici Corporis“ Papst Pius XII. beeinflussende Kontorverstheologe dieser Zeit – von Medard Kehl als Begründer eines „veräußerlichten und verrechtlichten katholischen Kirchenbegriffes“175 bezeichnet –, betont im Zuge seiner pointierten juridischen Ekklesiologie176 die Hierarchie der Kirche und den Primat des Papstes. Seine Kirchendefinition lautet:
„Die Kirche ist die Vereinigung der Menschen, die durch das Band des Bekenntnisses desselben Glaubens und die Teilnahme an denselben Sakramenten unter Leitung der rechtmäßigen Hirten und besonders des einen Statthalters Christi auf Erden, des römischen Papstes, verbunden sind“177.
Diese institutionalisierte und unter die Autorität des Papstes gestellte Kirche als „societas perfecta“ – von Gott mit allen notwendigen „Heilsmitteln“ ausgestattet – garantiere seiner Meinung nach alleine den Wahrheitsgehalt der „vera Christi Ecclesia“, die notwendigerweise nur eine sein könne. Anhand des Bekenntnisses des wahren Glaubens („vinculum symbolicum“), der Gemeinschaft in den Sakramenten („vinculum liturgicum“) sowie der Unterordnung unter den Primat des Papstes („vinculum hierarchicum“) meint er die Kirchenzugehörigkeit genau verifizieren zu können. „Die ‚forma Ecclesiae’ kann nicht die fides interna sein, will man nicht eine unsichtbare Kirche konzipieren, sondern nur die fides externa, das äußere Bekenntnis des Glaubens“178. Für ihn ist die Kirche „eine Gemeinschaft von Menschen, die so sichtbar und greifbar ist wie die Gemeinschaft des römischen Volkes oder das Königreich Frankreich oder die Republik Venedig.“179 Sein Bestreben ist es, mit Gewissheit herauszustellen, wie und woran man die notwendig sichtbare wahre Kirche erkennen könne. In diesem Bestreben will er allerdings die Kirche nicht gänzlich in den Bereich des Sichtbaren verlagern, bleibt sie doch immer auch „regnum coelorum“, das übernatürlichen, göttlichen Ursprungs ist. Dazu rekurriert Bellarmin auf die vier alten notae ecclesiae, die er allein in der „ecclesia Romana“ verwirklicht sieht. Die dritte nota benennt er als „nomen catholicum“, das schon immer „nota“ der einen und wahren Kirche gegenüber allen sektiererischen Tendenzen gewesen sei.180 Neben der geographischen Dimension der Katholizität stellt Bellarmin deren Kontinuitätsgedanken heraus. Er postuliert, dass es für die geographische Katholizität genüge, dass „die Kirche im Lauf der Geschichte einmal bei allen Völkern Fuß [ge]fasst [habe]. Es […][sei] nicht nötig, dass sie auch stets dort bleibe.“181 Mittels dieser These bleibt die „ecclesia Romana“ ungebrochen die numerisch größte, älteste, ursprünglichste und damit einzig wahre Kirche, auch wenn sich die aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen zahlenmäßig ausdehnen.
Als sich die aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen immer mehr verbreiten, scheint die geographische Dimension der Katholizität als alleiniges antiprotestantisches Argument an Beweiskraft zu verlieren. Dies ruft bei einigen Theologen die offenbarungstheologische Dimension der Katholizität auf den Plan: Nicht die numerische Größe der Kirche sei allein ausschlaggebend, sondern auch der Grad ihrer Rechtgläubigkeit.182 Ungeachtet solcher Ansätze, die Bestimmung der Katholizität nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ zu füllen, setzt sich in der Hauptrichtung der Apologetik bis ins 19. Jahrhundert ein rein quantitativ bestimmtes Verständnis von Katholizität als Argument gegen die sich ausbreitenden Kirchen der Reformation durch, wonach die Catholica mit der „ecclesia Romana“ identifiziert wurde:
„Katholischerseits [wurde] vom Lehramt und von der Schuldogmatik fast einhellig die Auffassung vertreten, die Kirche als Leib Christi oder Volk Gottes sei schlechthin identisch mit der konkreten römisch-katholischen Kirche. Denn Kirche wurde definiert als die Gemeinschaft jener Glaubenden (congregatio fidelium), die (1) das christliche Glaubensbekenntnis annehmen, (2) die Sakramente empfangen und (3) die institutionell-hierarchische Einheit mit der katholischen Kirche wahren.“183
Dieses verengte Verständnis der Katholizität der Kirche gipfelt darin, dass die Begriffe „Katholizität“ und „Einheit“ ab Mitte des 19. Jahrhunderts komplementär verwendet werden. Die Katholizität der Kirche im Sinne ihrer universellen (geographischen) Ausbreitung gereicht zur Bedingung der Möglichkeit ihrer im Primat des Papstes garantierten und sichtbaren Einheit: „Die Einheit wird zu einem desto wirkungsvolleren Merkmal der Kirche, je weiter diese zeitlich und räumlich ausgedehnt ist. Indem die Katholicität zu der Einheit hinzukommt, gewinnt der Beweis für die Wahrheit der Kirche an Anschaulichkeit und Evidenz“184.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts bemühen sich Theologen wie Johann Sebastian Drey (1777–1853)185 oder Johann Adam Möhler (1796–1838)186, das (römisch-)katholische Katholizitätsverständnis aus seiner konfessionellen Verengung herauszuführen und die ursprüngliche altkirchliche Bedeutung von „katholisch“ wieder ins Bewusstsein zu heben.187 Johann Adam Möhler etwa sieht die Katholizität in enger Verflechtung mit der Einheit: Die Vielfalt in der Kirche, die als ihre Katholizität aufgefasst werde, besitze die Eigenschaft, „dass sie nicht aufgelöst werden […][könne], ohne dass die Teile, welche das Ganze konstituieren, mit diesem selbst zugrunde“188 ginge. Einheit und Vielheit der von Christus begründeten Kirche versteht Möhler als dialektisch einander zugeordnete Größen: Ein jeder Teil am Leib der Kirche lebt seines Erachtens aus dem Geist des ganzen Leibes, aus seiner Einheit heraus. „Die Einheit darf nicht im Sinne von Uniformität oder Gleichförmigkeit bestehen; sie muss eine die Vielheit und Mannigfaltigkeit involvierende Einheit sein, die durch den Nachfolger Petri repräsentiert wird.“189 Auch der kleinste Teil der Kirche ist als Folge ihrer Einheit katholisch und die Katholizität wesentlicher Bestandteil des „innern Seins und Lebens“ der Kirche, nicht nur ihre äußere (rein quantitative) Erscheinung;190 ihren letzten Grund hat die Katholizität in der Heilsfülle Gottes. Ausgehend vom Geheimnis der Inkarnation (hypostatische Union) erklärt Möhler den Grund der Sichtbarkeit der Kirche in der Analogie zur Fleischwerdung des göttlichen Logos und versteht die Kirche – in nicht unproblematischer Formulierung – als „andauernde Fleischwerdung“ des Wortes Gottes.191
In ähnlicher Weise versteht Hans Klee (1800–1840) die Heilsfülle Christi als Ursprung der Katholizität der Kirche und bestimmt sie zuerst qualitativ, dann – nachgeordnet – quantitativ:
„Katholisch ist die Kirche, weil und inwiefern sie in sich das Allgemeine und Ganze, Christi Wahrheit und Gnade in äußerer, zeitlich räumlicher Erscheinung, und für den ganzen Menschen und das ganze Menschengeschlecht aller Orten und aller Zeiten ist, alle in dieselbe eingehen sollen und können; auch in wiefern sie aufwärts alle Frommen in sich begreift, eine neue Offenbarung und Herstellung des Ursprünglichen ist, und alles Heilige auf Erden und im Himmel, die nicht gefallene Geisterwelt und die hergestellte Menschenwelt begreift“192.
In Folge ergänzt Friedrich Pilgram (1819–1890) den wieder zunehmend im ursprünglichen Sinne gebrauchten Begriff der Katholizität durch die schöpfungstheologische Dimension.193 Der Theologe Franz Adam Göpfert (1849–1913) unterscheidet deutlicher zwischen qualitativer und quantitativer Dimension der Katholizität und sieht die quantitative in der qualitativen begründet bzw. versteht sie als deren Ausdruck.194
Dass derartige Versuche einzelner Theologen, die der intensiven Katholizität wieder zu neuer Beachtung verhalfen, lehramtlicherseits eher weniger Beachtung fanden, zeigt die Enzyklika „Mystici Corporis“195 (1943). Zwar korrigiert Pius XII. ein bloß juristisches Verständnis der Kirche durch die Aufnahme biblischer Aussagen sowie pneumatologischer Begründungen. Dennoch greift er die seit dem Tridentinum bestimmend gewordene Ekklesiologie Bellarmins auf und zieht für sein Kirchenverständnis (Kirche als „Leib Christi“) die Zwei-Naturen-Lehre der Enzyklika „Satis cognitum“ Leos XIII. (1896) heran. Die fast ausschließlich von dem Jesuiten Sebastian Tromp verfasste Enzyklika greift den nach der Reformation zum Kennzeichen der protestantischen Ekklesiologie avancierten Begriff „corpus Christi mysticum“ auf und wendet ihn auf die Kirche an. Zugleich identifiziert sie die sichtbare (römisch-)katholische Kirche mit dem „corpus Christi mysticum“ im Sinne eines strikten „est“.196 Der universale (katholische) Horizont des Heils, in den Paulus seine Leib-Christi-Lehre im Kolosser- und Epheserbrief ursprünglich stellte, und damit die qualitative Dimension der Katholizität der Kirche kommen hierbei nicht zum Tragen.197 Da sich gegen die in „Mystici Corporis“ entfaltete untrennbare Einheit zwischen sichtbarer und unsichtbarer Kirche Widerspruch erhob, erneuerte Papst Pius XII. in seiner Enyklika „Humani generis“ (1950) seine Auffassung von der Identität des mystischen Leibes Christi mit der römisch-katholischen Kirche.
Zum Durchbruch eines wieder verstärkt qualitativen und damit ursprünglichen Katholizitätsverständnisses verhilft neben den theologischen Arbeiten von Henri de Lubac (1896–1991) und Yves Congar (1904–1995) vor allem die biblische und liturgische Bewegung. Dank der Rückbesinnung auf die Grundbedeutung der Katholizität treten im 20. Jahrhundert das in ihr ausgedrückte Heilsmysterium der Kirche und deren Heilsuniversalität wieder stärker in den Vordergrund:
„Die innere und qualitative Katholizität hat ihren Ursprung im trinitarischen Heilsplan, dem gemäß die Kirche das Instrument des allgemeinen Heilswillens Gottes sein soll. Darum ist sie so groß und wie Gottes Wille. Hier liegt ihre wesentliche Katholizität. Die äußeren Realisationen der Katholizität, ihre raumzeitliche Universalität werden nicht übersehen, aber sie stehen nicht beziehungslos da, sondern haben ihren Sinn, ihre Begründung und auch das Maß ihrer Verwirklichung im Gottesgeheimnis selbst“.198
Diese bedeutsame Rückbesinnung lässt das Zweite Vatinum (1962–1965) eine Ekklesiologie vorlegen, die die Vorstellung einer Identifikation der wahren Kirche Jesu Christi mit der (römisch-)katholischen Kirche zwar nicht aufgibt, diese aber weitet („subsistit in“):
„Christus hat seine heilige Kirche […] auf Erden als sichtbares Gefüge verfasst [.] […] Die[se] mit hierarchischen Organen ausgestattete Gesellschaft und der geheimnisvolle Leib Christi […] bilden eine einzige komplexe Wirklichkeit, die […] in einer nicht unbedeutenden Analogie dem Mysterium des fleischgewordenen Wortes ähnlich [ist]. Dies ist die einzige Kirche Christi, die wir im Glaubensbekenntnis als die eine, heilige, katholische und apostolische bekennen. […] Diese Kirche, in dieser Welt als Gesellschaft verfasst und geordnet, ist verwirklicht in der katholischen Kirche, die vom Nachfolger Petri und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm geleitet wird. Das schließt nicht aus, dass außerhalb ihres Gefüges vielfältige Elemente der Heiligung und der Wahrheit zu finden sind, die als der Kirche Christi eigene Gaben auf die katholische Einheit hindrängen.“ (LG 8)
Was dies für das Selbstverständnis der (römisch-)katholischen Kirche und ihre Katholizität sowohl nach innen wie nach außen bedeutet, soll im späteren Verlauf dieser Studie analysiert werden. Kommen wir zuvor noch auf das Katholizitätsverständnis der altkatholischen Kirche zu sprechen, die sich aus Protest gegen die dogmatischen Definitionen des Jurisdiktionsprimats und der päpstlichen Unfehlbarkeit des Ersten Ersten Vatikanums von der (römisch-)katholischen Kirche abspaltete.