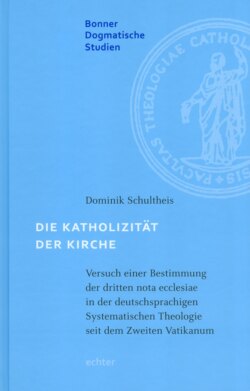Читать книгу Die Katholizität der Kirche - Dominik Schultheis - Страница 37
5. Ziel der Untersuchung und methodisches Vorgehen
ОглавлениеDer Aufriss des Bedeutungshorizontes des Begriffs „katholisch“ bzw. „Katholizität“, deren folgenschwere Begriffsgeschichte und die je unterschiedlich konnotierten Sichtweisen in den verschiedenen Denominationen lassen erahnen, dass die Wesensbestimmung der Katholizität sowohl für die binnenkirchliche als auch für die zwischen- und außerkirchliche Diskussion von nicht unbeachtlicher Bedeutung ist. Alle christlichen Konfessionen verstehen sich in direkter oder indirekter Weise als Repräsentantin bzw. Verwirklichungsform der einen Kirche Jesu Christi, deren Auftrag es ist, alle Menschen an allen Orten und zu allen Zeiten der unverfälschten Heilsbotschaft Jesu Christi teilhaftig werden zu lassen und in die volle Gemeinschaft mit Gott und untereinander zu führen. Hierzu, so der mehr oder weniger erhobene Anspruch, haben alle Konfessionen direkt oder indirekt Anteil an der Katholizität, die nicht nur drängt, sondern auch befähigt, der der Kirche zukommenden Sendung gerecht zu werden. Wie die Katholizität der Kirche derweil qualitativ begründet ist, d.h. worin und worauf ihr Katholischsein essentiell gründet und was dies für Auswirkungen auf den zugrunde zu legenden Kirchenbegriff hat; wie die Katholizität der Kirche ferner quantitativ zu ergründen ist, d.h. woran man denn überhaupt objektiv erkennen kann, dass eine Kirche „katholisch“ ist; und wie sich die qualitative Dimension der Katholizität, also ihr Seinsgrund (intensive Katholizität), letztlich zu ihrer quantitativen Dimension, ihrem Erkenntnisgrund (extensive Katholizität), verhält, bleibt in den verschiedenen Konfessionen indes unterschiedlich beantwortet.
Die vorliegende Untersuchung will diesen Fragenkomplex unter einem begrenzten Focus – nämlich aus Sicht des spezifisch (römisch-)katholischen Kirchenverständnisses seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil – aufgreifen und weiterführen. Sie versucht zu klären, wie das Wesen der Katholizität auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil und in Folge dessen in der deutschsprachigen katholischen nachkonziliaren systematischen Theologie bestimmt wird, d.h. wie deren Seinsgrund (qualitative, intensive Dimension der Katholizität) und Erkenntnisgrund (quantitative, extensive Dimension der Katholizität) inhaltlich gefüllt und beider Verhältnisse zueinander gesehen und gewichtet werden. Anlass dafür gibt die Beobachtung, dass die in der gegenwärtigen theologischen Diskussion gebräuchliche Differenzierung von qualitativer und quantitativer Dimension der Katholizität – wenn auch nicht den Begriffen nach, so doch inhaltlich – schon seit frühester Zeit intendiert war. Bereits Ignatius von Antiochien zeigte mit der Bezeichnung „ἡ καθολικὴ ἐκκλησία“ sowohl die qualitative Fülle und Vollkommenheit der Kirche als auch ihre quantitative Weite und universale Verbreitung an. Mit dieser Differenzierung aber – und hierin lassen sich Unterschiede im konfessionellen Verständnis der Katholizität erkennen – schrieb er der Kirche keine ausschließliche Seinsbeschreibung zu, die der Kirche eine nur unsichtbare Wirklichkeit, eine vage und unbestimmte Allgemeinheit zuspricht. Vielmehr dachte Ignatius die Katholizität immer schon zugleich als eine notwendig sichtbare, konkretisierte Universalität der Kirche, als eine „Katholizität in konkreter Gestalt“243. Seine Äußerung: „Wo der Bischof erscheint, da soll auch die Gemeinde sein, wie da, wo Christus Jesus sich befindet, auch die katholische Kirche ist“244 lässt erahnen, dass Ignatius mit dem Attribut „katholisch“ aussagen wollte: Die in Christus innergeschichtlich erschienene Fülle des Heils (vgl. Joh 1,16; Eph 1,10; Kol 1,19. 2,9) ist in seiner Kirche zugegen (Seinsgrund der Katholizität); und sie ist dies nicht auf eine unkonkrete, allgemeine Weise, sondern in einer notwendig konkreten und sichtbaren Gestalt (Erkenntnisgrund der Katholizität).
Die vorliegende Untersuchung geht analytisch-systematisch vor. In einem ersten, mehr analytischen Teil schält sie die Bedeutungsvielfalt des Begriffs „katholisch“ bzw. „Katholizität“ heraus, wie sie die Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzil erkennen lassen, und bringt diese mit den übergeordneten ekklesiologischen Leitbegriffen des Konzils in Zusammenhang.
Im ersten Kapitel werden alle Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils hinsichtlich der Verwendung des Begriffs „katholisch“ bzw. „Katholizität“ gesichtet. Untersucht wird, an welchen Stellen, mit welcher Bedeutung, in welchen Kontexten und – sofern zu eruieren – mit welcher Intention die Konzilsväter in den Konstitutionen, Dekreten und Erklärungen von der „katholischen Kirche“ bzw. von ihrer „Katholizität“ sprechen. Die die Konzilstexte vorbereitenden Schemata und Eingaben sind nicht Bestandteil dieser Analyse. Von dieser textkritischen Durchsicht wird ein breiter Verständnishorizont zu erwarten sein, vor dem die weiteren Studien betrieben werden sollen. Bei diesem analytischen Schritt werden erste heuristische Spannungsfelder245 ersichtlich werden, die sich aus der Verhältnisbestimmung von qualitativer und quantitativer Katholizität ergeben. Solche im Verlauf der Untersuchung immer wieder zur Sprache kommende Spannungsfelder lassen nicht nur die der Katholizität eigene innere Dynamik erahnen, sondern weisen bereits auf kontrovers diskutierte Probleme der Ekklesiologie und Ekklesiopraxis hin, die im weiteren Verlauf der Untersuchung immer wieder aufgegriffen werden. Auf der Grundlage der analytischen Durchsicht aller Konzilstexte unter dem Aspekt der Katholizität wird am Ende des ersten Kapitels die These in den Raum gestellt, ob die Katholizität nicht als hermeneutischer Schlüssel zur rechten Interpretation der ekklesiologischen Grundlinien des Konzils verstanden werden kann.
Um diese These zu stützen, wird in einem nächsten Schritt das, was die Konzilsväter meinen, wenn sie von der „katholischen“ Kirche bzw. ihrer Katholizität sprechen, in Zusammenhang mit den drei zentralen ekklesiologischen Leitbegriffen des Zweiten Vatikanischen Konzils gebracht: „Volk Gottes“, „Leib Christi“ und „Communio“. In diese systematische Zusammenschau fließen erstmals ausgewählte deutschsprachige Beiträge nachkonziliarer katholischer systematischer Theologie ein. Ziel dieser im zweiten, dritten und vierten Kapitel vorgenommenen Synthese ist es, die zuvor erhobene These zu belegen, dass die Katholizität als eine integrierende Größe aller wesentlichen ekklesiologischen Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils angesehen werden kann. Dabei wird die zentrale Bedeutung erkenntlich, die die dritte nota ecclesiae für die Kirche nicht nur nach innen, sondern auch nach außen einnimmt. Jedes Kapitel widmet sich in einem je abschließenden Exkurs einem in den letzten Jahren in der theologischen Wissenschaft kontrovers diskutierten ekklesiologischen Problem, das die Frage nach der Katholizität der Kirche berührt und in möglichen Lösungsansätzen Auswirkungen auf eine Bestimmung der Katholizität hat.
Nach diesem ersten Teil, der erste Linien einer systematischen Bestimmung der Katholizität erkennen lässt, soll in einem zweiten systematischen Teil vertiefter nach dem Wesen der Katholizität und möglichen Schlussfolgerungen für das Selbstverständnis der (römisch-)katho-lischen Kirche sowohl nach innen wie nach außen gefragt werden.
Ausgehend vom sakramentalen Kirchenverständnis des Zweiten Vatikanischen Konzils wird im fünften Kapitel der Versuch einer christologischen (sakramentalen) Wesensbestimmung der Katholizität unternommen, die ihre Konkretisierung im inner-, zwischen-, und außerkirchlichen Spannungsverhältnis von Einheit und Vielfalt erfährt. Die Literaturauswahl beschränkt sich auf deutschsprachige katholische Autoren seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, die in ihren Schriften einen betont christologischen Ansatz zur Bestimmung der Kirche erkennen lassen. Einzige Ausnahme bilden ausgewählte Schriften Henri de Lubacs, der als Vertreter der Nouvelle Théologie besonderen Einfluss auf die Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils und das Verständnis der Katholizität genommen hat. Die entfaltete christologische (sakramentale) Grundlegung der Katholizität wird – der Wesensbestimmung der Kirche durch das Zweite Vatikanum analog – in einen weiteren trinitarischen Bezugsrahmen eingestellt, was einer einseitigen Christozentrik genauso wehren soll wie einer gleichermaßen verengten pneumatozentrischen Sichtweise.
In den letzten drei Kapiteln wird nach möglichen Konsequenzen für die (römisch-)katholische Kirche gefragt, die aus einem christologischen (sakramentalen) Wesensverständnis ihrer Katholizität erwachsen. Hierbei kommen die der Katholizität mitgegebenen und im Verlauf der Untersuchung immer wieder zutage getretenen heuristischen Spannungsfelder exemplarisch zur Sprache. Das sechste Kapitel untersucht die Frage, wie die (römisch-)katholische Kirche ihre Verfassung nach innen mit Leben füllen kann und muss, will sie der ihr wesentlich von Christus im Heiligen Geist her zukommenden Katholizität entsprechen. Anhand ausgewählter, zum Teil kontrovers diskutierter struktureller Fragen wird aufgezeigt, wo die (römisch-)katholische Kirche das spannungsgeladene Zueinander von allgemeinem und besonderem Priestertum bzw. von Orts- und Universalkirche noch katholischer gestalten kann, um nicht nur katholisch zu heißen, sondern es auch erkennbar und erfahrbar zu sein.
Das siebte Kapitel lenkt den Fokus auf den weiten Bereich der Ökumene. Eine Kirche, die sich von ihrem Wesen her als „umfassende[…][s] Heilssakrament“ (LG 48) versteht, kann nicht in einer Innenschau stecken bleiben, sondern muss ihren Blick notwendig weiten und sich von ihrem Außen her verstehen. Aus einem christologischen (sakramentalen) Wesensverständnis ihrer Katholizität ergibt sich zwangsläufig eine katholische Offenheit der (römisch-)katholischen Kirche auf die nichtkatholischen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften hin. Einzelne Aspekte der Katholizität sollen in ausgewählten ökumenischen Konsenspapieren aufgespürt und aus (römisch-)katholischer Warte auf ihre Relevanz für den weiteren ökumenischen Dialog hin befragt werden. Dabei wird auch die Frage zu erörtern sein, welches Modell einer möglichen Kircheneinheit aus (römisch-)katholischer Sicht in den ökumenischen Dialog eingebracht werden kann, drängt die Katholizität doch, die von Gott gewollte Communio aller Menschen mit ihm und unter sich zu verwirklichen.
Das achte Kapitel konkretisiert die notwendige katholische Offenheit der (römisch-)katholischen Kirche auf die nichtchristlichen Religionen und auf „die Welt“ hin. In dem Maße, wie sich die (römisch-)katholische Kirche als Sakrament für „die Welt“ versteht, muss sie notwendig über den ekklesialen Tellerrand hinausschauen und sich zu allen Menschen gesandt wissen. Kirche weiß sich kraft ihrer Sakramentalität an ihre enge „Verbundenheit […] mit der ganzen Menschheitsfamilie“ (Überschrift von GS 1) gebunden. Es steht ihr nicht frei, ob sie sich auf die Welt beziehen möchte oder nicht, es ist ihre ureigene „katholische“ Sendung. Diese zentrifugale Ausrichtung der Kirche ist Ausdruck und zugleich Kriterium ihrer Katholizität. Anhand der Schlagwörter „Dialog“ und „Mission“ soll verdeutlicht werden, wie Kirche diese Sendung mit Leben füllen und je neu als ihr Lebenselexier begreifen kann bzw. muss: als eine Sendung, die nicht in ihrer freien Wahl steht, sondern in ihrer Sakramentalität begründet liegt.