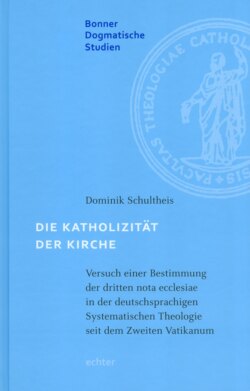Читать книгу Die Katholizität der Kirche - Dominik Schultheis - Страница 39
I. „Katholisch“ und „Katholizität“ in den
Konzilstexten
ОглавлениеEin nur flüchtiger Blick in die nachkonziliare Rezeptionsgeschichte des Zweiten Vatikanums verrät, dass „die“ Ekklesiologie des Konzils, wie sie vor allem in „Lumen Gentium“ dargelegt ist, alsbald unter dem Schlüsselbegriff „Communio“ subsumiert wurde, ist in diesem Begriff und seinem reichen Begriffsfeld doch grundgelegt, was die anderen zentralen termini technici „Volk Gottes“ und „Sakrament“ verbindet. Ziel dieser Arbeit ist es nicht, abschließend zu klären, ob der sehr vielschichtige Begriff „Communio“ als eine „ekklesiologische Kategorie neben anderen [zu] verstehen […] [ist, oder ob] sich das Communio-Wortfeld ekklesiologisch weniger als Alternativbegriff denn als Oberbegriff eignet“246. Diese Arbeit nimmt lediglich die auch vom Lehramt betriebene Diskussion um „den konziliaren communio-Gedanken als ekklesiologische Leitkategorie“247 zum Anlass, eine alternative ekklesiologische Leitkategorie in die Diskussion einzubringen, welche die entscheidenden Komponenten der Ekklesiologie des Zweiten Vatikanums gleichermaßen wesentlich betrifft und diese zu integrieren vermag: die Katholizität der Kirche.
In einem ersten analytischen Schritt soll sich den verabschiedeten Texten des Konzils gewidmet werden. Diese sollen daraufhin untersucht werden, ob und wie oft, mit welcher Bedeutung und in welchen inhaltlichen Kontexten die Begriffe „katholisch“ bzw. „Katholizität“ verwendet werden. Besondere Beachtung soll der Frage geschenkt werden, welche Intention die Konzilsväter womöglich mit der Verwendung des Begriffs „katholisch“ verfolgt haben, besonders dann, wenn er im quantitativen und qualitativen Sinne verwendet wird. Bei dieser textkritischen Betrachtung sollen, falls erforderlich, auch die vorbereitenden Schemata mit in die Untersuchung einbezogen werden, denn aus einer synchronen Rückschau ergeben sich möglicherweise Aufschlüsse über die Entwicklung des ekklesiologischen Denkens der Konzilsväter sowie Hinweise für mögliche Zusammenhänge zwischen den späteren ekklesiologischen Leitgedanken des Konzils und dem Begriff der Katholizität. Es gilt, im Folgenden herauszustellen, dass mit dem Begriff „catholicus“ in den Konzilstexten nicht nur die römisch-katholische Kirche als Denomination ins Wort gebracht ist, sondern auch die katholische Kirche im Sinne der „una, sancta, catholica et apostolica“ des Glaubensbekenntnisses, die nach dem Selbstverständnis der (römisch-)katholischen Kirche zwar in ihr subsistiert, dies aber nicht auf absolute (exklusive) Weise. Und es gilt zu klären, wo der Begriff „Katholizität“ im ursprünglich qualitativen oder quantitativen Sinne gebraucht wird.
Mit gewissen, der Interpretation bedürftigen „Unschärfen“, die Bernd Jochen Hilberath für eine textkritische Analyse der Konzilstexte grundsätzlich attestiert, muss auch bei unserer Untersuchung gerechnet werden. Denn einerseits musste sich die mit der in LG betriebenen „Ersetzung des ‚esse’ durch das ‚subsistere’ […] vorgenommene Umorientierung [im ekklesiologischen Selbstverständnis] erst durchsetzen“248, was zu nicht immer eindeutigen Formulierungen in den Konzilstexten führte. Andererseits sind in konfessionskundlicher Hinsicht unter die Bezeichnung „katholisch“ nicht nur die (römisch-)katholischen Christen zu rechnen, sondern auch die Mitglieder der mit Rom unierten „katholischen Ostkirchen“, was vor allem bei der Verwendung des Begriffs „katholisch“ im Dekret OE zu möglichen Mehrdeutigkeiten führen kann, weil nicht immer von vornherein eindeutig ist, wer mit der Bezeichnung „katholisch“ eigentlich gemeint ist. Zu bedenken wird dabei sein, dass hier und dort, wo der Begriff „catholicus“ im Sinne der Konfessionsbezeichnung „weiter“ gefasst ist, einige Konzilsväter bei ihrer Zustimmung zum abschließenden Text mehr an ihre eigene römische Kirche gedacht haben als an eine „weitere“, im ursprünglichen Wortsinne katholische Kirche, die auch diejenigen Katholiken des Ostens miteinschließt, die mit Rom verbunden sind. Dies lässt sich jedoch allein vom promulgierten Text her nicht erschließen, so dass bei etwaigen Vermutungen Vorsicht vor allzu schneller Interpretation geboten ist.
Eine systematische Durchsicht auch der Texte aus der vor-vorbereitenden Phase des Konzils (Antepreparatoria) samt der Konsultationen der Bischöfe und Institutionen sowie deren Eingaben (Vota) während der Jahre 1959 und 1960, der Texte aus der vorbereitenden Phase (Preparatoria) und der Quaestiones in den Jahren 1960 bis 1962 sowie der einzelnen Schemata, Relationes, Consilia und Vota, Animadversiones und Modi während der einzelnen Sitzungsperioden wäre hilfreich und aus textgenetischer Sicht angezeigt gewesen, da eine solch diachrone Betrachtungsweise genaueren Aufschluss darüber geben könnte, wie der Begriff „katholisch“ in den einzelnen Konzilstexten zu deuten ist und wo er unter Umständen bewusst eingefügt wurde, um bestimmte ekklesiologische Leitideen des Konzils zum Ausdruck zu bringen. Da eine derart tiefschichtige Analyse jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, soll auf sie weitgehend verzichtet werden. Allein dort, wo im Rahmen unserer Analyse eine intensivere Tiefenbohrung angezeigt ist, soll diese punktuell erfolgen.