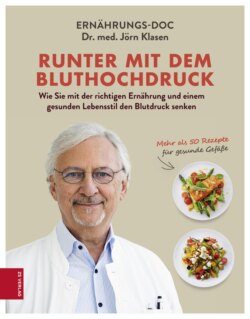Читать книгу Runter mit dem Bluthochdruck - Dr. med. Jörn Klasen - Страница 40
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDer Blutkreislauf
Unser Blutkreislauf ist ein filigranes System, das Druck und Sog genau aufeinander abstimmt, damit der ganze Körper optimal mit Blut und Sauerstoff versorgt wird. Das Herz steht im Mittelpunkt, Venen und Arterien bilden ein verzweigtes Netz.
Das Herz ist das Zentrum unseres Körpers. Es steht im Mittelpunkt eines Kreislaufs, der es ständig umströmt: dem Blutkreislauf. Die Blutgefäße transportieren das Blut vom Herzen zu Geweben und Organen und zurück. Das Blut strömt über die untere und obere Hohlvene in den rechten Vorhof des Herzens, von dort in die rechte Kammer und dann in den Lungenkreislauf. Dort kann es Sauerstoff aufnehmen und Kohlendioxid abgeben. Danach kehrt es in den linken Vorhof zurück zum Herzen und fließt von dort über die linke Kammer in die Hauptschlagader (Aorta). Die Aorta bildet nach links einen abwärtsgerichteten Bogen für den Körperkreislauf. Aus dem Aortenbogen entspringen nach oben Abgänge für den Kopfkreislauf. Bei den Blutgefäßen wird zwischen Arterien und Venen unterschieden. Die Arterien führen sauerstoffreiches Blut vom Herzen weg (sie enthalten nur im Lungenkreislauf sauerstoffarmes Blut), die Venen führen sauerstoffarmes Blut zurück. Im Gegenteil zu den Arterien werden sie nur im Lungenkreislauf von sauerstoffreichem Blut durchströmt.
In Strömung verwandelt
Die größte Arterie ist die Aorta mit einem Durchmesser von etwa drei Zentimetern. In der Peripherie verzweigt sie sich zunehmend in kleinere Arterien und dann über sogenannte Arteriolen zu den Haargefäßen (Kapillaren). Diese bilden ein feines Netzwerk in den Organen und Geweben und machen es möglich, dass zwischen Blut und Gewebe ein Stoffaustausch stattfindet. Die Wand der Arterien ist dreischichtig aufgebaut. Die mittlere Schicht enthält elastische und muskuläre Fasern – bei den großen, herznahen Arterien überwiegt der elastische Anteil. Durch die Schwingungsfähigkeit kann der ruckartige Herzschlag (die Systole) in eine kontinuierliche Strömung umgewandelt werden. Diese Fähigkeit wird Windkesselfunktion genannt. Sie bewahrt die Organe vor Blutdruckspitzen. In den herzfernen, kleineren Arterien überwiegt die glatte Muskulatur. Diese Arterien heißen auch Widerstandsgefäße, denn sie verengen ihren Durchmesser so, dass sie den Blutdruck auch an Stellen aufrechterhalten können, die weit weg vom Herzen liegen. Nur 15 bis 20 Prozent des Blutvolumens fließt in den Arterien. Etwa 7000 Liter Blut am Tag führen die Venen zum Herzen zurück. In ihnen ist der Blutdruck niedriger als in den Arterien, deshalb werden sie auch als Niederdrucksystem bezeichnet. Die Venenwände sind dünner als die der Arterien und enthalten weniger Muskeln. Dass das Blut dennoch zum Herzen fließt, liegt auch daran, dass die Venen der Füße und Beine in der Muskulatur verlaufen und durch jede Kontraktion ausgepresst werden. Die Venen haben Klappen, sodass das Blut nicht zurück, sondern immer nur in eine Richtung, zum Herzen hin, fließen kann. Wenn wir einatmen, kommt es im Brustkorb zu einem zunehmend negativen Druck. Der führt dazu, dass sich die herznahen Venen weiten und das Blut angesaugt wird. Die Venen gehören wie das rechte Herz, die Lungengefäße, die Kapillaren, der linke Vorhof und die linke Kammer in der Füllungsphase zum Niederdrucksystem. Hier ist der Blutdruck im Vergleich zum arteriellen System niedriger. In der Peripherie bei den kleinen Venen liegt er bei 12 bis 15 mmHg, vor dem rechten Vorhof nur bei 3 bis 5 mmHg. Da die Venen elastischer sind und sich etwa 200-mal besser weiten lassen als die Arterien, können sie bei niedrigem Druck viel Volumen aufnehmen. Daher werden sie auch als Kapazitätsgefäße bezeichnet. 80 bis 85 Prozent des Blutvolumens befinden sich im Niederdrucksystem.
Venen und Arterien
Den Unterschied zwischen Arterien und Venen bemerken wir beim Arztbesuch. Die Venen sind eher bläulich und verlaufen unter der Haut, sodass sie oft von außen sichtbar sind – zum Beispiel an der Innenseite der Ellenbogen. An diesen Stellen nimmt der Arzt Blut ab. Weil in den Venen kein Druck, sondern ein Sog herrscht, spritzt das Blut nicht heraus. Das würde es aber tun, wenn man in die Arterien stechen würde. Die wiederum eignen sich zum Pulsfühlen und Blutdruckmessen.
An der Peripherie offen
Der englische Arzt William Harvey hat 1628 erstmals den Blutkreislauf beschrieben. Er ging davon aus, dass es sich um ein geschlossenes System handelt. Wir wissen heute aber, dass dies nur für die roten Blutkörperchen gilt. Ansonsten ist das System an der Peripherie offen. Im Bereich der kleinsten Arterien sickert Blutflüssigkeit in das umgebende Gewebe; in der Umgebung kleinster Venen wird Gewebeflüssigkeit in das Venensystem aufgenommen beziehungsweise aufgesogen. Diese Offenheit können sich Patienten bei der Physiotherapie zunutze machen, indem sie mit äußeren Anwendungen wie Wickeln, Wechselduschen oder Bürstenmassage auf den Kreislauf einwirken. Der ehemalige Direktor der Berliner Charité, Prof. Dr. med. Paul Vogler (1899 bis 1969), hat schon früh darauf hingewiesen. Er stellte auch das Bild des Herzens als mechanische Pumpe infrage und kritisierte, dass wir „unüberlegt hinnehmen, dass der relativ kleine Herzmuskel eine Flüssigkeitsmenge von sechs bis acht Litern durch ein Röhrensystem mit stark wechselndem Volumen treiben kann“. Deshalb sah er das Herz schon damals als regulierendes Organ. Dieses Verständnis passt auch deutlich besser zur vorgeburtlichen menschlichen Embryonalentwicklung. Zuerst beginnt das Blut in der Peripherie zu strömen, dann fließt es auch Richtung Zentrum und es bilden sich Blutgefäße. Erst danach entsteht im Zentrum das Herz am Blutstrom. Das Herz ist also ein Ergebnis des Blutstroms und bildet sich an seinem Umschlagpunkt. Schon an dieser Entwicklung erkennen wir das Wechselspiel zwischen Peripherie und Zentrum.
Das Blut: der Saft des Lebens
Das Blut ist ein ganz besonderer Saft. Es ist dickflüssig, leicht klebrig und mit 38°C immer etwas wärmer als der Körper, durch den es fließt. Wie viel Blut jemand hat, hängt von seiner Größe und vom Gewicht ab. Ein mittelschwerer Mann zum Beispiel hat vier bis fünf Liter Blut im Körper, das sind 65 bis 70 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Das Blut besteht aus roten (Erythrozyten) und weißen (Leukozyten) Blutkörperchen und den Blutplättchen (Thrombozyten), die in einem wässrigen Medium, dem Blutplasma, gelöst sind. Als flüssiges Organ ist Blut immer in Bewegung und erfüllt dabei seine wichtigste Aufgabe: Es transportiert verschiedene Stoffe auf verschiedenen Wegen. Vor allem Sauerstoff muss von der Lunge zu den Geweben gebracht und als Kohlendioxid zum Ausatmen zurücktransportiert werden. Außerdem sind Nahrungsstoffe, bestimmte Metalle, Salze und Vitamine mit dem Blut unterwegs über die Pfortader in die Leber und werden von dort in die abgelegeneren Organe gebracht. Die rote Flüssigkeit sorgt auch dafür, dass Endprodukte des Stoffwechsels wie Harnstoffe, Harnsäure und Kreatinin in Nieren, Lunge, Haut und Darm gelangen.
Bis in die entferntesten Winkel
Auch für die Verteilung der Hormone ist der Saft des Lebens zuständig. Den Bluteiweißen (Plasmaproteinen) kommen dabei vielfältige Aufgaben zu: Sie sorgen dafür, dass Eiweiß als Nahrung verfügbar ist, regulieren die Flüssigkeitsverteilung zwischen den Innenräumen der Gefäße und dem umliegenden Gewebe, halten den Säuregehalt konstant, schützen vor Blutverlust, dienen als Abwehr und verteilen Wärme im gesamten Organismus. Um all diese Aufgaben zu erfüllen, muss das Blut durch den Körper strömen und auch den entferntesten Winkel erreichen. Dazu bewegt es sich in einem mehr oder weniger offenen Kreislauf. Und für diese Bewegung braucht es Druck: den Blutdruck.
Der Rhythmus: ein gesunder Taktgeber
Das griechische Wort rhythmós bedeutet „geregelte Bewegung“ – und eigentlich „das Fließen“. Rhythmus durchzieht unser ganzes Leben. Wir erleben innerhalb von 24 Stunden zahlreiche rhythmische Prozesse wie Tag und Nacht mit Schlafen und Wachsein. Wir essen und scheiden wieder aus. Der Stoffwechsel mit der Produktion und Ausschüttung von Botenstoffen reagiert entsprechend und folgt natürlichen Rhythmen. Längere, sich wiederholende Perioden erleben wir beim Wechsel der Jahreszeiten, beim Anpassen an die Umwelt, beim Wachsen in der Kindheit und Jugend, bei Heilungsprozessen und anderen Entwicklungen. Alles passiert in vorgegebenen Zeiten und in ständigen Wiederholungen: jeder Atemzug, jeder Kreislauf, jede Bewegung – und natürlich jeder Herzschlag. Alles, was dazu beiträgt, dass ein Mensch in einem Rhythmus leben kann, trägt zur Gesundheit, zum Wohlbefinden und zu einem Blutdruck im gesunden Bereich bei. Wer zu häufig gegen den natürlichen Rhythmus lebt, wird auf Dauer krank. So ist es nicht verwunderlich, dass der Hirnforscher und Psychologe Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer zur Gesundheitserziehung in der Schule zu der Erkenntnis kommt: „Wissenschaftlich gesehen, wären die wichtigsten Schulfächer: Musik, Sport, Theaterspielen, Kunst und Handarbeit.“ Denn diese Tätigkeiten fördern, dass ein Kind seinen Rhythmus finden kann. Das gilt auch für Erwachsene, wie Sie später in diesem Buch erfahren. Sportliche Aktivitäten, Musiktherapie, entspannende handwerkliche Tätigkeiten und Kreativität gehören mittlerweile zur Hypertonie-Therapie. Ordnende rhythmische Prozesse haben eine heilsame Wirkung.
Einheitlicher Quotient in der Nacht
Die beiden herausragend rhythmischen Organe sind das Herz (mit dem Kreislauf) und die Lunge. Durch den sogenannten Puls-Atem-Quotienten stehen diese beiden Organe in einem besonderen rhythmischen Verhältnis zueinander. Am Tag ist dieser Quotient bei jedem Menschen anders, abhängig davon, was er tut und wie seine Konstitution ist. In der Nacht pendelt sich das Verhältnis jedoch auf einen einheitlichen Wert ein: Während eines Atemzugs schlägt das Herz viermal. In einer Minute kommt es also zu 18 Atemzügen mit 72 Herzschlägen. Genau dieser 4:1-Quotient stellt sich immer wieder in der Nacht ein, bevorzugt zwischen Mitternacht und 3 Uhr morgens, wie der Arbeitsphysiologe Prof. Dr. med. Gunther Hildebrandt, ehemals Universität Marburg, durch Studien belegt hat. Dieses rhythmische Programm dient der Regeneration beim gesunden Menschen.
Der Blutkreislauf
Das Blut strömt über die untere und obere Hohlvene in den rechten Vorhof des Herzens, von dort in die rechte Kammer und dann über die Lungenarterien in den Lungenkreislauf. Dort kann das Blut Sauerstoff aufnehmen und Kohlendioxid abgeben. Danach kehrt es über die Lungenvenen in den linken Vorhof zurück und fließt von dort über die linke Kammer in die Hauptschlagader (Aorta). Die Aorta zweigt sich auf in einen Kreislauf für den Körper und einen Kreislauf für den Kopf, Letzterer entspringt aus dem Aortenbogen. So gliedert sich der Blutkreislauf in drei Kreisläufe: den Körper- und Kopfkreislauf sowie den Lungenkreislauf. Eine Besonderheit: Der Kopfkreislauf arbeitet relativ autonom. Das Gehirn kann zu einem Teil selbst dafür sorgen, dass der Blutdruck konstant bleibt. So können wir unser Bewusstsein, die Steuerungsfunktionen des Gehirns und die Fähigkeit zum Denken und Fühlen weitgehend unabhängig von körperlichen Vorgängen erhalten. Nur bei gefährlich hohen Blutdruckwerten (200/110 mmHg oder höher) schafft das Gehirn dies nicht mehr. Die Betroffenen sollten sofort behandelt werden.