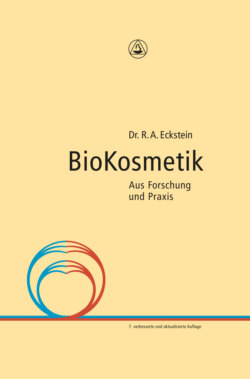Читать книгу Bio Kosmetik - Dr. R. A. Eckstein - Страница 33
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Aufgaben der Haut
ОглавлениеDie Haut ist ein weit ausgedehntes (2,0 bis 2,2 m2), vielfältiges Organ, welches im Rahmen des gesamten Organismus gesehen werden muss, da enge Verbindungen zwischen der Haut und den inneren Organen des Körpers bestehen. Im Zusammenhang mit den Körperfunktionen hat die Haut folgende Aufgaben:
Schutzorgan
Sie ist ein Schutzorgan gegen mechanische, physikalische oder chemische Einflüsse und Reize von außen: Die Hornschicht schützt vor Verletzungen durch Druck und Reibung. Ihr Fettanteil, der aus Bestandteilen des Hauttalgs und bei der Verhornung frei werdendem Hornschichtfett besteht, schirmt chemische und physikalische Reize ab. Durch die Einlagerung des Hautpigmentes in die Basalschicht und durch die reiche Ausbildung des oberflächlichen Gefäßnetzes wird ein zu starkes Eindringen von Licht und Wärme verhindert. Freie Fettsäuren und die bei der Verdunstung zurückbleibenden Bestandteile des Schweißes bilden den Säureschutzmantel der Haut (Marchionini). Die Haut besitzt peripher eine körpereigene und körperspezifische Bakterienflora, welche Fremdkeime in ihrem Wachstum zu hemmen vermag. Schutzfunktionen der Haut haben deshalb:
1 Die Hornschicht.
2 Das Pigment.
3 Das Haut- und Hornschichtfett.
4 Der Säuremantel.
5 Die hauteigene Bakterienflora.
Speicherorgan
Die Haut ist darüber hinaus ein Speicherorgan: Im Fettgewebe der Subkutis (Panniculus adiposus) kann der Mensch neben Flüssigkeit und Salzen 10 bis 15 kg Fett speichern. Dieses Fett schützt den Körper vor mechanischen und physikalischen Schädigungen und ist zugleich ein Energiedepot. Zusätzlich speichert die Haut Zucker und Kochsalz.
Wärmeregler
Als Wärmeregler zieht sich die Haut in der Kälte zusammen (Gänsehaut), dabei wird Talg ausgepresst. Beide Funktionen, Kontraktion und Einfettung, verhindern einen Verlust von Wärme. Bei einer erhöhten Wärmeeinwirkung hingegen dehnt sich die Haut aus, die Gefäße erweitern sich und die Schweißdrüsen werden tätig. Die Verdunstungskühle des Schweißes vermindert die äußere Körpertemperatur und ist ein notwendiger Ausgleich gegen die Überhitzung des Körpers.
Absonderungsorgan
Durch die Haut werden die folgenden Bestandteile abgesondert:
1 Schweiß: Man unterscheidet die Perspiratio sensibilis – eine in Form kleiner Schweißtröpfchen wahrnehmbare Ausscheidung – von der Perspiratio insensibilis, bei der ständig Wasser abgegeben wird, das sofort verdampft.
2 Talg: Der zweite Absonderungsprozess der Haut erfolgt in den Talgdrüsen. Der von ihnen gebildete Hauttalg fettet die Oberhaut ein, macht sie geschmeidig und schützt sie vor Austrocknung.
3 CO2: Außerdem scheidet die Haut ungefähr 2 bis 3 % des gesamten Kohlendioxids perkutan aus.
Aufnahmeorgan
Die Haut ist weiterhin ein Aufnahmeorgan. Hierbei muss man die Konstitution der jeweiligen Stoffe unterscheiden, die verschiedene Fähigkeiten haben, durch die Haut zu penetrieren, von der Haut aufgenommen oder auch abgewiesen zu werden. Lipidlösliche (fettlösliche) Stoffe durchdringen in Emulsionsform die Oberhaut leicht, ebenso gasförmige Substanzen. Darauf beruht die Möglichkeit, kosmetologisch Wirkungen in der Haut und im Unterhautzellgewebe hervorzurufen.
Quellung und Sauerstoff
Wasser lässt die Haut nur oberflächlich quellen. Allerdings nimmt die Haut auch etwa 1 % des gesamten Sauerstoffbedarfs des Organismus auf. Dadurch sind speziell die Zellen der Epidermis von einer Sauerstoffzufuhr über die Gefäße von innen zum kleinen Teil unabhängig.
Stoffwechselorgan
Die Haut steht in einer ständigen Stoffwechselbeziehung zu dem ganzen Körper. Ihr Stoffwechsel und ihre Reaktionslage werden daher maßgeblich vom Zustand der Haut, von der Ernährung, den enzymatischen und hormonalen Funktionen und vom vegetativen Nervensystem beeinflusst. Eine gesunde oder eine krankhafte wie beispielsweise eine atrophisch erscheinende Haut lässt somit Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand des gesamten Organismus zu.
Bildung von Antikörpern
Ausschlaggebend für die Entstehung von Allergien ist die Fähigkeit der Haut, Fremdes zu erkennen und sich daran zu erinnern. Wenn man einen sensibilisierend wirkenden Stoff, ein Allergen, auf oder in die Haut bringt, so entsteht ein Reaktionsprozess zwischen dieser Substanz und den Eiweißkörpern der Haut unter Bildung von Antikörpern (Gegen-Körpern).
Empfindungsorgan
Die Haut ist reichlich mit Nervenelementen des zentralen und autonomen Nervensystems durchzogen. Dabei werden Reize von ihren entsprechenden, das heißt auf sie abgestimmten Reizempfängern (Rezeptoren) aufgenommen. Die Reize können von außen auf die Haut treffen oder auch in der Haut selbst entstehen. Sie werden zum Hirn weitergeleitet und dort wahrgenommen. Diese Reizübermittlung vollzieht sich impulsartig in Form von elektrischen Erregungswellen. Elektrophysiologisch ist jede Erregung der Nerven eine Störung des Ruhepotenzials, welches durch die Erregungsausbreitung wieder hergestellt und aufrechterhalten wird. Natrium- und Kalium-Ionen strömen wechselseitig ein und aus, bis das elektrophysiologische Gleichgewicht wieder hergestellt ist, das vor der Erregung bestand.
Rezeptoren
Als Rezeptoren kommen in der Haut neben strukturierten Endorganen auch frei endigende Nervenfasern vor. Dabei vermitteln die freien Endigungen (nach Head und Rivers) nur Sinnesempfindungen, die einfache, primitive Wahrnehmung betreffen. Die strukturierten Rezeptoren hingegen besitzen ein höher empfindliches und besser differenzierendes Unterscheidungsvermögen für jeweils ganz bestimmte Reize (Abbildung 3).
Abbildung 3
Aufbau der Haut aus Epidermis (a), Dermis (b) und Subcutis (c) mit einer freien Nervenendigung (d), kapsulären Nervenenden wie den Meissnerschen Körperchen (e) und dem Pacinischen Körperchen (f). Der schichtweise Aufbau des Pacinischen Körperchens begünstigt die Wahrnehmung von Deformationen der Haut. Die elektonenmikroskopischen Aufnahmen I und II zeigen einen Querschnitt durch ein Meissnersches Körperchen in unterschiedlichen Vergrößerungen. Die Feinstruktur des Körperchens dient der Verbesserung der Wahrnehmung des Berührungsreizes.
Berührungsreiz
Man kann die einzelnen nervösen Strukturen der Haut entsprechend ihrer Sinnesqualitäten gliedern: Die Nervengeflechte um die Haarbalgkapseln sind taktile Rezeptoren in der behaarten Haut. Dieselbe Funktion für die Empfindung von Berührungsreizen haben die Meissnerschen Tastkörperchen und – in den oberen Schichten des Korium – die Merkelschen Körperchen oder Tastscheiben. Die Pacinischen Corpuskeln oder die Golgi-Mazzonischen Körperchen nehmen Druckempfindungen auf.
Deformation
Diese Endorgane werden gereizt, indem bei Berührung oder Druck die Haut deformiert wird. Aus diesem Grund löst ein gleichbleibender Druck flächenhafter Art keine Empfindung mehr aus. Ein Reiz wird jedoch um so stärker empfunden, je schneller die physikalische Deformation der Haut erfolgt. Das heißt, Schnelligkeit der Deformation und Reizintensität sind einander proportional. Allerdings ist die Druckempfindlichkeit in verschiedenen Hautregionen unterschiedlich. Die gleiche Berührung wird zum Beispiel am Augenlid wesentlich intensiver empfunden als an der Stirn oder am Körper.
Kälte und Wärme
Kältereize werden durch die so genannten Krauseschen Endkörperchen detektiert, während Wärmeempfindungen durch die Ruffinischen Körperchen übertragen werden. Darüber hinaus gibt es wahrscheinlich noch ganz spezielle und spezifische Thermorezeptoren. Die Thermorezeptoren der Haut sind mit der physiologischen Wärmeregulation verknüpft. Innerhalb kürzester Zeit wird der Grundumsatz veränderten Temperaturen angeglichen. Je nach Empfindung als Wärme- oder Kältezufuhr werden die Durchblutung und die Transpiration entsprechend geregelt, erhöht oder vermindert.
Schmerz
Schmerz wird sowohl von Mechanorezeptoren mit hohen Schwellenwerten (Berührung/Druck) als auch von Schmerzrezeptoren detektiert. Schmerzrezeptoren sind freie Nervenenden in Schmerzpunkten der Haut oder in inneren Organen. Sie werden durch analgetische Substanzen (z. B. Bradikinin, Histamin) aktiviert, die infolge einer Gewebsschädigung freigesetzt wurden.
Juckreiz
Das Jucken ist ein unangenehmes Hautgefühl, das von dem drängenden Bedürfnis begleitet wird, an der entsprechenden Stelle zu kratzen, um dadurch Schädlinge wie etwa Parasiten zu entfernen. Physiologisch unterscheidet man zwischen Rezeptoren des Schmerzes und des Juckreizes. Der Juckreiz ist deshalb nicht, wie man früher glaubte, eine abgeschwächte Form des Schmerzes. Beide Signale folgen unterschiedlichen Signalwegen und werden erst im Gehirn verarbeitet. Dort dominiert die Wahrnehmung des Schmerzes. Aus diesem Grund nimmt man juckende Stellen nicht mehr wahr, wenn man über die Schmerzgrenze hinaus gekratzt hat.
Haut und Nerven
Dass die Beziehungen zwischen Haut und vegetativem Nervensystem so vielseitig und intensiv sind, kann man darauf zurückführen, dass Haut und peripheres Nervensystem aus ein und demselben Keimblatt, dem Ektoderm, hervorgehen. Man hat daher stets versucht, aus der besonderen Lokalisation von Hautsymptomen auf den Zusammenhang mit neuralen Vorgängen zu schließen. So können durch Störungen von Nervenfunktionen wie etwa der Schweißdrüsen- oder Gefäßinnervation Umstimmungen der Oberflächenverhältnisse auf der Haut hervorgerufen werden, beispielsweise übermäßige Quellung, Feuchtigkeitsmangel, Hyperhidrosis oder Hyperämie. Ein weiteres Beispiel für die Beziehungen zwischen Haut und Nervensystem ist das schmetterlingsförmige Auftreten vasomotorischer Dauerrötungen, von Teleangiektasien und Rosacea (nach Blaich und Engelhardt).