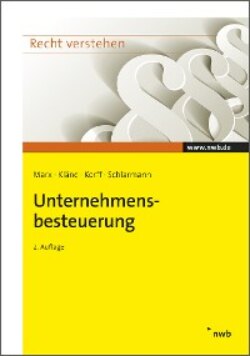Читать книгу Unternehmensbesteuerung - Franz Jürgen Marx - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.3.6 Besteuerungsverfahren, Rechtsquellen und Rechtsanwendung 2.3.6.1 Besteuerungsverfahren
ОглавлениеWie der Blick auf die Besteuerungsgrundsätze gezeigt hat, sind die Analyse und das Ausschöpfen von Gestaltungsmöglichkeiten im Bereich des Steuerverfahrens für die Betriebswirtschaftliche Steuerlehre von Bedeutung. Der Einsatz des Instrumentariums hängt vom jeweils erreichten Verfahrensabschnitt ab. Wir können fünf Verfahrensschritte unterscheiden, die allerdings nicht alle absolviert werden müssen.
ABB. 2.8: Besteuerungsverfahren in Stichworten Quelle: Haberstock/Breithecker (2013), S. 44 (geändert).
Dem Ermittlungsverfahren folgt das Festsetzungsverfahren und das Erhebungsverfahren. Das Rechtsbehelfsverfahren und das Straf- und Bußgeldverfahren sind Verfahrensschritte, die wie das Vollstreckungsverfahren nur in besonderen Fällen in Betracht kommen.
Im Ermittlungsverfahren geht es um die Gestaltung der nicht marktmäßigen Austauschbeziehung zwischen Steuerpflichtigen und Finanzverwaltung. Die Besteuerungsgrundlagen sind von Amts wegen (§ 88 AO, sog. Offizialmaxime) zu ermitteln. Die Finanzbehörde hat alle für den Einzelfall bedeutsamen Umstände zu berücksichtigen. Allerdings ist Informationserlangung nicht kostenlos. Das Besteuerungsverfahren ist ein Massenverfahren. Jedes Jahr gehen den Finanzbehörden rd. 38 Mio. Steuererklärungen für Einkommen-, Körperschaft-, Umsatz- und Gewerbesteuer zu. Im Rahmen der Konzeption von Besteuerungsverfahren gilt es dabei abzuwägen zwischen den Kosten der Informationsbeschaffung auf der einen Seite und der Informationsquantität und -qualität i. S. einer möglichst vollständigen und zutreffenden Erfassung der Besteuerungsbasis. Das eine Extrem ist dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerpflichtigen umfassende Ermittlungspflichten haben und die Finanzverwaltung sich beschränkt auf die Verarbeitung dieser Informationen. Der andere Pol besteht in der vollständig eigenen Ermittlungstätigkeit der Finanzverwaltung. Keine dieser beiden Endpunkte ist in der Realität vorzufinden. Dies liegt zum einen an der Gefahr der Steuerverkürzung, zum anderen an den zu hohen administrativen Aufwendungen. Derzeit gibt es daher einen Mittelweg. Allerdings hat der Steuerpflichtige mitzuwirken durch Steuererklärungen, Auskunftspflichten, Buchführungs- und Dokumentationspflichten. Bei verschiedenen Steuerarten entwickeln sich Selbstveranlagungsverfahren, bei denen der Steuerpflichtige nicht nur die Bemessungsgrundlagen erklären, sondern die Steuer auch selbst ermitteln muss. Das ist bei der Umsatzsteuer bereits seit langem etabliert. Bald soll die Körperschaftsteuer folgen. Für die Einkommensteuer wird die sog. Vorausgefüllte Steuererklärung (VaSt) für den Steuerpflichtigen oder dessen Steuerberater elektronisch abrufbar sein, die von der Finanzverwaltung gespeicherte Daten, z. B. die vom Arbeitgeber übermittelten Lohnsteuerdaten oder Bescheinigungen über den Bezug von Rentenleistungen, enthält. Unternehmen müssen inzwischen Bilanz- und GuV-Daten („E-Bilanz“) nach § 5b EStG an die Finanzbehörde elektronisch übermitteln.
Die Steuerbehörde kann über besondere Ermittlungsverfahren (Außenprüfung, Steuerfahndung, Steueraufsicht und Schätzung) zusätzliche Maßnahmen ergreifen. In diesem Verfahren darf die Finanzverwaltung nach § 147 Abs. 6 AO auf die elektronisch gespeicherten Daten des geprüften Unternehmens direkt zugreifen, die IT-Systeme nutzen und die Daten auswerten. Der Steuerpflichtige hat sie dabei tatkräftig (unentgeltlich) zu unterstützen. Hier ist die Außenprüfung ein spezielles Verwaltungsverfahren zur Erfüllung der in § 85 AO gesetzten Aufgabe, die Steuern nach Maßgabe der Gesetze gleichmäßig festzusetzen und zu erheben.
Das Festsetzungsverfahren dient der konkreten Festsetzung der Steuerschuld, die sich aus dem Steuerbescheid ergibt. Gegebenenfalls ist alternativ in einem mehrstufigen Verfahren ein Feststellungsbescheid über die Besteuerungsgrundlagen bekanntzugeben, der dann die Grundlage für Steuerfestsetzungen bildet. So wird der Gewinn einer OHG nach §§ 179, 180 Abs. 1 Nr. 2 AO einheitlich und gesondert festgestellt und die Besteuerungsgrundlagen (Gewinnanteile der Gesellschafter) an die jeweiligen Wohnsitzfinanzämter der Gesellschafter übermittelt, die dann die ESt festsetzen.
Wird der Steuerfall nicht abschließend geprüft, kann der Steuerbescheid unter den Vorbehalt der Nachprüfung gestellt werden (§ 164 AO). Damit bleibt der gesamte Steuerfall offen für spätere Änderungen aufgrund von Angaben des Steuerpflichtigen oder infolge weiterer Überprüfungen durch die Finanzverwaltung (z. B. Außenprüfung). Nach § 165 Abs. 1 Satz 1 AO kann die Steuer vorläufig festgesetzt werden, soweit ungewiss ist, ob die Voraussetzungen für ihre Entstehung eingetreten sind. Neben ungewissen Tatsachen sind zu erwartende Doppelbesteuerungsabkommen, Verpflichtungen zu einer gesetzlichen Neuregelung und anhängige Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof, dem Bundesverfassungsgericht oder den obersten Gerichtshöfen des Bundes vom Gesetz als Vorläufigkeitsgründe genannt. Die Norm ermöglicht der Finanzbehörde eine zeitgerechte Steuerfestsetzung in den Fällen, in denen über einzelne Punkte eine objektive, nicht behebbare Ungewissheit besteht. Darin unterscheidet sich die vorläufige Steuerfestsetzung von der Vorbehaltsfestsetzung nach § 164 AO. Der Vorläufigkeitsvermerk des § 165 AO betrifft im Übrigen nur den im Bescheid festzulegenden Umfang und nicht die gesamte Festsetzung. Angesichts der hohen Änderungsgeschwindigkeit des Steuerrechts und der Vielzahl abhängiger Gerichtsverfahren hat die Norm eine große Bedeutung im Besteuerungsverfahren. Festsetzungen der Einkommensteuer werden aufgrund anhängiger Musterverfahren derzeit automatisiert mit einem Vorläufigkeitsvermerk belegt.
Im Steuerbescheid sind Umfang und Grund der Vorläufigkeit erkennbar anzugeben, damit dem Rechtschutzinteresse des Steuerpflichtigen entsprochen wird. Er soll wissen, welche Umstände der endgültigen Festsetzung entgegenstehen und hinsichtlich welcher als ungewiss betrachteten Tatsachen sich die Finanzbehörde eine weitere Überprüfung vorbehält. Die Reichweite der Vorläufigkeit muss daher grundsätzlich dem Bescheid entnommen werden können. Enthält der Steuerbescheid zum Umfang der Vorläufigkeit hingegen keinerlei Angaben und ergibt sich dieser Umfang auch nicht aus anderen Umständen, so ist der Vermerk inhaltlich nicht hinreichend bestimmt und deshalb mit der Folge unwirksam, dass er nicht zur Aufhebung oder Änderung des Steuerbescheids berechtigt.
Das Erhebungs- und Vollstreckungsverfahren dient der Realisierung der Steuern. Steueransprüche erlöschen gem. § 47 AO durch Zahlung, Aufrechnung, Erlass und Verjährung (Zahlungsverjährung). Die Finanzverwaltung kann Steueransprüche stunden, wenn deren Einziehung eine erhebliche Härte für den Steuerschuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet erscheint (§ 222 AO). Regelmäßig werden hierfür Stundungszinsen i. H. von 0,5 % pro Monat berechnet; nur ausnahmsweise wird zinslos gestundet. Die Vollziehung eines mit Rechtsmitteln angefochtenen Steuerbescheides soll von der Finanzverwaltung ausgesetzt werden, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Verwaltungsaktes bestehen oder die Vollziehung eine unbillige Härte für den Betroffenen zur Folge hätte (§ 361 AO, § 69 FGO). Wird die Steuer bei Fälligkeit nicht entrichtet, ist für jeden angefangenen Monat ein Säumniszuschlag von 1 % zu berechnen (§ 240 AO).
Das Rechtsbehelfsverfahren dient dem Rechtsschutz des Steuerpflichtigen. Es ist zunächst ein außergerichtliches Vorverfahren in Form des Einspruchs zu absolvieren. Dann folgt ggf. ein gerichtliches Rechtsbehelfsverfahren durch Klage beim Finanzgericht. Revision und Beschwerde an den Bundesfinanzhof sind die weiteren möglichen Schritte. In diesen Verfahren sind stets genaue Fristen zu beachten. Ebenso ist der fehlende Suspensiveffekt zu berücksichtigen, der allerdings durch die o. g. Aussetzung der Vollziehung erreicht werden kann. Das Straf- und Bußgeldverfahren dient der Ahndung von Pflichtverletzungen der Steuerpflichtigen. Hier sind Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten mit verschiedenartigen Sanktionen belegt. Eine Besonderheit stellt die strafbefreiende Selbstanzeige (§ 371 AO) dar.
Die Statistik über die Einspruchsbearbeitung in den Finanzbehörden seit 2005 zeigt die große Bedeutung des Rechtsbehelfsverfahrens.
ABB. 2.9: Statistik über die Einspruchsbearbeitung in den Finanzämtern von 2005–2012 Quelle: BMF, Veröffentlichungen von 2006 bis 2013.
„Masseneinsprüche“, die wegen angeblicher Verfassungswidrigkeit von Rechtsnormen eingelegt wurden, sind in der Statistik nur teilweise enthalten.
Aus der Abhilfe kann nicht „automatisch“ geschlossen werden, dass der angefochtene Bescheid fehlerhaft war. Vielfach werden im Einspruchsverfahren Steuererklärungen ergänzt und steuermindernde Belege nachgereicht.
Ferner kann auch keine Aussage zum Anteil der von den Steuerbürgern angefochtenen Verwaltungsakte getroffen werden. Hierfür müsste die Zahl der jährlich erlassenen Verwaltungsakte bekannt sein. Daten hierzu liegen dem BMF nicht vor, zumal mit dem Einspruch nicht nur Steuerbescheide angefochten werden können, sondern auch sonstige von den Finanzbehörden erlassene Verwaltungsakte, wie z. B. die Anordnung einer Außenprüfung, die Ablehnung einer Stundung oder eines Steuererlasses.