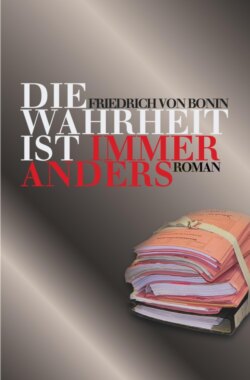Читать книгу Die Wahrheit ist immer anders - Friedrich von Bonin - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление5.
Ich saß in meinem Arbeitszimmer und hatte die Anklageschrift immer noch nicht gelesen. Stattdessen erinnerte ich mich, wie ich Hanna meinen Eltern vorstellte. Ich hatte darauf bestanden, dass sie sich kennen lernten und so waren wir nach Königsfeld gefahren, wo wir mittags ankamen. Mein Vater war noch nicht zu Hause, so dass es meine Mutter war, die uns in der großen Villa in der Küche empfing.
Meine Mutter ist Sybille Eschenburg, geborene Arndt. Ich habe in meinem Elternhaus meinen Vater Richard als strenge Autorität wahrgenommen, meinen Großvater als liebevoll, während meine Mutter in unserer Familie eine sehr untergeordnete Rolle spielte. Sie hatte nichts zu bestimmen, wenn mein Vater da war, sie versuchte es auch nie. Klein, unscheinbar, stammt sie aus einer Beamtenfamilie in Königsfeld. Meine Eltern haben sich in der Universität kennen gelernt, weil auch meine Mutter Jura studierte. Sie hat das Studium aber abgebrochen, als sie meinen Vater heiratete.
Meine Mutter empfing Hanna in ihrer stillen Art, nicht feindselig, aber auch nicht so, als freute sie sich, die Freundin ihres Sohnes kennen zu lernen. Mühsam hielt ich ein Gespräch in Gang, bis sie Kaffee und Kuchen servierte und etwas auftaute, als Hanna sie nach dem Rezept fragte. Dann kam mein Vater, groß, aufrecht, laut, er sah Hanna und bewunderte lärmend ihre Schönheit, nicht merkend, wie er meine Mutter verletzte und Hanna in eine peinliche Situation brachte. An diesem Tage fuhren wir beide, Hanna und ich, bedrückt zurück in unsere Universität. Unserer Liebe aber tat das schwierige Verhältnis zu meinen Eltern keinen Abbruch. Nach vier Wochen, als wir uns von diesem Besuch in Königsfeld einigermaßen erholt hatten, besuchten wir auch ihre Eltern, ein freundliches älteres Ehepaar, einsam, zwei Menschen, die sich freuten, dass wir kamen und uns freundlich aufnahmen. Zu ihnen hatten wir Zeit ihres Lebens ein herzlicheres Verhältnis.
Wir setzten unsere Studien fort, sie las weiter die deutschen Klassiker und ich plagte mich mit dem Eigentümer-Besitzer-Verhältnis des BGB herum. Allerdings beschlossen wir nach kurzer Zeit, unsere einzelnen Wohnungen aufzugeben und in eine gemeinsame Wohnung zu ziehen. Bis heute liebe ich Hanna, obwohl wir schon so lange ein Paar sind. Nicht ganz unangefochten ist meine Liebe, ich denke vor allem an eine sehr attraktive jüngere Frau, die sich in meinem Büro vor fünf Jahren bewarb, im Vorstellungsgespräch anregend mit mir flirtete und damit in mir angenehme Phantasien von einem kleinen Seitensprung weckte, die ich aber nie zu verwirklichen mich entschließen konnte. Zu tief fühlte ich mich Hanna verbunden, als dass ich meine Beziehung zu ihr mit einer kleinen Affäre hätte gefährden wollen.
Hanna, wie sie mich fragend und erwartungsvoll angesehen hatte, als ich vorhin nach Hause kam und wie ich sie enttäuscht hatte. Ich konnte ihr nichts sagen, ich kannte nicht einmal die Anklageschrift. Natürlich hatte ich ihr erzählt, dass man mich der Korruption beschuldigte, ich hatte ihr das aber immer in einem leichten Plauderton, als gelte es den alltäglichen Ärger, erzählt, nicht als ernsthaftes Problem, das nicht nur mich, auch meine Familie und unsere Situation gefährden konnte. Und nun musste ich ihr vorgestern sagen, der Anwalt, den ich beauftragt hatte, habe eine Anklageschrift bekommen. Ich war also nun angeklagt! Und nun nahm ich sie zur Hand:
„Franz Eschenburg, geboren am 30. September 1959, nicht bestraft, wird angeklagt, 1. einem Amtsträger eine Gegenleistung dafür angeboten zu haben, dass er eine Diensthandlung vornimmt, und dadurch seine Dienstpflichten verletzt, indem er. . .“ Weiter konnte ich nicht lesen. Wie lange war es her, dass ich mich mit diesem Juristenkauderwelsch hatte beschäftigen müssen? Und schon gar mit dem entsetzlichen Deutsch, das die Staatsanwälte zu schreiben gezwungen waren, weil es ihren Dienstpflichten entsprach? Schon ewig.
Und doch, so sehr es mich graute, ich musste mich natürlich damit auseinandersetzen. Ich würde in nächster Zeit ständig mit diesen Juristen zu tun bekommen, die mich beschuldigen und verurteilen wollten.
Bestochen sollte ich haben, Vorteile gekauft haben, nicht von einzelnen Amtsträgern, sondern im großen Stil, und nicht von subalternen Beamten, sondern Politiker bis in die höchsten Kreise sollte ich bestochen haben, ich, Franz Eschenburg, aus guter, traditionsreicher Familie, aus einer wohlhabenden Familie. Hatte ich das nötig? Aber, wie mein Anwalt mir versichert hat, war das kein Argument.
„Sie würden sich wundern“, hatte Dr. Dragon in seiner aufreizenden Langsamkeit gesagt, „wer alles Straftaten begeht, die er keinesfalls nötig hat.“
Aber meine Familie? Mein Vater, der Oberstaatsanwalt, der lange pensioniert war, über achtzig Jahre alt, mit seiner untadeligen Laufbahn und seinem beanstandungsfreien Leben. Mein Großvater musste, dem Himmel sei Dank, nicht mehr erfahren, welche Vorwürfe man gegen seinen Enkel erhob, seinen Enkel, der nie auch nur schwarz mit dem Zug zu fahren sich getraut hatte.
Ich erinnerte mich genau, Hanna und ich hatten lange nicht über ihre Aktion bei Karstadt gesprochen, obwohl es mich manchmal gedrängt hatte. Aber irgendwann, wir wohnten schon in einer gemeinsamen Wohnung und studierten noch, kamen wir aus dem Reformhaus.
„Sieh mal, Franz, was ich hier habe“, lachte sie triumphierend und zog aus ihrer Manteltasche ein Fläschchen mit Duftöl.
„Wo hast du das denn her?“, fragte ich neugierig.
„Gerade im Reformhaus, habe ich mitgehen lassen.“
„Mitgehen lassen? Du meinst geklaut?“ Ich war entgeistert, „du hast wirklich das Fläschchen geklaut? Und wenn du erwischt worden wärst, was wäre dann gewesen?“
„Was hätte sein sollen? Die hätten uns rausgeschmissen, aber Franz, keine Angst, ich werde nicht erwischt.“
Das war der erste größere Streit, den wir miteinander hatten. Ich fragte sie erbost, ob sie denn nicht meinte, wir hätten uns das Fläschchen doch ohne weiteres leisten können. Darum gehe es nicht, hielt sie dagegen, nun auch zornig, weil ich sie nicht verstand, sie liebe dieses prickelnde Gefühl, etwas Verbotenes tun zu können. Langsam beruhigten wir uns, die Meinungsverschiedenheit war aber nicht beendet. Sie flammte neu auf, als wir das nächste Mal von einem Besuch bei ihren Eltern in Königsfeld auf dem Hauptbahnhof ankamen und in die Straßenbahn stiegen. Natürlich wollte ich vorher eine Fahrkarte bei dem Fahrer lösen, aber sie zog mich zu dem hinteren Eingang des Zuges.
„Das Geld können wir sparen“, flüsterte sie mir zu, „es sind doch nur drei Stationen.“ Dieses Mal, was blieb mir übrig, stieg ich mit ihr ein, aber die drei Stationen waren die längste Fahrt mit der Bahn, die ich je gemacht habe. Jeden, der einstieg, betrachtete ich ängstlich, ob er vielleicht ein Kontrolleur sein könnte. Welche Schande, ich würde erwischt werden. Aber es kam kein Kontrolleur und wieder triumphierte sie.
„Siehst du? Drei Mark gespart, davon können wir uns was Anderes kaufen“, lächelte sie mich an.
„Ja, wenn du es nicht vorher klaust“, murrte ich zurück.