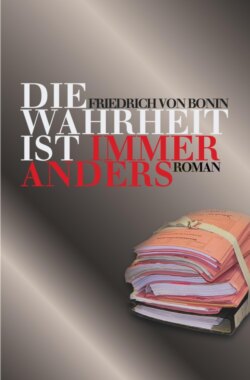Читать книгу Die Wahrheit ist immer anders - Friedrich von Bonin - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеII.
1.
Langsam ging Eduard Eschenburg durch den Sommerwald. Er hatte seine kleine Schwester Kathrin an der Hand, sie war zehn Jahre jünger als er. Eduard trug einen leeren Sack auf dem Rücken, der hoffentlich bei ihrer Rückkehr prall gefüllt sein würde. Vögel zwitscherten durch das grüne Laub des Mischwaldes, als gäbe es keine Menschen, keine jagenden Tiere und keinen Krieg.
Im Winter war er nach Königsfeld zurückgekehrt, zwei Monate nach der Kapitulation. Er war zu Fuß gegangen, den weiten Weg von der französischen Grenze, wo ihn die Nachricht von der Aufgabe der deutschen Truppen und der Flucht des Kaisers erreicht hatte. Er hatte sich durchschlagen müssen in seiner zerfetzten Uniform, dem grauen, strapazierten Wintermantel darüber, mit Stiefeln, deren Sohlen abgelaufen waren. Strümpfe hatte er nicht mehr gehabt, er hatte ein Unterhemd zerrissen und sich um die Füße gewickelt und war dann immer Richtung Königsfeld gelaufen, seiner Heimat, unruhig, was er zu Hause vorfinden werde, er hatte seit Monaten keine Nachricht gehabt. Ernährt hatte er sich von dem, was er auf den Feldern gefunden hatte, altes gefrorenes Kartoffellaub, einmal hatte er ein krankes Kaninchen erwischt, es gefangen, getötet und an einem improvisierten Feuer gebraten. Zweimal war er in kleine Dörfer gegangen, wenn der Hunger ihn getrieben hatte, und hatte um Essen gebettelt, auch welches erhalten. Seine Achselstücke an der Uniform, die seinen Dienstgrad als Major verrieten, hatte er vorher abgerissen, damit sie ihn nicht abwiesen.
Mit Begeisterung war er als achtzehnjähriger Fähnrich der Infanterie in den Krieg gezogen, als einjährig Freiwilliger, um die Chance zu haben, zum Offizier befördert zu werden. Mit seiner Schulbildung, er hatte das Gymnasium mit dem Abitur abgeschlossen, war ihm die Offizierslaufbahn vorgegeben. Sie waren nach Westen gezogen, Richtung Frankreich, aber nicht auf dem direkten Weg.
„Meine Herren“, hatte ihr Bataillonskommandeur, General von Halpern, vor dem versammelten Bataillon gesagt, „wir werden nicht über Elsass-Lothringen marschieren, wir werden die Franzosen, wie Schlieffen das geplant hat, von Belgien aus überrennen und bis nach Paris marschieren. Sie haben ihre Städte befestigt, aber sie rechnen nicht damit, dass wir von Norden kommen. Bevor die Russen sich sammeln können, haben wir Frankreich besiegt und werden uns nach Osten wenden.“
Und begeistert hatten sie Beifall geschrien, auch er, und waren losmarschiert, erst zu Fuß, dann in Eisenbahnwaggons eingepfercht, und dann wieder zu Fuß, immer singend.
Der Gesang war brutal unterbrochen worden, als sie die erste Berührung mit dem Feind hatten, sie waren beschossen worden, hatten sich formiert, angegriffen.
Eduards Gedankenflug stoppte abrupt. Eine Sperre in seinem Gehirn hinderte ihn, an diesen ersten Angriff zu denken, weil er sich dann an den ersten Menschen hätte erinnern müssen, den er getötet hatte. Mit Gewalt konzentrierte er sich auf die Hand seiner Schwester neben ihm, auf den Gesang der Vögel, auf das frische Laub an den Bäumen, das später zu einem dunkleren Grün wechseln würde, jetzt aber eine helle, frische Farbe zeigte, die den Beginn von Leben anzeigte, Hoffnung auf ein besseres Leben, in dem es dieses Töten nicht mehr gab.
„Wohin gehen wir?“ fragte ihn Kathrin und holte ihn in die Gegenwart zurück.
„Wir wollen sehen, ob wir auf den Feldern hinter diesem Wald nicht ein bisschen Gemüse ernten können, damit wir heute Abend und morgen etwas zu essen haben“, antwortete er, „sieh mal, wenn dieser Sack halb voll ist, gehen wir zurück, dann haben wir sogar auch für übermorgen zu essen. Aber“, schärfte er ihr zum zehnten Male ein, „wenn wir erwischt werden, wenn der Bauer kommt, dann achtest du nicht auf mich, dann läufst du weg, so schnell du kannst, nach Hause, hast du das verstanden?“
Sie lachte ihn an: „Eduard, ich habe das schon beim ersten Mal verstanden, du brauchst es mir nicht dauernd neu zu sagen, sei ganz ruhig, ich kann sehr schnell laufen.“
Kathrin war für ihre dreizehn Jahre weit entwickelt, war dünn, schlaksig und sehr sportlich. Wenn sie zum Spaß um die Wette liefen, kam sie auf ihren spindeldürren Beinen fast so schnell voran wie er. Sie hatte gelernt, auf sich selbst aufzupassen. Und wieder verdunkelte sich Eduards Stirn.
Ende Januar war er nach Hause gekommen in die Villa, wie sie das Haus nannten, das sein Vater gebaut hatte. Der hatte seit der Jahrhundertwende ein florierendes Bauunternehmen geführt und sich ein Haus am Rande Königsfelds errichten lassen, eben die Villa. Am Anfang war die Familie in dem vornehmen Viertel nicht sehr wohl gelitten gewesen, „diese neureichen Eschenburgs“, so hatte man sie genannt, sich aber dann mit der Zeit an sie gewöhnt. Ihn, Eduard, hatte der Vater auf das Gymnasium geschickt, damit er nicht als Bauunternehmer sein Brot verdienen musste, sondern „etwas Gescheites lernte“, wie er sagte. Dennoch, Eduard konnte seine Hände gebrauchen, er konnte mauern, putzen, er hätte ein Haus bauen können, meinte er. Er war in die Villa zurückgekommen und hatte seine Schwester Kathrin mit einer älteren Frau angetroffen, mit aufgequollenem Gesicht, schwärzlich von dem Staub der Ruinen der Stadt, weinend, immer weinend, in den Armen der älteren Frau, die sich als ihr früheres Kindermädchen herausstellte. Eduard hätte sie nicht wiedererkannt, schlohweiß ihre Haare, zerknittert ihr Gesicht. Bei Kriegsanfang war sie vielleicht vierundzwanzig Jahre alt gewesen.
„Deine Eltern sind beide tot, Eduard“, schluchzte Annie, jetzt erinnerte er sich an den Namen, „sie sind in der Stadt gewesen, als die Flieger kamen und Bomben abwarfen, sie sind in dem Feuer verbrannt, warum mussten sie auch in die Stadt gehen.“ Annie und Kathrin weinten herzzerreißend, er nahm beide in den Arm und tröstete sie, darüber seinen eigenen Schmerz für eine Weile vergessend.
Seine Eltern waren nicht die einzigen, die in diesem verheerenden Krieg umgekommen waren, so begriff er allmählich, Königsfeld hatte wohl die Hälfte seiner Einwohner verloren, sei es als Krieger an der Front, sei es bei Angriffen auf die Stadt. Eduard Eschenburg konnte sich nicht lange mit der Trauer aufhalten, Kathrin und Annie hatten seit drei Tagen nichts zu essen, sie froren erbärmlich in ihren dünnen Sachen und hatten nur überlebt, weil sie sich im Schlaf aneinandergedrückt hatten. Kathrin hatte versucht, im Wald Brennholz zu finden, damit sie wenigstens ein Feuer machen konnten, sie hatte versucht, alte Beeren aus dem letzten Herbst oder Pilze zu finden, aber vergebens, es waren immer schon andere vor ihnen da gewesen.
Eduard selbst hatte ebenfalls lange nichts essen können, je näher er der Stadt kam, desto weniger Reste lagen auf den Feldern.
Am Abend saßen sie in dem kleinsten Raum des großen Hauses, jeder hatte eine Decke um sich geschlungen, sie drängten sich aneinander und redeten.
„Ich weiß nicht, was werden soll“, sagte Annie, „ich kann nicht mehr lange so weitermachen, mir ist kalt und ich bin hungrig.“
Kathrin fing an zu weinen, „ich auch“, schluchzte sie. Eduard nahm sie beide in den Arm.
„Wartet nur ein bisschen, es muss erst richtig dunkel werden, dann gehe ich los und ihr werdet sehen, ich komme mit Essen zurück.“
„Aber wenn sie dich erwischen“, Kathrin weinte noch lauter, „dann bin ich wieder allein, ich will, dass Mama und Papa zurückkommen.“
„Sie kommen nicht zurück, Kathrin“, antwortete Eduard, seine Schwester fester an sich drückend, „wir beide müssen mit Annie sehen, wie wir uns alleine durchschlagen.“
Eduard hatte eine Vorstellung, was er gegen den Hunger und die Kälte tun könnte: Stehlen. Er hatte sich vorgenommen, die Nachbarhäuser im Viertel zu beobachten, wo Licht brannte und wo deshalb Menschen wohnten. In ein dunkles Haus wollte er einsteigen und sehen, ob er dort Essbares und Brennmaterial fand. Irgendwas würde er schon finden, da war er sich sicher, zumal er völlig unbedenklich war, wenn es galt, Essbares von Ungenießbarem zu unterscheiden.
Zwei Stunden später war es soweit: Eduard brach auf, nur mit einem alten Kartoffelsack und einem Stück Draht und schlich durch die Straßen. Wie war dieses Viertel entvölkert, nur in wenigen Häusern brannte Licht, die meisten lagen in tiefem Dunkel. Eduard erinnerte sich an die Villa eines reichen Fabrikanten in einer Seitenstraße, vor der er jetzt stand und sich hinter die Hecke duckte. Sie war ohne Licht, schwarz und schweigend lag sie vor ihm. Er schlich langsam zu der Haustür und holte den Draht aus der Tasche, bog ihn, steckte ihn ins Schloss, und drehte. Die Tür öffnete sich. Leise betrat er das Haus und verhielt hinter dem Eingang, um seine Augen an die Dunkelheit zu gewöhnen. Dann suchte er die Küche, fand sie. In der Dunkelheit ertastete er die Speisekammer und sein Herz hüpfte: Einmachgläser sah er im Schein eines Streichholzes, das er entzündet hatte, mit Marmelade, eingemachtem Gemüse und hier, Fleisch. Die Menschen hatten wohl vergessen, die Vorräte mitzunehmen, als sie flüchteten. Eduard packte in den Sack, so viel er tragen konnte und wollte schleichend das Haus verlassen, als er erstarrte. Ganz leicht hatte sich die Tür zur Küche bewegt, leise geknarrt. Eduard wusste, es konnte kein Windzug gewesen sein, im Hause war es totenstill, kein Lüftchen, das die Tür hätte bewegen können, regte sich. Er versuchte mit den Augen die Finsternis zu durchdringen. Da, wieder knarrte die Tür. Eduard fühlte, wie sich ihm die Haare im Nacken sträubten. Wenn das ein Mensch war, wo war er? Und hatte er Eduard gesehen oder gefühlt? Reglos stand er da, Sekunden, Minuten, und hörte und sah nichts. Langsam bewegte er sich auf die Tür zu und wollte sie öffnen, da, fast wäre ihm das Herz stehen geblieben, huschte ein Schatten an ihm vorbei in die Küche und zurück in den Flur, und maunzte protestierend: Eine Katze. Eduard lachte laut vor Erleichterung, nahm seinen Sack auf die Schulter und fast leichtsinnig verließ er das Haus ganz offen.
Zu Hause servierte er Kathrin und Annie das Festmahl. Unterwegs hatte er ein bisschen Splitterholz gefunden, es aufgesammelt und mitgebracht, und so aßen sie beim Schein des kurzlebigen Herdfeuers, das nicht wärmte, aber etwas Licht brachte. Nach dem Essen schliefen sie, eng aneinandergedrückt wegen der Kälte, ein.
Eduard Eschenburg wachte auf, weil er schluchzte. Er hatte geträumt, wieder von dem Gesicht des Mannes, den er erschossen hatte, hatte ihn wieder fallen sehen. Er unterdrückte das Schluchzen und weinte lautlos. Wie weit war es mit ihm gekommen, ihm, den sein Vater erzogen hatte zu Redlichkeit und Anständigkeit. Er hatte getötet, verletzt, mit Lust sogar, und jetzt hatte er gestohlen, wie sollte jemals aus ihm ein anständiger Mann werden? Hoffnungslosigkeit überkam ihn und er spürte, wie sein Herz sich zusammenzog und die Tränen hemmungslos über sein Gesicht rollten. Lange, lange lag er wach und schämte sich dessen, was aus ihm geworden war.
Am nächsten Morgen war die Scham verschwunden. Eine dicke Schneedecke hatte sich über das Land gelegt, der Garten, auf den Eduard nach dem Aufwachen blickte, war eine weiße Wüste, kalt, bestehend aus Schnee, wunderschön, gleichmäßig, rein, aber kalt und lebensfeindlich. Eisblumen hatten sich an den Fenstern gebildet, und nun, wie Eduard hinaussah, erhob sich der erste Wirbel dieses Schnees mit dem beginnenden Wind, der sich sehr schnell zu einem Sturm auswuchs und um das Haus heulte. Sie saßen, Kathrin, Anni und Eduard, eng um den Herd, den sie mit den spärlichen Holzteilen geheizt hatten, die Eduard gefunden hatte und lauschten dem Heulen da draußen.
„Es hat noch mehr zu schneien angefangen“, sagte Anni, die aufgestanden war und aus dem Fenster sah. Schon bildeten sich in dem wirbelnden Unwetter draußen im Garten die ersten Berge aus Schnee, in verwinkelten und bizarren Formen, von dem Sturm hingeworfen und sofort wieder zerstört. Kaum konnten sie den Garten sehen, die Luft war voll von den dicken Flocken, die vom heulenden Wind an das Haus geweht wurden. Sie kehrten zurück zum Herd und fühlten sich geborgen in seiner warmen Gegenwart, aber unsicher, wenn sie an die Zukunft dachten.
Vier Tage hatte der Sturm gewütet, erinnerte sich Eduard, und zwei Wochen danach die Kälte. In dieser Periode war kein Raum für Scham und Gewissensbisse. Froh war er gewesen, dass er Vorräte gestohlen hatte, sie hätten sonst die Kälte nur schwer überlebt.
Wohlig spürte Eduard die Wärme der Sonne auf seinem Rücken, wie sie jetzt auf den Wald zugingen, er wollte nicht an Krieg denken, nicht an Töten und Stehlen, er sah die Sonne, hörte die Vögel und fühlte die Hand seiner Schwester in der seinen. Sie waren zusammen, es war warm und zu essen würde er heute Nachmittag auch finden. Schon oft waren sie in diesem Sommer unterwegs gewesen, und hatten immer etwas entdeckt. Heute hatte er sich aber etwas Besonderes ausgedacht. Er wollte mit seiner Schwester zusammen Kartoffeln von den Feldern holen, Rüben und was sie sonst noch fanden. Diesmal brauchte er etwas mehr, als sie essen wollten. Anni hatte gefragt, warum er nicht auf dem Grundstück der Villa Kartoffeln pflanzen konnte, Rüben und alles Gemüse, das sie fanden. Er brauchte dazu nur Saatgut, Früchte, die er in die Erde pflanzen konnte.
Und so gingen sie durch den Forst, schweigend. Seine Schwester plauderte nicht wie sonst, sondern schien wie er die Wärme zu genießen, die Sonnenstrahlen, die durch die Blätter der Bäume auf den gelben Sandweg schienen.
Jetzt erreichten sie den Rand des Waldes und waren wieder am Abhang, da, wo die flache Landschaft, in der die Stadt lag, sich sanft erhob zu weich gerundeten Hügeln, zu denen sie hinaufsahen. An den Abhängen lagen malerisch Felder, auf denen jetzt, im Hochsommer, goldgelbes Getreide stand, unterbrochen von dem saftige Grün der Kartoffel- und dem Hellgrün der Rübenäcker. Zu den Kartoffeln wollten sie, weit hinauf, sie gingen im Rain zwischen den Getreidefeldern, bis sie den ersten Acker erreicht hatten.
„Hier, halt den Sack auf, ich werfe die Knollen hinein“, wies Eduard seine Schwester an und fing an, die Pflanzen mit den Händen auszugraben, an deren Wurzeln frische Kartoffeln hingen, zart, hellgelb, nur von dunkler Erde bedeckt. Vier Pflanzen hatte er ausgegraben, er war vollkommen in die Arbeit vertieft, da hörte er trampelnde Schritte über den Rain kommen.
„Was macht ihr denn da?“ hörte er eine schwere drohende Stimme hinter sich und richtete sich auf, als schon der erste Schlag eines schweren Knüppels seine Schulter traf. Er schrie laut auf vor Schmerz.
„Ich werde euch zeigen, mir meine Kartoffeln klauen, was meint ihr wohl, wenn jeder aus der Stadt kommt und hier gräbt, was denn wohl für uns bleibt?“, schrie ein kräftiger Mann hinter ihm und jetzt prasselten die Schläge wie Hagel auf seinen Kopf, auf die Schulter und auf den Rücken.
Eduard hatte sich in der ersten Panik nach seiner Schwester umgesehen und sie nicht entdecken können.
„Gott sei Dank, sie ist weggelaufen“, dachte er bei sich und sah nun auf den Bauern, der groß schwer und bedrohlich vor ihm stand, den Knüppel schon wieder zum Schlag erhoben und hinter ihm den Sohn, jünger, aber nicht weniger drohend. Da drehte Eduard Eschenburg sich um und lief, den Sack im Stich lassend, davon, so schnell er konnte. Er hörte hinter sich die trampelnden Stiefel der Verfolger, die aber immer weiter entfernt klangen. Sie konnten mit dem jungen Eduard, der noch aus dem Krieg trainiert war, nicht mithalten und blieben irgendwann stehen, ihm Drohungen hinterherschreiend, deren Inhalt Eduard aber nicht verstand. Er war nur froh, als er den Waldrand erreichte und jetzt anfangen konnte, nach Kathrin Ausschau zu halten. Da vorne sah er einen roten Zipfel hinter einem Baum, das war das Kleid seiner Schwester, die sich dort versteckt hatte.
„Kathrin, Gott sei Dank, da bist du ja, bist du schnell genug weggelaufen?“, er war aufgeregt und glücklich.
„Ja, natürlich, Eduard, das hast du mir ja gesagt, aber was haben sie mit dir gemacht? Du hast ja lauter blaue Flecken auf dem Arm.“
„Nicht nur auf dem Arm, ich glaube, sie haben mir den Rücken grün und blau geprügelt, aber mehr ist auch nicht passiert, nur der schöne Sack mit den Kartoffeln, der ist wohl weg.“
„Macht nichts, einen Sack beschaffen wir schon wieder, und morgen möchte ich wieder mit dir losgehen, wir gehen dann auf ein anderes Feld, nicht?“
„Nein, gerade nicht, jetzt gehen wir zu dem gleichen Feld zurück, aber heute geht das nicht mehr, wir haben keine Tasche oder so etwas.“
Langsam und froh, halbwegs glimpflich davongekommen zu sein, gingen sie nach Hause.