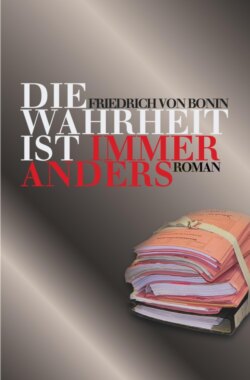Читать книгу Die Wahrheit ist immer anders - Friedrich von Bonin - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3.
„Ich verstehe einfach nicht den Unterschied zwischen der Leistungs- und der Eingriffskondiktion.“ Hilfesuchend sah seine Platznachbarin Eduard Eschenburg an. Sie war die einzige Frau in der Universität, die Jura studierte und wurde von allen Kommilitonen und den Professoren misstrauisch betrachtet. Was wollte eine Frau mit Jura anfangen? Frauen sollten nähen und kochen lernen, tanzen, damit sie später einen Mann bekamen, und schon gar, wenn sie so hübsch waren wie die hier.
„Die hier“ saß in der Vorlesung im Hörsaal neben Eduard Eschenburg, dem einzigen, der nicht empört zur Seite rückte, wenn sie sich neben ihn setzte. Sie hörten Professor Springhammers Vorlesung über die Paragrafen 812 folgende des Bürgerlichen Gesetzbuches, die Vorschriften über die ungerechtfertigte Bereicherung, Kondiktion genannt, und alle waren der Meinung, diese Paragrafen seien nur dazu da, um Studenten der Rechte das Leben schwer zu machen.
„Ich verstehe das doch auch nicht“, flüsterte er zurück, „ich heiße übrigens Eduard Eschenburg.“
„Ich heiße Andrea de Hourot“, kam es zurück und er sah, wie sie rot wurde. Trotzdem fragte er erstaunt zurück:
„Wie heißen Sie?“
„Andrea de Hourot, kommen Sie, ich schreib es auf.“
Und sie schrieb ihren Namen säuberlich in einer zierlichen Handschrift auf ein weißes Stück Papier.
„Pst“, waren die ersten empörten Reaktionen auf ihr Flüstern zu hören, Eduard wusste nicht, waren sie wirklich gestört oder nur neidisch, dass die jungen Frau mit ihm redete.
„Warten Sie nach der Vorlesung auf mich und wir trinken einen Tee?“ fragte er und wieder meldeten sich Kommilitonen, die sich gestört fühlten. Jetzt war Eduard rot geworden, er empfand sehr deutlich, er war zu mutig gewesen, das musste sie ablehnen.
„Gerne, ich warte vor dem Hörsaal“, schrieb sie auf ihr Papier, und dann lauschten sie weiter den Ausführungen des Professors zur ungerechtfertigten Bereicherung.
Eduard Eschenburg verstand nichts von der Vorlesung. Das lag nicht daran, dass er begriffsstutzig war, sondern daran, dass er zum ersten Mal nicht aufpasste. Aus den Augenwinkeln betrachtete er immer wieder seine Nachbarin, mit der er nun verabredet war. Eine schlanke junge Frau saß sie neben ihm, mit kohlschwarzen langen Haaren, einem vollen Mund und einer kleinen, geraden Nase. Sie hatte ein leichtes geblümtes Sommerkleid an, trug keinerlei Schmuck. Mit langen schmalen Händen schrieb sie Notizen in ihr Heft. Mehr sah Eduard nicht, aber das war ihm auch genug. Was Professor Springhammer vortrug, nahm er nicht wahr.
Der Herbst meinte es gut mit ihnen in diesem Jahr. Noch war das Laub nicht gefärbt, ein strahlend schöner Sommertag empfing Eduard und Andrea, als sie aus dem Universitätsgebäude kamen und auf die Straße traten. Eduard hatte vorgeschlagen, in ein Café in der Nähe der Universität zu gehen, in dem man draußen sitzen konnte und das wegen der hohen Preise von Studenten kaum besucht wurde. Das Café lag an einem kleinen Stadtsee, die Terrasse war lauschig auf das Wasser ausgerichtet. Langsam gingen sie über die Straße, von Pferdefuhrwerken und Autos überholt. Eduard war verlegen, er wusste nicht, was er sprechen sollte, als sie den Anfang machte.
„Sie haben das auch nicht verstanden mit der ungerechtfertigten Bereicherung?“
„Nein, aber wir können ja versuchen, zusammenzulegen, was jeder von uns begriffen hat, vielleicht wird ja was draus.“
Sie lachte. „Wir sollten das versuchen, aber viel Hoffnung habe ich nicht.“
Er verstummte und schweigend gingen sie in das Café und bestellten.
Zum ersten Mal sah er sie voll an. Sie hatte weit auseinander stehende dunkle Augen, die ihn jetzt ebenso ernsthaft musterten wie er sie.
„Kommen Sie aus Königsfeld?“ fragte sie.
„Ja, seit meiner Geburt lebe ich hier, schon meine Eltern sind hier geboren.“
Und nun fragte sie ihn aus, nach seinen Eltern, nach seiner Schwester, wie er lebte und er erzählte bereitwillig von sich, wie er sein Studium finanzierte. Als sie nach dem Krieg fragte, wich er aus. Er wolle heute nicht daran denken.
„Nein, jetzt bin ich dran“, lachte er und fragte sie aus.
Andrea de Hourot lebte erst seit fünfzehn Jahren in Königsfeld, ihre Eltern waren vor dem Krieg hergekommen, weil der Vater als Arzt im hiesigen Krankenhaus eine Anstellung gefunden hatte. Ihre Eltern lebten noch, sie wohnten im Zentrum der Stadt, in der Nähe des Krankenhauses, in einer ruhigen Seitenstraße. Ihr Vater war wieder als Arzt tätig, ihre Mutter versorgte den Haushalt und sie studierte Jura, sehr zum Entsetzen ihrer Eltern.
„Kind, warum das denn? Du brauchst doch nicht zu studieren, um einen Mann zu kriegen!“, hatten sie ausgerufen und Eduard musste lachen, wie die junge Frau ihre Eltern parodierte.
Immer weiter erzählten sie, immer persönlicher, Eduard gestand, wie er eingebrochen war, direkt nach dem Krieg, und wie er sich schämte. Nein, das hatte sie nicht müssen, ihr Vater hatte immer genug verdient, aber mitleidig sah sie ihn an:
„Vier Jahre im Krieg und dann nichts zu essen, das muss ja furchtbar gewesen sein.“
Er sah ihren mitleidigen Blick
„Aber das war nicht das Schlimmste“, sagte er, „einmal in diesen Kriegsjahren, es war im zweiten Jahr, bin ich dem Kaiser begegnet. Er besuchte die Westfront in Frankreich und zeichnete einige der Offiziere aus, unter anderen auch mich. Da stand ich ihm gegenüber und sah ihm in dieses kaiserliche Gesicht. Ich sah den geraden Blick aus seinen klaren strengen Augen, ich sah den Schnurrbart, der aufwärts gebürstet war, ich sah die aufrechte Gestalt, unseren obersten Kriegsherrn und sah darin alles, was richtig und klar war, Tapferkeit, Wahrhaftigkeit, Güte, Gerechtigkeit, alles das war für mich in dieser Gestalt gebündelt, in unserem Kaiser. Ich wusste: Für ihn, diesen Kaiser, hatte ich gekämpft und würde weiterkämpfen bis zum Tode oder bis zum Sieg, und ich kämpfte weiter, ich tötete, verwundete und siegte, bis zum Ende. Und dann kapitulierte Deutschland und wir erfuhren: Er war nicht gefallen, er hatte nicht mannhaft dem Feind das Schwert übergeben, nein, er war geflohen, schändlich hatte er sich davongemacht, er, unser Kaiser.“
Eduard machte eine Pause und holte tief Luft, er sah Andrea gerade an:
„Und seitdem weiß ich nichts mehr. Alles ist falsch, was ich bis dahin gefühlt und gedacht habe, nichts stimmt mehr.“
Andrea sah ihn an, lange, schweigend, mitfühlend, gerade in die Augen.
„Aber wir“, flüsterte sie endlich, „stimmt das auch nicht? Sitzen wir nicht hier und sprechen über uns?“
Eduards Augen waren voller Tränen.
„Doch, das schon. Aber die Vergangenheit sitzt auch hier. Ich habe gekämpft, ich habe getötet, es war richtig und gut, solange ich an das Reich, an den Kaiser geglaubt habe und es wurde falsch, wenn das Reich und der Kaiser nichts war, hohl, und ich kam zurück, ausgebrannt und leer und musste mir mein Essen zusammenstehlen.“
„Eduard“, bat sie, „Eduard, können wir nicht die Vergangenheit einen Moment lang vergessen und an uns denken, an die Zukunft. Darf ich Eduard und du zu dir sagen? Darf ich dich daran erinnern, wie jung wir sind und was wir vor uns haben? Wir schaffen uns einen neuen Glauben, ein neues Reich und Neues, an das wir glauben.“
Eduard sah sie an.
„Andrea, ich weiß seit langem, du heißt Andrea, ja, gerne sage ich du zu dir.“
Für diesmal trennten sie sich, aber schnell gewöhnten sich die Kommilitonen aus der Fakultät daran, Eduard mit dieser einzigen Frau in ihrem Kreis zusammen zu sehen, sie besuchten Vorlesungen, saßen nebeneinander, lernten miteinander.
„Gehst du mit mir, Eduard?“ fragte sie ihn eines Nachmittags, „heute Abend auf eine Versammlung?“
„Worum geht es denn?“
„Das ist eine politische Versammlung von Menschen, die sich gegen das Unwesen der Freikorps wenden. Sie haben sich die Gründung einer Räterepublik auf die Fahnen geschrieben, weißt du, wie vor einigen Jahren in München.“
„Aber wird darüber noch diskutiert? Ich denke, die Räterepublik ist gescheitert, haben sie die nicht niedergeschlagen und ihre Führer ermordet?“
„Ja, eben, sie haben ihre Führer ermordet, und seitdem machen sich auch in München, wie hier in Königsfeld, die Schläger der Freikorps breit. Wir wollen das verhindern.“
Eduard wunderte sich. Er hatte sich nie mit Andrea über Politik unterhalten, sich auch nie dafür interessiert. Klar, der Kaiser war geflohen, das Kaiserreich gab es nicht mehr, erst hatte Revolution auf dem Programm gestanden, dann war die Republik gegründet worden, aber Eduard kannte weder die politischen Parteien noch die Menschen, die sie vertraten. Er hatte genug damit zu tun, sich und seine Schwester zu ernähren und noch zu studieren, für anderes hatte er keine Zeit.
Er hatte allerdings die Rotten von uniformierten jungen Männern wahrgenommen, die sich in der Innenstadt immer wieder versammelten und ihre Parolen schrien. Er wusste, auch in Königsfeld ermordeten sie diejenigen, die ihnen entgegentreten wollten. Eduard empfand Unbehagen, wenn er sie sah und wich ihnen aus. Er für seinen Teil hatte genug gekämpft, er wollte sich möglichst schnell ein ziviles Leben aufbauen, nein, mit Politik wollte er nichts zu tun haben.
„Bitte, Eduard, dieses eine Mal komm doch mit“, bat ihn Andrea, als er ihr das sagte, „hör dir doch einfach nur mal an, was sie sagen, du brauchst ja nicht selbst mit zu machen.“
Und so gingen sie, es war Herbst und die Bäume hatten angefangen, ihr Laub abzuwerfen, durch den regnerischen Abend in die Innenstadt. Der Weg war weit, aber Eduard ging gerne und viel. Nach einer Dreiviertelstunde kamen sie an einem Hochhaus an, das am Ende des Krieges durch Bomben stark beschädigt und noch nicht wiederaufgebaut worden war. Andrea kannte sich offenbar aus, sie führte ihn durch die Eingangstür in den Hof und in einen Keller, aus dem Stimmen kamen.
Andrea stellte Eduard dem Posten vor, der an der Tür die Besucher kontrollierte.
„Das ist Eduard Eschenburg, Maurer und Student, ich bürge für ihn.“
Der Posten nickte und sie betraten den Keller.
In der rauchgeschwängerten Luft konnte Eduard zunächst nichts erkennen, er, der nie geraucht hatte, empfand einen starken Hustenreiz, unterdrückte ihn und setzte sich neben Andrea auf einen Stuhl am Rand einer ganzen Reihe. Der Saal war voll besetzt, ziemlich weit vorne sprach ein Mann mit einer hellen, durchdringenden Stimme.
„Und deshalb, Genossen“, rief er gerade energisch, „müssen wir verhindern, dass wir in Königsfeld und dass das ganze deutsche Reich jemals wieder in einen imperialistischen Krieg gezogen wird.“
„Richtig“, schallte es ihm entgegen und Eduard fühlte sich erleichtert. Das kam ihm mindestens entgegen. Er fing an, sich zu entspannen und betrachtete die Menschen um sich herum. Männer waren es zumeist, Eduard konnte höchstens drei oder vier Frauen entdecken, von denen eine Andrea war. Sonst saßen hier Männer, junge Männer unter dreißig waren in der Überzahl, aber direkt vor ihm saß einer, der mit Sicherheit über fünfzig Jahre alt war und mehrere andere, die Eduard ansah, waren ungefähr ebenso alt. Harte und kluge Gesichter sah er um sich herum, die Falten tief eingegraben, auch die jungen hatten viel gesehen, klar, dachte er, die waren alle wie er im Krieg gewesen und hatten gelitten.
Er wandte seine Aufmerksamkeit dem Redner zu.
„Wir wissen, wie die Räterepublik von den Freikorps und den Berliner Soldaten zusammengeschossen worden ist, wir wissen, wie sie die Idee der Menschenrechte und der Freiheit in Blut erstickt haben“, schmetterte er, „und trotzdem werden wir nicht ruhen, bis wir hier in Königsfeld und im deutschen Reich eine neue kommunistische Republik errichten, kraftvoll, mit unseren proletarischen Ideen!“
Tosender Beifall, Klatschen und Zurufe erfüllten den engen Raum und der Redner trat von der Bühne ab, er wurde von einem stillen jungen Mann abgelöst, der die Grüße der bayrischen Genossen überbrachte, ein anderer forderte die anwesenden Genossen auf, einen Räterat zu gründen.
„Schade“, flüsterte Andrea Eduard zu, „wir sind ein bisschen spät gekommen, wir haben den Genossen Tondern nur am Schluss gehört, das ist ein Redner.“
Zum Ende der Versammlung sangen sie die Internationale. Eduard sang mit, von der Begeisterung um ihn herum angesteckt, bis zur letzten Zeile
„. . . die Internationale erkämpft das Menschenrecht.“
Eduard stockte, sang nicht mehr, mit offenem Mund saß er da, biss sich fest, hielt inne bei dem Wort „erkämpft“.
Kampf, immer wieder Kampf, ob Freikorps, Kommunisten, Politiker, allen ging es um den Kampf, aber er, Eduard, hatte gekämpft.
Er war wieder in Frankreich, an der Front, im Schützengraben. Gerade war es ruhig geworden nach dem mörderischen Artilleriefeuer, das die Franzosen ihnen in die Gräben geschickt hatten, ein stundenlanges Dröhnen bei Abschuss und Pfeifen bei dem Einschlag der Granaten, endlos, nervenzerfetzend, Eduard wollte aus dem Graben stürmen, wurde von den Kameraden aufgehalten, wollte sich die Ohren zuhalten, schreien, um das ständige Brüllen der Kanonen zu übertönen, es hatte nichts geholfen. Und nun die Stille, endlich Ruhe.
„Jetzt greifen sie an, Herr Fähnrich“, sagte der alte Hauptfeldwebel, der neben ihm stand, „jetzt werden wir uns wehren müssen.“
Und tatsächlich, da kamen sie in langen Reihen gelaufen, zu erkennen an den flachen Helmen, „Lasst sie nahe heran, Männer!“ brüllte Eduard Eschenburg, der den Befehl über diesen Abschnitt hatte und der merkte, wie ihn selbst die Versuchung überkam, zu feuern, jetzt zu feuern, gleich zu feuern auf diese bedrohliche Reihe, die im Laufschritt immer näher kam und jetzt sich auflöste in einzelne Feinde, Franzosen, wie er an den Uniformen erkannte und jetzt hatte er einen im Visier, brüllte „Feuer jetzt!“ und nahm den Mann aufs Korn. Ein junger Mann, der mit angstverzerrtem Gesicht auf den Graben zulief, behindert von seinem Sturmgewehr und dem schweren Mantel. Fähnrich Eschenburg sah ihn, sah das Gesicht und zog langsam den Abzug, fühlte den Rückstoß und sah das Gesicht des jungen Mannes sich verzerren, sah, wie er im Lauf stolperte, sich an die Brust griff und fiel, endlos fiel, im Zeitlupentempo, Eschenburg sah und hörte nichts, nichts Anderes als diesen jungen Mann, den ersten, den er je in seinem Leben getötet hatte, und hier, in dem dunklen verräucherten Keller, sah er ihn wieder.
Tränen liefen ihm über das Gesicht. Nie, nie mehr wird er das Gesicht dieses jungen Mannes vergessen, viele hat er getötet seitdem, von weitem und im Nahkampf, hat im Rausch des Gefechtes die Mordlust in sich gefühlt, hat sie und sich hinterher gehasst, aber wenn er an den Krieg und das Töten denkt, sieht er dieses Gesicht.
Salzige Tränen liefen ihm über das hagere Gesicht, über die tief eingegrabenen Falten auf den Wangen.
„Lass uns gehen, jetzt“, bat er mit erstickter Stimme Andrea, die sah ihn an, nickte und zog ihn hinaus in den regnerischen Herbstabend, zog ihn an der Hand weiter, bis sie zu einer Gastwirtschaft kamen, die noch Licht zeigte.
„Was ist mit dir, Eduard?“, fragte sie besorgt und Eduard, immer noch flossen ihm die Tränen über die Wangen, erzählte von seiner Angst vor neuem Kampf.
Da nahm sie seine breite, zerrissene, harte, schwielige Maurerhand in ihre weichen feingliedrigen Frauenhände und hielt sie, lange, schweigend, und wartete, bis er sich langsam beruhigte und sie ansah.
„Eduard, du brauchst nicht mehr zu kämpfen, der Krieg ist vorbei, und uns brauchen weder Räte noch Freikorps zu interessieren.“
Sie sah ihn an. Eduard Eschenburg war ein kleiner Mann, kaum größer als sie, mit einem kantigen Kopf, mit hoher Stirn und weit auseinanderstehenden Augen unter den dunkelbraunen dichten Brauen. Schmal war er, hager, zerfurcht war das Gesicht, vom Krieg und den Entbehrungen danach gezeichnet, jetzt auch noch von Leid und Kummer. Sie hielt immer noch seine Hand und streichelte sie, ganz leicht und vorsichtig.